PDF Auf Zobodat.At
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(Amsel, 1954) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) – a New Species for the Croatian Pyraloid Moth Fauna, with an Updated Checklist
NAT. CROAT. VOL. 30 No 1 37–52 ZAGREB July 31, 2021 original scientific paper / izvorni znanstveni rad DOI 10.20302/NC.2021.30.4 PSOROSA MEDITERRANELLA (AMSEL, 1954) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE, PHYCITINAE) – A NEW SPECIES FOR THE CROATIAN PYRALOID MOTH FAUNA, WITH AN UPDATED CHECKLIST DANIJELA GUMHALTER Azuritweg 2, 70619 Stuttgart, Germany (e-mail: [email protected]) Gumhalter, D.: Psorosa mediterranella (Amsel, 1954) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) – a new species for the Croatian pyraloid moth fauna, with an updated checklist. Nat. Croat., Vol. 30, No. 1, 37–52, 2021, Zagreb. From 2016 to 2020 numerous surveys were undertaken to improve the knowledge of the pyraloid moth fauna of Biokovo Nature Park. On August 27th, 2020 one specimen of Psorosa mediterranella (Amsel, 1954) from the family Pyralidae was collected on a small meadow (985 m a.s.l.) on Mt Biok- ovo. In this paper, the first data about the occurrence of this species in Croatia are presented. The previ- ous mention in the literature for Croatia was considered to be a misidentification of the past and has thus not been included in the checklist of Croatian pyraloid moth species. P. mediterranella was recorded for the first time in Croatia in recent investigations and, after other additions to the checklist have been counted, is the 396th species in the Croatian pyraloid moth fauna. An overview of the overall pyraloid moth fauna of Croatia is given in the updated species list. Keywords: Psorosa mediterranella, Pyraloidea, Pyralidae, fauna, Biokovo, Croatia Gumhalter, D.: Psorosa mediterranella (Amsel, 1954) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) – nova vrsta u hrvatskoj fauni Pyraloidea, s nadopunjenim popisom vrsta. -

Project CSE 1 Identification of Species and the Origin of Tribulus Found in Areas of Dried Vine Fruit Production
Final report: Project CSE 1 Identification of species and the origin of Tribulus found in areas of dried vine fruit production Prepared for The Australian Dried Fruits Research and Development Council Prepared by Dr J. K. Scott and Ms. S. M. Morrison CSIRO Division of Entomology Western Australia 31 August 1994 a DEPARTMENT OF AGRICULTURE C S I RO WESTERN AUSTRALIA AUSTRALIA CSE 1 IDENTIFYING SPECIES AND ORIGIN OF TRIBULUS FOUND IN AREAS OF DRIED VINE FRUIT PRODUCTION Organisation: CSIRO Division of Entomology Location: South Perth Department of Agriculture, W.A. Supervisor: Dr J.K. Scott Time Span: July 1991 to June 1994 Objective: To identify, and determine the origin of Tribulus species (caltrop) that occur in areas of dried vine fruit production as a pre-requisite for identifying suitable control measures. Progress: 1. Burrs of Tribulus terrestris s./. were obtained from 54 collections throughout the world distribution of this weed. 2. Morphological analysis of the burrs indicated that the Queensland and Northern Territory collections form a separate group from collections in southern Australia, and that a third group exists in northern Western Australia. The combination of height and length of burrs was most useful to separate the groups and is a suitable quick technique for the preliminary identification of major taxonomic groups. Morphology however, did not reflect all of the variation detected by cytology and isozyme analysis. 3. Chromosome counts of 2n = 24, 36 and 48 were detected in root tips of germinated seed. This polyploid series appears to have an autopolyploid origin. The cytogenetic studies showed that the Queensland and Northern Territory collections are different from all other Australian collections, except possibly two southern collections. -

Comparative Morphology of the Male Genitalia in Lepidoptera
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE MALE GENITALIA IN LEPIDOPTERA. By DEV RAJ MEHTA, M. Sc.~ Ph. D. (Canta.b.), 'Univefsity Scholar of the Government of the Punjab, India (Department of Zoology, University of Oambridge). CONTENTS. PAGE. Introduction 197 Historical Review 199 Technique. 201 N ontenclature 201 Function • 205 Comparative Morphology 206 Conclusions in Phylogeny 257 Summary 261 Literature 1 262 INTRODUCTION. In the domains of both Morphology and Taxonomy the study' of Insect genitalia has evoked considerable interest during the past half century. Zander (1900, 1901, 1903) suggested a common structural plan for the genitalia in various orders of insects. This work stimulated further research and his conclusions were amplified by Crampton (1920) who homologized the different parts in the genitalia of Hymenoptera, Mecoptera, Neuroptera, Diptera, Trichoptera Lepidoptera, Hemiptera and Strepsiptera with those of more generalized insects like the Ephe meroptera and Thysanura. During this time the use of genitalic charac ters for taxonomic purposes was also realized particularly in cases where the other imaginal characters had failed to serve. In this con nection may be mentioned the work of Buchanan White (1876), Gosse (1883), Bethune Baker (1914), Pierce (1909, 1914, 1922) and others. Also, a comparative account of the genitalia, as a basis for the phylo genetic study of different insect orders, was employed by Walker (1919), Sharp and Muir (1912), Singh-Pruthi (1925) and Cole (1927), in Orthop tera, Coleoptera, Hemiptera and the Diptera respectively. It is sur prising, work of this nature having been found so useful in these groups, that an important order like the Lepidoptera should have escaped careful analysis at the hands of the morphologists. -

Redalyc.New and Interesting Portuguese Lepidoptera Records from 2007 (Insecta: Lepidoptera)
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Corley, M. F. V.; Marabuto, E.; Maravalhas, E.; Pires, P.; Cardoso, J. P. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2007 (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 36, núm. 143, septiembre, 2008, pp. 283-300 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45512164002 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 283-300 New and interesting Po 4/9/08 17:37 Página 283 SHILAP Revta. lepid., 36 (143), septiembre 2008: 283-300 CODEN: SRLPEF ISSN:0300-5267 New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2007 (Insecta: Lepidoptera) M. F. V. Corley, E. Marabuto, E. Maravalhas, P. Pires & J. P. Cardoso Abstract 38 species are added to the Portuguese Lepidoptera fauna and two species deleted, mainly as a result of fieldwork undertaken by the authors in the last year. In addition, second and third records for the country and new food-plant data for a number of species are included. A summary of papers published in 2007 affecting the Portuguese fauna is included. KEY WORDS: Insecta, Lepidoptera, geographical distribution, Portugal. Novos e interessantes registos portugueses de Lepidoptera em 2007 (Insecta: Lepidoptera) Resumo Como resultado do trabalho de campo desenvolvido pelos autores principalmente no ano de 2007, são adicionadas 38 espécies de Lepidoptera para a fauna de Portugal e duas são retiradas. -

Recerca I Territori V12 B (002)(1).Pdf
Butterfly and moths in l’Empordà and their response to global change Recerca i territori Volume 12 NUMBER 12 / SEPTEMBER 2020 Edition Graphic design Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis Mostra Comunicació Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Museu de la Mediterrània Printing Gràfiques Agustí Coordinadors of the volume Constantí Stefanescu, Tristan Lafranchis ISSN: 2013-5939 Dipòsit legal: GI 896-2020 “Recerca i Territori” Collection Coordinator Printed on recycled paper Cyclus print Xavier Quintana With the support of: Summary Foreword ......................................................................................................................................................................................................... 7 Xavier Quintana Butterflies of the Montgrí-Baix Ter region ................................................................................................................. 11 Tristan Lafranchis Moths of the Montgrí-Baix Ter region ............................................................................................................................31 Tristan Lafranchis The dispersion of Lepidoptera in the Montgrí-Baix Ter region ...........................................................51 Tristan Lafranchis Three decades of butterfly monitoring at El Cortalet ...................................................................................69 (Aiguamolls de l’Empordà Natural Park) Constantí Stefanescu Effects of abandonment and restoration in Mediterranean meadows .......................................87 -

Contributo Alla Conoscenza Della Famiglia Crambidae in Romagna (Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna Quad. Studi Nat. Romagna, 47: 63-128 (giugno 2018) ISSN 1123-6787 Gabriele Fiumi Contributo alla conoscenza della famiglia Crambidae in Romagna (Insecta: Lepidoptera: Crambidae) Riassunto Questo articolo riporta i dati faunistici di 126 specie della famiglia di Crambidae viventi in Romagna. La famiglia comprende 10 sottofamiglie: Acentropinae, Crambinae, Cybalomiinae, Evergestinae, Glaphyriinae, Odontiinae, Pyraustinae, Schoenobiinae, Scopariinae, Spilomelinae. Le ricerche territoriali su questa famiglia di microlepidotteri ebbero inizio da Pietro Zangheri nel secolo scorso. Dopo 50 anni i dati, pubblicati dall’Autore nel 1969 e contenuti nel “Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna”, vengono aggiornati e integrati con l’aggiunta di 31 specie. Abstract [A contribution to knowledge of the Crambidae of Romagna (Insecta: Lepidoptera: Crambidae)] Faunistic data on 126 species of Crambidae (Insecta, Lepidoptera) living in Romagna region (Italy). Crambidae are a family of Microlepitoptera, subdivided into ten subfamilies: Acentropinae, Crambinae, Cybalomiinae, Evergestinae, Glaphyriinae, Odontiinae, Pyraustinae, Schoenobiinae, Scopariinae and Spilomelinae. The first list of the Crambidae of Romagna was published by Pietro Zangheri in 1969. The present paper updates Zangheri’s survey after half a century, by adding 31 species. Introduction and Concluding Remarks are both in Italian and in English. Key words: Lepidoptera, Crambidae, checklist, Romagna, Italy. Introduzione I Crambidae sono una famiglia di microlepidotteri. Nella Checklist delle specie della fauna italiana (Minelli, Ruffo & La Posta, 1995), questa famiglia comprende 292 specie racchiuse in 86 generi. Recentemente due nuove specie alloctone sembrano essersi acclimatate in Romagna e quindi vengono aggiunte alla presente lista, trattasi di Cydalima perspectalis (Walker, 1859) e Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775). -

Lepidoptera: Pyraloidea) SHILAP Revista De Lepidopterología, Vol
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Asselbergs, J. E. F.; Seguna, A.; Sammut, P. Recent records of Pyraloidea species new to Malta, including two species new to the European fauna (Lepidoptera: Pyraloidea) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 36, núm. 144, diciembre, 2008, pp. 465-471 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45511220008 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 465-471 Recent records of Pyral 15/12/08 16:37 Página 465 SHILAP Revta. lepid., 36 (144), diciembre 2008: 465-471 CODEN: SRLPEF ISSN:0300-5267 Recent records of Pyraloidea species new to Malta, including two species new to the European fauna (Lepidoptera: Pyraloidea) J. E. F. Asselbergs, A. Seguna & P. Sammut Abstract Acrobasis obliqua clusinella Zeller, 1848, Acrobasis centunculella (Mann, 1859), Psorosa dahliella (Treitschke, 1832), Psorosa mediterranella Amsel, 1953, Euzopherodes lutisignella (Mann, 1869), Delplanqueia inscriptella (Duponchel, 1836), Isauria dilucidella (Duponchel, 1836), Euchromius gozmanyi Bleszynski, 1961, Udea numeralis (Hübner, 1796), Ancylosis (Heterographis) costistrigella (Ragonot, 1890) and Caina deletella Ragonot, 1893 are new to the Maltese Islands. The latter two species are also the first records for the European fauna. Where known, data on the biology, the first stages and the distribution of the species is given. Additional notes on some other pyraloid species from Malta are also given. -

Bulgaria in Summer
Bulgaria in Summer Naturetrek Tour Report 31 July - 7 August 2012 Gentianella bulgarica Argiope lobata - spider White Stork Carcharodes orientalis - Oriental Marbled Skipper Report and images by Alan Outen Naturetrek Mingledown Barn Wolf's Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ UK T: +44 (0)1962 733051 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Tour Report Bulgaria in Summer Tour participants: Alan Outen (leader) & Mario Langourov (local guide) with 11 Naturetrek clients Driver Sacho Summary During the course of just a week we had enjoyed superb scenery, a wonderful range of wildlife and splendid hospitality. We had seen an overall total of 763 identified species (the second highest ever for this tour) including 346 higher plants and 265 invertebrate species, of which 89 were butterflies and 31 moths, as well as 23 dragonflies, 23 bugs, 28 beetles etc. It is always difficult to find birds on this tour, being rather late in the season. The extremely high temperatures throughout the week also did not help as birds sort cover, but we nonetheless managed a creditable total of 95 species, including some not often seen on this tour; the tour average over eight years exactly 100 species. Day 1 Tuesday 31st July Fly Heathrow to Sofia then drive to Melnik via stop at Verdena River Sunny on arrival in Sofia, hot, with maximum temp. 28°C As so often on this route, our flight was a few minutes late at take off from Heathrow but we made up time, landing twenty-three minutes ahead of schedule. Having cleared immigration and collected all our baggage, we found Mario, our Bulgarian guide, together with Peter and Susan who had travelled out separately. -

Contribució a L'estudi Dels Microlepidòpters De La Comarca De L'anoia
CONTRIBUCIÓ A L'ESTUDI DELS MICROLEPIDÒPTERS DE LA COMARCA DE L'ANOIA. FAMÍLIA CRAMBIDAE.* per EMILI REQUENA I MIRET • Aquest treball va guanyar «ex-aequo» el III Premi Jaume Caresmar, atorgat l'any 1989 i convocat conjun tament pel M.I. Ajuntament d'Igualada i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada 11 INTRODUCCIÓ Un dels treballs d'investigació més interessants dins del camp de la lepidopte- rologia se centra en la taxonomia, o sigui, en la classificació i determinació, en aquest cas, dels lepidòpters. Per determinar a quina espècie pertany un lepidòpter, allò més fàcil és fer un reconeixement de la forma i el color de les ales, la qual cosa és factible en molts casos, sobretot en papallones diürnes, però en d'altres varietats, com ara les noc turnes i, especialment, en els microlepidòpters, la correcta determinació esdevé molt més difícil. És per això que haurem d'ajudar-nos en d'altres elements de l'in secte que tinguin característiques més constants que no pas els variables dibuixos de les ales. Un d'aquests elements és la nerviació alar, que es pot posar en evidència mit jançant tècniques adequades i permet realitzar una determinació familiar i en al guns casos fins i tot genèric, però no específic. Un altre element extern de determinació és la forma de les antenes, que ens servirà en alguns casos per conèixer el sexe de les espècies o també, en d'altres, per conèixer la família a què pertany. D'altres elements externs poden ser els palps labials, precisament molt caracte rístics en el grup de microlepidòpters que tractarem ací. -
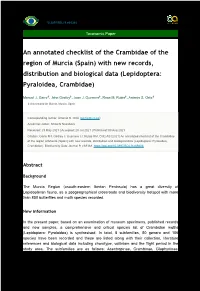
An Annotated Checklist of the Crambidae of the Region of Murcia (Spain) with New Records, Distribution and Biological Data (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae)
Biodiversity Data Journal 9: e69388 doi: 10.3897/BDJ.9.e69388 Taxonomic Paper An annotated checklist of the Crambidae of the region of Murcia (Spain) with new records, distribution and biological data (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae) Manuel J. Garre‡‡, John Girdley , Juan J. Guerrero‡‡, Rosa M. Rubio , Antonio S. Ortiz‡ ‡ Universidad de Murcia, Murcia, Spain Corresponding author: Antonio S. Ortiz ([email protected]) Academic editor: Shinichi Nakahara Received: 29 May 2021 | Accepted: 20 Jul 2021 | Published: 03 Aug 2021 Citation: Garre MJ, Girdley J, Guerrero JJ, Rubio RM, Ortiz AS (2021) An annotated checklist of the Crambidae of the region of Murcia (Spain) with new records, distribution and biological data (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae). Biodiversity Data Journal 9: e69388. https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e69388 Abstract Background The Murcia Region (osouth-eastern Iberian Peninsula) has a great diversity of Lepidopteran fauna, as a zoogeographical crossroads and biodiversity hotspot with more than 850 butterflies and moth species recorded. New information In the present paper, based on an examination of museum specimens, published records and new samples, a comprehensive and critical species list of Crambidae moths (Lepidoptera: Pyraloidea) is synthesised. In total, 8 subfamilies, 50 genera and 106 species have been recorded and these are listed along with their collection, literature references and biological data including chorotype, voltinism and the flight period in the study area. The subfamilies are as follows: Acentropinae, Crambinae, Glaphyriinae, © Garre M et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. -

A Provisional Checklist and Bibliography of the Pyraloidea of the Balkan Peninsula (Lepidoptera: Pyralidae & Crambidae) by Colin W
Atalanta 49 (1-4): 219-263, Marktleuthen (1. September 2018), ISSN 0171-0079 A provisional checklist and bibliography of the Pyraloidea of the Balkan Peninsula (Lepidoptera: Pyralidae & Crambidae) by COLIN W. PLANT & PREDRAG JAKšIć received 28.V.2018 Abstract: A literature search was undertaken by us to locate all published data on the Pyraloidea (Lepidoptera: Crambidae & Pyralidae) of the Balkan Peninsula of south-east Europe. All known paper publications to the end of June 2018 were researched. All publications apparently containing relevant data were read and scrutinised by us and valid data extracted to a database. With the exception of the Fauna Europaea and Lepiforum websites, electronic sources were not searched, because initial examination suggested that these were likely to include non-corroborated data. From the results of this exercise, a checklist of 569 species of Py- raloidea recorded in the Balkans (310 Crambidae and 259 Pyralidae) was created along with a bibliography of the 426 works con- sulted. Forty-four of the species in the checklist (~8%) were not included for the same area in a 1996 European checklist; this may reflect a genuine change in the fauna over the last quarter century. Some updating of nomenclature and related matters has been undertaken, but we have done only minimal checking of the data itself to eliminate any incorrect records. It should be noted that no attempt has been made to determine if the listed species remain extant within each country at year 2018 nor is any comment made concerning present-day status of any species. Both the checklist and the bibliography are regarded as provisional; a database will be maintained by the authors and will be updated from time to time. -

José Joaquín Pérez De-Gregorio
Boln. S.E.A., nº 34 (2004) : 199 – 203. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS CRAMBIDAE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES (LEPIDOPTERA, CRAMBIDAE) (III): CRAMBIDAE DE LA CATALUÑA OCCIDENTAL José Joaquín Pérez De-Gregorio Departamento de Entomología, Museo de Ciencias Naturales (Museo de Zoología), Parc de la Ciutadella s/n. E- 08003 Barcelona. Resumen: Se exponen los resultados del estudio de los Crambidae de la Cataluña Occidental. Se da la relación de las especies (61) halladas en la zona objeto de estudio y se incluyen comentarios sobre los taxones más interesantes desde el punto de vista faunístico y biogeográfico. Palabras clave: Lepidoptera, Crambidae, faunística, Cataluña Occidental, Península Ibérica. Crambidae (Lepidoptera, Crambidae) of the Western Catalonia (Iberian Peninsula) Abstract: The results of research carried out on the Crambidae of Western Catalonia are described. A list of the 61 species is recorded, together wicht notes on the taxa that are of most interest from a faunal and biogeografical point if view. Key words: Lepidoptera, Crambidae, faunistic, Western Catalonia, Iberian Peninsula. Introducción La Cataluña Occidental comprende las zonas esteparias Mata) recolectaron material de lepidópteros heteróceros en situadas al suroeste de la región, incluidas administrativa- las localidades de Anglesola, Barbens y Tàrrega (Pla mente en las comarcas de La Noguera, el Pla d´Urgell, Las d´Urgell), que enriquecieron las colecciones del Centro y Garrigues y el Segrià, en el sur de la provincia de Lleida. que fueron y han sido objeto de diversos trabajos (véase Sus especiales características biogeográficas, que compren- Pérez De- Gregorio, 2003). den páramos de carácter desértico, semidesértico y xerófilo Con posterioridad al año 1923 y hasta fecha reciente (únicos en Cataluña y muy parecidos a los de los vecinos (1986), las prospecciones lepidopterológicas en la Catalun- Monegros aragoneses), con bosque poco denso de pino ya Occidental fueron esporádicas u ocasionales.