Vogelspinnen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

By Lasiodora Klugi (Aranea: Theraphosidae) in the Semiarid Caatinga Region of Northeastern Brazil
Predation on Tropidurus hispidus (Squamata: Tropiduridae) by Lasiodora klugi (Aranea: Theraphosidae) in the semiarid caatinga region of northeastern Brazil Vieira, W.L.S. et al. Biota Neotrop. 2012, 12(4): 000-000. On line version of this paper is available from: http://www.biotaneotropica.org.br/v12n4/en/abstract?short-communication+bn02112042012 A versão on-line completa deste artigo está disponível em: http://www.biotaneotropica.org.br/v12n4/pt/abstract?short-communication+bn02112042012 Received/ Recebido em 31/07/12 - Revised/ Versão reformulada recebida em 08/11/12 - Accepted/ Publicado em 16/11/12 ISSN 1676-0603 (on-line) Biota Neotropica is an electronic, peer-reviewed journal edited by the Program BIOTA/FAPESP: The Virtual Institute of Biodiversity. This journal’s aim is to disseminate the results of original research work, associated or not to the program, concerned with characterization, conservation and sustainable use of biodiversity within the Neotropical region. Biota Neotropica é uma revista do Programa BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade, que publica resultados de pesquisa original, vinculada ou não ao programa, que abordem a temática caracterização, conservação e uso sustentável da biodiversidade na região Neotropical. Biota Neotropica is an eletronic journal which is available free at the following site http://www.biotaneotropica.org.br A Biota Neotropica é uma revista eletrônica e está integral e gratuitamente disponível no endereço http://www.biotaneotropica.org.br Biota Neotrop., vol. 12, no. 4 Predation -

Toxins-67579-Rd 1 Proofed-Supplementary
Supplementary Information Table S1. Reviewed entries of transcriptome data based on salivary and venom gland samples available for venomous arthropod species. Public database of NCBI (SRA archive, TSA archive, dbEST and GenBank) were screened for venom gland derived EST or NGS data transcripts. Operated search-terms were “salivary gland”, “venom gland”, “poison gland”, “venom”, “poison sack”. Database Study Sample Total Species name Systematic status Experiment Title Study Title Instrument Submitter source Accession Accession Size, Mb Crustacea The First Venomous Crustacean Revealed by Transcriptomics and Functional Xibalbanus (former Remipedia, 454 GS FLX SRX282054 454 Venom gland Transcriptome Speleonectes Morphology: Remipede Venom Glands Express a Unique Toxin Cocktail vReumont, NHM London SRP026153 SRR857228 639 Speleonectes ) tulumensis Speleonectidae Titanium Dominated by Enzymes and a Neurotoxin, MBE 2014, 31 (1) Hexapoda Diptera Total RNA isolated from Aedes aegypti salivary gland Normalized cDNA Instituto de Quimica - Aedes aegypti Culicidae dbEST Verjovski-Almeida,S., Eiglmeier,K., El-Dorry,H. etal, unpublished , 2005 Sanger dideoxy dbEST: 21107 Sequences library Universidade de Sao Paulo Centro de Investigacion Anopheles albimanus Culicidae dbEST Adult female Anopheles albimanus salivary gland cDNA library EST survey of the Anopheles albimanus transcriptome, 2007, unpublished Sanger dideoxy Sobre Enfermedades dbEST: 801 Sequences Infeccionsas, Mexico The salivary gland transcriptome of the neotropical malaria vector National Institute of Allergy Anopheles darlingii Culicidae dbEST Anopheles darlingi reveals accelerated evolution o genes relevant to BMC Genomics 10 (1): 57 2009 Sanger dideoxy dbEST: 2576 Sequences and Infectious Diseases hematophagyf An insight into the sialomes of Psorophora albipes, Anopheles dirus and An. Illumina HiSeq Anopheles dirus Culicidae SRX309996 Adult female Anopheles dirus salivary glands NIAID SRP026153 SRS448457 9453.44 freeborni 2000 An insight into the sialomes of Psorophora albipes, Anopheles dirus and An. -

Tarantulas and Social Spiders
Tarantulas and Social Spiders: A Tale of Sex and Silk by Jonathan Bull BSc (Hons) MSc ICL Thesis Presented to the Institute of Biology of The University of Nottingham in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Nottingham May 2012 DEDICATION To my parents… …because they both said to dedicate it to the other… I dedicate it to both ii ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost I would like to thank my supervisor Dr Sara Goodacre for her guidance and support. I am also hugely endebted to Dr Keith Spriggs who became my mentor in the field of RNA and without whom my understanding of the field would have been but a fraction of what it is now. Particular thanks go to Professor John Brookfield, an expert in the field of biological statistics and data retrieval. Likewise with Dr Susan Liddell for her proteomics assistance, a truly remarkable individual on par with Professor Brookfield in being able to simplify even the most complex techniques and analyses. Finally, I would really like to thank Janet Beccaloni for her time and resources at the Natural History Museum, London, permitting me access to the collections therein; ten years on and still a delight. Finally, amongst the greats, Alexander ‘Sasha’ Kondrashov… a true inspiration. I would also like to express my gratitude to those who, although may not have directly contributed, should not be forgotten due to their continued assistance and considerate nature: Dr Chris Wade (five straight hours of help was not uncommon!), Sue Buxton (direct to my bench creepy crawlies), Sheila Keeble (ventures and cleans where others dare not), Alice Young (read/checked my thesis and overcame her arachnophobia!) and all those in the Centre for Biomolecular Sciences. -

Hemolymph and Hemocytes of Tarantula Spiders: Physiological Roles and Potential As Sources of Bioactive Molecules
In: Advances in Animal Science and Zoology. Volume 8 ISBN: 978-1-63483-552-7 Editor: Owen P. Jenkins © 2015 Nova Science Publishers, Inc. No part of this digital document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted commercially in any form or by any means. The publisher has taken reasonable care in the preparation of this digital document, but makes no expressed or implied warranty of any kind and assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for incidental or consequential damages in connection with or arising out of information contained herein. This digital document is sold with the clear understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, medical or any other professional services. Chapter 8 HEMOLYMPH AND HEMOCYTES OF TARANTULA SPIDERS: PHYSIOLOGICAL ROLES AND POTENTIAL AS SOURCES OF BIOACTIVE MOLECULES Tatiana Soares, Thiago H. Napoleão, Felipe R. B. Ferreira and Patrícia M. G. Paiva∗ Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Cidade Universitária, Recife, Pernambuco, Brazil ABSTRACT Arachnids compose the most important and numerous group of chelicerates and include spiders, scorpions, mites and ticks. Some arachnids have a worldwide distribution and can live for more than two decades. This is in part due to their efficient defense system, with an innate immunity that acts as a first line of protection against bacterial, fungal and viral pathogens. The adaptive success of the spiders stimulates the study of their defense mechanisms at cellular and molecular levels with both biological and biotechnological purposes. The hemocytes (plasmatocytes, cyanocytes, granulocytes, prohemocytes, and leberidocytes) of spiders are responsible for phagocytosis, nodulation, and encapsulation of pathogens as well as produce substances that mediate humoral mechanisms such as antimicrobial peptides and factors involved in the coagulation of hemolymph and melanization of microorganisms. -

Husbandry Manual for Exotic Tarantulas
Husbandry Manual for Exotic Tarantulas Order: Araneae Family: Theraphosidae Author: Nathan Psaila Date: 13 October 2005 Sydney Institute of TAFE, Ultimo Course: Zookeeping Cert. III 5867 Lecturer: Graeme Phipps Table of Contents Introduction 6 1 Taxonomy 7 1.1 Nomenclature 7 1.2 Common Names 7 2 Natural History 9 2.1 Basic Anatomy 10 2.2 Mass & Basic Body Measurements 14 2.3 Sexual Dimorphism 15 2.4 Distribution & Habitat 16 2.5 Conservation Status 17 2.6 Diet in the Wild 17 2.7 Longevity 18 3 Housing Requirements 20 3.1 Exhibit/Holding Area Design 20 3.2 Enclosure Design 21 3.3 Spatial Requirements 22 3.4 Temperature Requirements 22 3.4.1 Temperature Problems 23 3.5 Humidity Requirements 24 3.5.1 Humidity Problems 27 3.6 Substrate 29 3.7 Enclosure Furnishings 30 3.8 Lighting 31 4 General Husbandry 32 4.1 Hygiene and Cleaning 32 4.1.1 Cleaning Procedures 33 2 4.2 Record Keeping 35 4.3 Methods of Identification 35 4.4 Routine Data Collection 36 5 Feeding Requirements 37 5.1 Captive Diet 37 5.2 Supplements 38 5.3 Presentation of Food 38 6 Handling and Transport 41 6.1 Timing of Capture and handling 41 6.2 Catching Equipment 41 6.3 Capture and Restraint Techniques 41 6.4 Weighing and Examination 44 6.5 Transport Requirements 44 6.5.1 Box Design 44 6.5.2 Furnishings 44 6.5.3 Water and Food 45 6.5.4 Release from Box 45 7 Health Requirements 46 7.1 Daily Health Checks 46 7.2 Detailed Physical Examination 47 7.3 Chemical Restraint 47 7.4 Routine Treatments 48 7.5 Known Health Problems 48 7.5.1 Dehydration 48 7.5.2 Punctures and Lesions 48 7.5.3 -

VKM Rapportmal
VKM Report 2016: 36 Assessment of the risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial arachnids and insects Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety Report from the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2016: Assessment of risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial arachnids and insects Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety 29.06.2016 ISBN: 978-82-8259-226-0 Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) Po 4404 Nydalen N – 0403 Oslo Norway Phone: +47 21 62 28 00 Email: [email protected] www.vkm.no www.english.vkm.no Suggested citation: VKM (2016). Assessment of risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial arachnids and insects. Scientific Opinion on the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, ISBN: 978-82-8259-226-0, Oslo, Norway VKM Report 2016: 36 Assessment of risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial arachnids and insects Authors preparing the draft opinion Anders Nielsen (chair), Merethe Aasmo Finne (VKM staff), Maria Asmyhr (VKM staff), Jan Ove Gjershaug, Lawrence R. Kirkendall, Vigdis Vandvik, Gaute Velle (Authors in alphabetical order after chair of the working group) Assessed and approved The opinion has been assessed and approved by Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES). Members of the panel are: Vigdis Vandvik (chair), Hugo de Boer, Jan Ove Gjershaug, Kjetil Hindar, Lawrence R. -

Bird-Eaters and Chicken Spiders
Pet Health and Happiness Is Our Primary Concern CONCISE CARE SHEETS BIRD-EATERS find more caresheets at nwzoo.com/care AND CHICKEN SPIDERS INTRO QUICK TIPS flies even while still being eaten, and The name “bird-eater” has been applied to tarantulas around the world. the discarded remains certainly attract In fact, it is simply a synonym for tarantula at this point and is often used » 75-80°F with a slight drop pests, mold and bacteria. equally for New World and Old World species. Its origin is an early 18th in temperature at night OK Century engraving by illustrator-natursalist Madame Sibylla Merian » Requires 70-90% humidity, that depicted a Suriname spider (presumably an Avicularia “pink-toed” but also good ventilation. WATERING tarantula) eating a small bird. However, “bird-eater” is most memorably » Roaches make an excellent Tarantulas obtain their water needs applied to the largest of all spiders, the three tarantula species of the large prey item. from their prey and would seldom drink genus Theraphosa including the Goliath Bird-eater, Theraphosa blondi. » Avoid contact with urtica- in the wild. However, tarantula keepers ting hairs! like to provide water dishes for two “Chicken Spider” is a name that has been often applied to a different reasons: as an emergency water source genus of huge South American tarantulas. Pamphobeteus species are should drinking become necessary and very popular in the tarantula hobby. There are more varieties being kept as a source of humidity in the cage. We and bred than science has identified and many have geographic names recommend always providing a shallow water dish full of clean water. -

Morphology, Evolution and Usage of Urticating Setae by Tarantulas (Araneae: Theraphosidae)
ZOOLOGIA 30 (4): 403–418, August, 2013 http://dx.doi.org/10.1590/S1984-46702013000400006 Morphology, evolution and usage of urticating setae by tarantulas (Araneae: Theraphosidae) Rogério Bertani1,3 & José Paulo Leite Guadanucci2 1 Laboratório Especial de Ecologia e Evolução, Instituto Butantan. Avenida Vital Brazil 1500, 05503-900 São Paulo SP, Brazil. E-mail: [email protected] 2 Laboratório de Zoologia de Invertebrados, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campus JK. Rodovia MGT 367, km 583, 39100-000 Diamantina, MG, Brazil. E-mail: [email protected] 3 Corresponding author. ABSTRACT. Urticating setae are exclusive to New World tarantulas and are found in approximately 90% of the New World species. Six morphological types have been proposed and, in several species, two morphological types can be found in the same individual. In the past few years, there has been growing concern to learn more about urticating setae, but many questions still remain unanswered. After studying individuals from several theraphosid species, we endeavored to find more about the segregation of the different types of setae into different abdominal regions, and the possible existence of patterns; the morphological variability of urticating setae types and their limits; whether there is variability in the length of urticating setae across the abdominal area; and whether spiders use different types of urticat- ing setae differently. We found that the two types of urticating setae, which can be found together in most theraphosine species, are segregated into distinct areas on the spider’s abdomen: type III occurs on the median and posterior areas with either type I or IV surrounding the patch of type III setae. -

Pharmacological Characterization of the Edema Caused by Vitalius Dubius (Theraphosidae, Mygalomorphae) Spider Venom in Rats
1521-0103/356/1/13–19$25.00 http://dx.doi.org/10.1124/jpet.115.226787 THE JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS J Pharmacol Exp Ther 356:13–19, January 2016 Copyright ª 2015 by The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics Pharmacological Characterization of the Edema Caused by Vitalius dubius (Theraphosidae, Mygalomorphae) Spider Venom in Rats Thomaz A. A. Rocha-e-Silva, Alessandra Linardi, Edson Antunes, and Stephen Hyslop Departamento de Farmacologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas, São Paulo, Brazil ( T.A.A.R.S., E.A., S.H.); and Departamento de Ciências Fisiológicas, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São Paulo, Brazil ( T.A.A.R.S., A.L.) Received June 14, 2015; accepted October 14, 2015 Downloaded from ABSTRACT 3 5 7 8 Bites by tarantulas (Theraphosidae, Mygalomorphae) in humans H1 receptor antagonist), D-Arg-[Hyp ,Thi ,D-Tic ,Oic -]-BK (JE can result in mild clinical manifestations such as local pain, 049, a bradykinin B2 receptor antagonist), and ((S)-N-methyl-N- erythema, and edema. Vitalius dubius is a medium-sized, non- [4-(4-acetylamino-4-phenylpiperidino)-2-(3,4-di-chlorophenyl)- aggressive theraphosid found in southeastern Brazil. In this butyl]benzamide) (SR48968, a neurokinin NK2 receptor antagonist) jpet.aspetjournals.org work, we investigated the mediators involved in the plasma had no effect on the venom-induced increase in vascular perme- extravasation caused by V. dubius venom in rats. The venom ability. In rat hind paws, the venom-induced edema was attenu- caused dose-dependent (0.1–100 mg/site) edema in rat dorsal ated by ketoprofen (a nonselective COX inhibitor) administered skin. -

Tarantula Phylogenomics
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/501262; this version posted January 8, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. Tarantula phylogenomics: A robust phylogeny of multiple tarantula lineages inferred from transcriptome data sheds light on the prickly issue of urticating setae evolution. Saoirse Foleya#*, Tim Lüddeckeb#*, Dong-Qiang Chengc, Henrik Krehenwinkeld, Sven Künzele, Stuart J. Longhornf, Ingo Wendtg, Volker von Wirthh, Rene Tänzleri, Miguel Vencesj, William H. Piela,c a National University of Singapore, Department of Biological Sciences, 16 Science Drive 4, Singapore 117558, Singapore b Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME, Animal Venomics Research Group, Winchesterstr. 2, 35394 Gießen, Germany c Yale-NUS College, 10 College Avenue West #01-101, Singapore 138609, Singapore d Department of Biogeography, Trier University, Trier, Germany e Max Planck Institute for Evolutionary Biology, 24306 Plön, Germany f Hope Entomological Collections, Oxford University Museum of Natural History (OUMNH), Parks Road, Oxford, England OX1 3PW, United Kingdom g Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart, Germany h Deutsche Arachnologische Gesellschaft e.V., Zeppelinstr. 28, 71672 Marbach a. N., Germany. i Zoologische Staatssammlung München, Münchhausenstr. 21, 81247 München, Germany j Zoological Institute, Technische Universität Braunschweig, Mendelssohnstr. 4, 38106 Braunschweig, Germany # shared first authorship, both authors contributed equally *corresponding authors, email addresses: [email protected] and [email protected] Abstract Mygalomorph spiders of the family Theraphosidae, known to the broader public as tarantulas, are among the most recognizable arachnids on earth due to their large size and widespread distribution. -
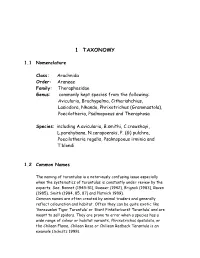
Tarantulas Is a Notoriously Confusing Issue Especially When the Systematics of Tarantulas Is Constantly Under Review by the Experts
1 TAXONOMY 1.1 Nomenclature Class: Arachnida Order: Araneae Family: Theraphosidae Genus: commonly kept species from the following: Avicularia, Brachypelma, Citharishchius, Lasiodora, Nhandu, Phrixotrichus (Grammastola), Poecilotheria, Psalmopoeus and Theraphosa Species: including A.avicularia, B.smithi, C.crawshayi, L.parahybana, N.carapoensis, P. (G) pulchra, Poecilotheria regalis, Psalmopoeus irminia and T.blondi 1.2 Common Names The naming of tarantulas is a notoriously confusing issue especially when the systematics of tarantulas is constantly under review by the experts. See. Bonnet (1945-51), Roewer (1942), Brignoli (1983), Raven (1985), Smith (1984, 85, 87) and Platnick 1989). Common names are often created by animal traders and generally reflect colouration and habitat. Often they can be quite exotic like ‘Venezuelan Tiger Tarantula’ or ‘Giant Pinkstarburst Tarantula’ and are meant to sell spiders. They are prone to error when a species has a wide range of colour or habitat variants, Phrixotrichus spatulata, or the Chilean Flame, Chilean Rose or Chiliean Redback Tarantula is an example (Schultz 1998). 2 Natural History While amongst the most famous of the spiders tarantulas remain the least studied. Much work has been done on the systematics of Theraphosidae: Bonnet (1945-61), Brignoli (1983), Raven (1985) Smith (1984-88) and Platnick (1989). Captive behaviour including incubation times and egg numbers: Galiano (1973), Baerg (1958), Bucherl (1971) and Perret (1974); growth and development: Celerier (1981 & 1988), Baerg (1928) and Buchli (1970); and adult life cycles: Dresco-Derouet (1970) and Celerier (1981). Other studies have been done on urticating hairs (Stradling 1978) and venom toxicity Ori (1982) and Ibister. (2002). Outside the lab very few extensive behavioural studies have been conducted. -

Tarsal Scopula Division in Theraphosinae (Araneae, Theraphosidae) : Its Systematic Significance
1994. The Journal of Arachnology 22 :46—5 3 TARSAL SCOPULA DIVISION IN THERAPHOSINAE (ARANEAE, THERAPHOSIDAE) : ITS SYSTEMATIC SIGNIFICANCE Fernando Perez-Miles : Division Zoologia Experimental, Instituto de Investigacione s Biologicas C. Estable, Av. Italia 3318 ; Montevideo, Uruguay . ABSTRACT. A study of entire/divided tarsal scopulae distribution was carried out on 28 genera of Thera - phosinae . Although this character has been considered an important taxonomic tool for more than a century, present findings show that the scopula condition is related to spider size. These results call into question th e systematic value of tarsal scopula division . Fine structure of theraphosid scopula is described, being differen t from that previously described for Araneomorphae . Function and phylogeny of scopula condition are discussed . RESUMEN . Se realizo un estudio de la distribucion del caracter escopulas tarsales enteras/divididas en 2 8 generos de Theraphosinae . A pesar de que dicho catheter fue considerado importante en taxonomia durant e mas de un siglo, los resultados mostraron que la condicion de la escopula esta relacionada con el tamano de l a araiia. Estos resultados permiten cuestionar el valor sistematico de la condicion de las escopulas . Se describe l a estructura de la escopula de las terafosidas, encontrandose diferencias con las escopulas descriptas previamente para las Araneomorphae. Se discute la funcion y filogenia de los tipos de escopula . The structure and function of tarsal scopulae becoming entire in adults of some subfamilies have been studied extensively in araneomorph (such as Theraphosinae). Raven (1985) used en- spiders (Homann 1957 ; Foelix & Chu-Wan g tire/divided scopula to separate genera and group s 1975 ; Rovner 1978; Miller et al .