Lyrik – Die Grosse Vielfalt (Online-Code: 47Fu8w)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals In
Writing in Red: The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals in the German Democratic Republic, 1971-90 Thomas William Goldstein A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2010 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher Browning Chad Bryant Karen Hagemann Lloyd Kramer ©2010 Thomas William Goldstein ALL RIGHTS RESERVED ii Abstract Thomas William Goldstein Writing in Red The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals in the German Democratic Republic, 1971-90 (Under the direction of Konrad H. Jarausch) Since its creation in 1950 as a subsidiary of the Cultural League, the East German Writers Union embodied a fundamental tension, one that was never resolved during the course of its forty-year existence. The union served two masters – the state and its members – and as such, often found it difficult fulfilling the expectations of both. In this way, the union was an expression of a basic contradiction in the relationship between writers and the state: the ruling Socialist Unity Party (SED) demanded ideological compliance, yet these writers also claimed to be critical, engaged intellectuals. This dissertation examines how literary intellectuals and SED cultural officials contested and debated the differing and sometimes contradictory functions of the Writers Union and how each utilized it to shape relationships and identities within the literary community and beyond it. The union was a crucial site for constructing a group image for writers, both in terms of external characteristics (values and goals for participation in wider society) and internal characteristics (norms and acceptable behavioral patterns guiding interactions with other union members). -

Bibliografie Zum Staatssicherheitsdienst Der DDR
Bibliografie zum Staatssicherheitsdienst der DDR – 2018 .bstu.de w ww Bibliografie zum Staatssicherheitsdienst der DDR Stand: Dezember 2018 BStU Bibliografie zum Fachbibliothek Staatssicherheitsdienst der DDR Stand: Dezember 2018 BStU Bibliografie zum Fachbibliothek Staatssicherheitsdienst der DDR Inhalt Vorbemerkung 4 1. Hilfsmittel (Bibliografien, Nachschlagewerke, Quellenkunde und Archivberichte) 5 2. Apparat und Tätigkeit des MfS 15 2.1. Vor 1990 erschienene Literatur 15 2.2. Allgemeine und Überblicksdarstellungen 19 2.3. Vorgeschichte des MfS 35 2.4. Apparat des MfS 41 2.5. Inoffizielle Mitarbeit und operative Methoden 66 2.6. Internationale Verbindungen 111 3. Einzelne staatliche und gesellschaftliche Bereiche 118 3.1. Spionage und Westarbeit 118 3.2. Politische Justiz 166 3.3. Opposition und Verfolgung 210 3.4. Staatssicherheit und Kirche 279 3.5. Staatssicherheit in Wissenschaft, Kultur und Medien 310 3.6. Staatssicherheit in der Wirtschaft 357 3.7. Sonstige Bereiche 371 3.8. Wendegeschehen und Auflösung des Staatssicherheitsdienstes 414 4. Angrenzende Themenbereiche 442 4.1. Andere Sicherheitsorgane und sicherheitspolitische Gremien der DDR 442 4.2. Sonstige Literatur zu Geheimdiensten (Auswahl) 457 5. Aktuelle Themen 467 5.1. Das Stasi-Unterlagen-Gesetz und seine Anwendung 467 5.2. Juristische Aufarbeitung 506 5.3. Weitere politische Aufarbeitung 541 6. Biografien 591 6.1. Sammelbiografien (auch biografische Handbücher) 591 6.2. Einzelbiografien und biografische Schriften 597 Autoren- und Herausgeberregister 640 Stand: Dezember -
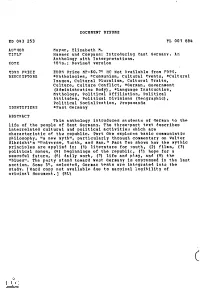
Introducing East Germany. an Anthology with Interpretations
DOCUMENT RESUME ED 043 253 FL 001 884 AUTHOR Mayer, Elizabeth M. TITLE Hammer and Compass: Introducing East Germany. An Anthology with Interpretations. NOTE 181p.; Revised version EDRS PRICE EDRS Price MF -$0.75 BC Not Available from FOPS. DESCEIPTORS *Anthologies, *Communism, Cultural Events, *Cultural Images, Cultural Pluralism, Cultural Traits, Culture, Culture Conflict, *German, Government (Administrative Body), *Language Instruction, Mythology, Political Affiliation, Political Attitudes, Political Divisions (Geographic), Political Socialization, Propaganda IDENTIFIERS *Fast Germany ABSTRACT This anthology introduces students of German to the life of the people of East Germany. The three-part text describes interrelated cultural and political activitiea which are characteristic of the republic. Part One explores basic communistic philosophy, "a new myth", particularly through commentary on Walter Ulbricht's "Bniverse, Earth, and Man." Part Two shows how the mythic principles are applied in: (1) literature for youth,(2) films, (3) political songs, (u) beginnings of the republic, 0) hope for a Peaceful future,(6) daily work, (7) life and play, and (8) the "blues". The party stand toward West Germany is expressed in the last section. Some 55, selected, German tests are integrated into the study. (Hard copy not available due to marginal legibility of orioinal document. ](RL) liANN Pil AND COMPASS introducing East Germany An Anthology with interpretations U.S. DEPARTMENT Of HEALTH. EDUCATION & WELFARE OEM Of EDUCATION EMS DOCUMENT HAS KEN REPROOUC(D EXACTLY AS RECEIVED FROM THE PERSON ON MANI/ANN TIRISIKA1IN6 Il.POINTS Of VIEW OR OPINIONS SHAD DO NOT NKESSARIl1 RtPRESEXII OfFKIAL OfIKE Of EDUCATION POSITION Of POLICY. Elizabeth M. Mayer Kalamazoo College (2308WOmetto italamaroo, Michigan 41007 Tel. -

Kaj Ni Solas Poemaro
Hans Dubois, Bellinzona 2-a eldono 2020 Heinz Kahlau Kaj ni solas Poemaro Tradukis István Ertl 1 Heinz Kahlau “Kaj ni solas” Eldonejo Hans Dubois Carlevaro Viale G. Motta 32 CH-6500 Bellinzona [email protected] Senpage elŝutebla el www.taziocarlevaro.ch 1-a eldono 1991 Hans Dubois, en Bellnzona, kaj en Budapeŝto, en la serio Modernaj Poetoj en traduko 2-a eldono 2020 Hans Dubois, en Bellinzona Libro kun poemoj selektitaj kaj tradukitaj de István Ertl ISBN: 978-88-87282-44-3 2 Dankon pro ilia helpo al Gerd Bussing Tazio Carlevaro Birgit Höckel Mario Lépine Katrin Mattusch 1 Antaŭvortoj Ŝajnas al mi, ke Heinz Kahlau ne estas granda poeto. Eble “minora” lin nomus literaturhistorio. Kaj ĝuste per tio li ĉarmas: li ne kaŝas sin post arbaro da simboloj kaj lingvaj eksperimentoj; li ne hontas verki poemon kun titolo kiel “Konsolo” aŭ eĉ “Mi amas vin”. Tradukanton li devigas al akrobataĵoj ne mortdanĝeraj. Sed jen la ezoka hoko: mi fakte pekis kontraŭ la regulo Varengjena, Dediega kaj de ĉiuj sobruloj ̶ mi cedis al la tento esperantigi el lingvo nepropra. Tial ĉiu misinterpreto kaj fuŝo refalu sur mian kapon – eventualaj beloj dankeblas parte al konsildonintoj. Mi krome konfesu, ke pri Heinz Kahlau mi scias nur pli-malpli: li estas poeto germana (GDR) naskita en 1931, kies du poemoj ornamas la murojn de metrostacio Alexanderplatz en Berlino. Tie konatiĝis tradukonto kun tradukoto, dum la tempo de metroatendo. La sorĉo de tiu nerezistebla momento estu la senkulpigo de la ĉi-sekva elekto, bazita plejparte sur la volumoj “Lob des Sisyphus”, Leipzig, 1980, kaj “Querholz”, Berlin-Weimar, 1989. -

Behind the Berlin Wall.Pdf
BEHIND THE BERLIN WALL This page intentionally left blank Behind the Berlin Wall East Germany and the Frontiers of Power PATRICK MAJOR 1 1 Great Clarendon Street, Oxford Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York Patrick Major 2010 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2010 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Major, Patrick. -

Sie Lebt Für Ihre Arbeit. Die Schöne Arbeit. Gehen Sie an Die Arbeit. Die
Repositorium für die Medienwissenschaft Peggy Mädler; Bianca Schemel Sie lebt für ihre Arbeit. Die schöne Arbeit. Gehen sie an die Arbeit. Die Inszenierung von Arbeit und Geschlecht in Dramatik und Spielfilm der DDR 2009 https://doi.org/10.25969/mediarep/4160 Veröffentlichungsversion / published version Hochschulschrift / academic publication Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Mädler, Peggy; Schemel, Bianca: Sie lebt für ihre Arbeit. Die schöne Arbeit. Gehen sie an die Arbeit. Die Inszenierung von Arbeit und Geschlecht in Dramatik und Spielfilm der DDR. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin 2009. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/4160. Erstmalig hier erschienen / Initial publication here: https://doi.org/10.18452/16290 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 3.0/ Attribution - Non Commercial - No Derivatives 3.0/ License. For Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu dieser Lizenz more information see: finden Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ SIE LEBT FÜR IHRE ARBEIT. DIE SCHÖNE ARBEIT. GEHEN SIE AN DIE ARBEIT. DIE INSZENIERUNG VON ARBEIT UND GESCHLECHT IN DRAMATIK UND SPIELFILM DER DDR Peggy Mädler Bianca Schemel SIE LEBT FÜR IHRE ARBEIT. DIE SCHÖNE ARBEIT. GEHEN SIE AN DIE ARBEIT. Die Inszenierung von Arbeit und Geschlecht in Dramatik und Spielfilm der DDR Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor philosophiae (Dr. phil.) eingereicht an: der Philosophischen Fakultät III der Humboldt-Universität zu Berlin von Peggy Mädler, Bianca Schemel Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin: Prof. -

Latin American Songs in the GDR and the East German Singer-Songwriter Repertoire (1970–2000): Gerhard Schöne’S ‘Meine Geschwister’ in the Light of Translation Studies
Twentieth-Century Music 17/3, 401–417 © The Author(s), 2020. Published by Cambridge University Press. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is unaltered and is properly cited. The written permission of Cambridge University Press must be obtained for commercial re-use or in order to create a derivative work. doi: 10.1017/S1478572220000195 Latin American Songs in the GDR and the East German Singer-Songwriter Repertoire (1970–2000): Gerhard Schöne’s ‘Meine Geschwister’ in the Light of Translation Studies CHRISTINA RICHTER-IBÁÑEZ Abstract Latin American folkloric-popular music had an impact on the music scenes of both Germanies, where singer-songwriters emerged and became interested in Chilean Nueva Canción, the Argentinian Movimiento del Nuevo Cancionero, and Cuban Nueva Trova in the 1970s. Particularly interesting in this context is the contact of some Latin American countries with the German Democratic Republic (GDR). Based on translation theory and articles on Nueva Canción in Europe, this article examines the Latin American presence at the Political Song Festival in East Berlin and analyses some publications that focus on this annual event. The article focuses on the singer-songwriter Gerhard Schöne, who during the 1980s, took Nicaragua as a political example, as is shown in songs, and who also composed German lyrics to melodies by Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, and Silvio Rodríguez, transferring the songs into a new context. -

Cultural/Literary Translators Selected Irish-German Biographies II = Irish-German Studies / Deutsch-Irische Studien, Vol
Cultural/Literary Translators Selected Irish-German Biographies II Sabine Egger (ed.) IRISH-GERMAN STUDIES DEUTSCH-IRISCHE STUDIEN LÉANN NA GEARMÁINE AGUS NA hÉIREANN 9 Series Editors Joachim Fischer and Gisela Holfter, Centre for Irish-German Studies, University of Limerick Advisory Board Gareth Cox, Dept. of Music, Mary Immaculate College, University of Limerick; Jürgen Elvert, Historisches Seminar, Universität Köln; Ruth Frehner, James Joyce Stiftung, Zürich; Werner Huber, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Wien; Ullrich Kockel, School of Management & Languages, Heriot- Watt University Edinburgh; Heinz Kosok, Wuppertal; Pól Ó Dochartaigh, National University of Ireland, Galway; Patrick O’Neill, Dept. of German, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada; Emer O’Sullivan, Institute of English Studies, Leuphana Universität Lüneburg; Eda Sagarra, Trinity College Dublin; Manfred Schewe, Dept. of German, University College Cork; Arndt Wigger, Allgemeine Sprachwissenschaft, Bergische Universität Wuppertal IRISH-GERMAN STUDIES DEUTSCH-IRISCHE STUDIEN LÉANN NA GEARMÁINE AGUS NA hÉIREANN Cultural/Literary Translators Selected Irish-German Biographies II Editor/Herausgeber/Eagarthóir Sabine Egger Wissenschaftlicher Verlag Trier Cultural/Literary Translators Selected Irish-German Biographies II = Irish-German Studies / Deutsch-irische Studien, vol. 9 Sabine Egger (ed.) University of Limerick, Centre for Irish-German Studies, Limerick Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2015 ISSN 1393-8061 ISBN 978-3-86821-582-3 This book has been published with the support of the Embassy of the Federal Republic of Germany, Dublin. Cover design: Brigitta Disseldorf © WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2015 ISBN 978-3-86821-582-3 All rights reserved. No part of publication may be reproduced or electronically circulated without the prior permission in writing of the author(s) or editor(s). -

University of Bath PHD Nature and Technology in GDR Literature
University of Bath PHD Nature and technology in GDR literature Tomlinson, Dennis Churchill Award date: 1993 Awarding institution: University of Bath Link to publication General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 23. May. 2019 NATURE AND TECHNOLOGY IN GDR LITERATURE NATURE AND TECHNOLOGY IN GDR LITERATURE submitted by Dennis Churchill Tomlinson for the degree of PhD of the University of Bath 1993 COPYRIGHT Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis rests with its author. This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with its author and that no quotation from the thesis and no information derived from it may be published without the prior written consent of the author. This thesis may be made avilable for consultation within the University Library and may be photocopied or lent to other libraries for the purposes of consultation. -

Die Moderne Großstadt in Ausgewählten Werken Die
Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses 1979 Die moderne Großstadt in ausgewahlten̈ Werken deutscher Lyriker Hildegard Goranson Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds Part of the German Literature Commons, and the Poetry Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Goranson, Hildegard, "Die moderne Großstadt in ausgewahlten̈ Werken deutscher Lyriker" (1979). Dissertations and Theses. Paper 2891. https://doi.org/10.15760/etd.2883 This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Hildegard Goranson for the Master of· Arts in German presented July 27, 1979 •. Ti tle·a Die moderne· GroBstadt in ausgewahl ten Werken deutscher Lyriker.,. APPROVED BY MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE& Louis J.Elte H. FredereiteterS It is the purpose of this thesis to discuss the works of German poets who describe the large modern city.· and deal with various aspects of city life and city people. Over the past centuries German poets have written about subjects such as nature., love •. heroism· and many others, but only in the last hundred years does the oi ty.. appear as an independent, new theme in German. lyric •. The thesis briefly reviews the development of Germa~ cities since the early Middle Ages showing their steady 2 growth in area and population that eventually results in the metropolis of our time. -

Edinburgh Research Explorer
Edinburgh Research Explorer Music for international solidarity Citation for published version: Kelly, E 2019, 'Music for international solidarity: Performances of race and otherness in the German Democratic Republic', twentieth-century music, vol. 16, no. 1, pp. 123-139. https://doi.org/10.1017/S1478572219000124 Digital Object Identifier (DOI): 10.1017/S1478572219000124 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: twentieth-century music Publisher Rights Statement: This is the accepted manuscript of an article published in a revised form in Twentieth Century Music, https://doi.org/10.1017/S1478572219000124. This version is free to view and download for private research and study only. Not for re-distribution, re-sale or use in derivative works. © Cambridge University Press 2019 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 29. Sep. 2021 Music for International Solidarity: Performances of Race and Otherness in the German Democratic Republic Prologue: 27 August 2018 In the headlines this morning: ‘Attacks on Migrants: Horror in Chemnitz’.1 A fatal stabbing, for which two men – one Syrian and one Iraqi – have been arrested, has sparked xenophobic riots. -
The Wolf Biermann Story
University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 1980 There is a life before death: The Wolf Biermann story John Shreve The University of Montana Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/etd Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Shreve, John, "There is a life before death: The Wolf Biermann story" (1980). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 5262. https://scholarworks.umt.edu/etd/5262 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. COPYRIGHT ACT OF 1976 Th is is an unpublished m a n u s c r ip t in w h ic h c o p y r ig h t sub s i s t s . Any further r e p r in t in g of it s contents must be approved BY THE AUTHOR. Ma n s f ie l d L ib r a r y Un iv e r s it y o f-M ontana D ate: 198 0 THERE IS A LIFE BEFORE DEATH THE WOLF BIERMANN STORY by John Shreve B.A., University of Montana, 1976 Presented 1n p a rtial fu lfillm e n t of the requirements fo r the degree of Master of Arts UNIVERSITY OF MONTANA 1980 Approved by: & Chairman, Board of Examiners Deari% Graduate Scho6T S'-U- S'o Date UMI Number: EP40726 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted.