Tage Der Britischen Musik Bamberg 2015 – 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sir Arthur Bliss (1891-1975) Céleste Series Piano Music Vol.2 MARK BEBBINGTON Piano Riptych
SOMMCD 0148 DDD Sir Arthur Bliss (1891-1975) Céleste Series Piano Music Vol.2 MArK BEBBiNGtON piano riptych t Masks (1924) · 1 A Comedy Mask 1:21 bl Das alte Jahr vergangen ist (1932) 2:57 2 A Romantic Mask 3:50 (The old year has ended) Première Recording 3 A Sinister Mask 2:22 bm The Rout Trot (1927) 2:42 4 A Military Mask 2:53 Triptych (1970) Two Interludes (1925) .1912) bn Meditation: Andante tranquillo 7:08 5 c No. 1 4:09 bo ( Dramatic Recitative: 6 nterludes No. 2 3:23 Grave – poco a poco molto animato 5:48 i bp Suite for Piano (c.1912) Capriccio: allegro 5:09 Première Recording bq wo 7 ‛Bliss’ (One-Step) (1923) 3:15 Prelude 5:47 t The 8 Ballade 7:48 Total Duration: 62:11 · 9 Scherzo 3:32 Complete Piano Music of Recorded at Symphony Hall, Birmingham, 3rd & 4th January 2011 Sir Arthur Bliss Steinway Concert Grand Model 'D' Masks Suite for Piano Recording Producer: Siva Oke Recording Engineer: Paul Arden-Taylor Vol.2 Front Cover photograph of Mark Bebbington: © Rama Knight Design & Layout: Andrew Giles © & 2015 SOMM RECORDINGS · THAMES DITTON · SURREY · ENGLAND MArK BEBBiNGtON piano Made in the EU THE SOLO PIANO MUSIC OF SIR ARTHUR BLISS Vol. 2 Anyone coming new to Bliss’s piano music via these publications might be forgiven for For anyone who has investigated the piano music of Arthur Bliss, the most puzzling thinking that the composer’s contribution to the repertoire was of little significance, aspect is surely that, as a body of work, it remains so little known. -

Sir Andrew Davis the Grainger Collection / Topfoto / Arenapal
elgar FALSTAFF orchestral songs ‘grania and diarmid’ incidental music and funeral march roderick williams baritone sir andrew davis Sir Edward c. 1910 Elgar, The Grainger Collection / TopFoto / ArenaPAL Sir Edward Elgar (1857 – 1934) Falstaff, Op. 68 (1913) 35:57 Symphonic Study in C minor • in c-Moll • en ut mineur for Full Orchestra Dedicated to Sir Landon Ronald 1 I Falstaff and Prince Henry. Allegro – Con anima – Animato – Allegro molto – Più animato – 3:09 2 II Eastcheap. Allegro molto – Molto grandioso e largamente – Tempo I – Poco più tranquillo – 2:54 3 Gadshill. A Tempo I – The Boar’s Head. Revelry and sleep. Allegro molto – Con anima – Più lento – Giusto, con fuoco – Poco tranquillo – Allegro molto – Poco più lento – Allegro – Poco a poco più lento – 9:21 4 Molto tranquillo – Molto più lento – 1:14 5 Dream Interlude. Poco allegretto – 2:36 6 III Falstaff’s march. Allegro – Con anima – Poco meno mosso – Animato – A tempo [Poco meno mosso] – 2:58 7 The return through Gloucestershire. [ ] – Poco sostenuto – Poco a poco più lento – 1:27 8 Interlude. Gloucestershire, Shallow’s orchard. Allegretto – 1:34 3 9 The new king. Allegro molto – The hurried ride to London. [ ] – 1:06 10 IV King Henry V’s Progress. Più moderato – Giusto – Poco più allegro – Animato – Grandioso – Animato – 3:29 11 The repudiation of Falstaff, and his death. [ ] – Poco più lento – Poco più lento – Più lento – Poco animato – Poco più mosso – A tempo giusto al fine 6:00 Songs, Op. 59 (1909 – 10)* 6:31 12 3 Oh, soft was the song. Allegro molto 1:52 13 5 Was it some golden star? Allegretto – Meno mosso – Più mosso – Meno mosso – Tempo I 2:10 14 6 Twilight. -

The Hills of Dreamland
SIR EDWARD ELGAR (1857-1934) The Hills of Dreamland SOMMCD 271-2 The Hills of Dreamland Orchestral Songs The Society Complete incidental music to Grania and Diarmid Kathryn Rudge mezzo-soprano† • Henk Neven baritone* ELGAR BBC Concert Orchestra, Barry Wordsworth conductor ORCHESTRAL SONGS CD 1 Orchestral Songs 8 Pleading, Op.48 (1908)† 4:02 Song Cycle, Op.59 (1909) Complete incidental music to 9 Follow the Colours: Marching Song for Soldiers 6:38 1 Oh, soft was the song (No.3) 2:00 *♮ * (1908; rev. for orch. 1914) GRANIA AND DIARMID 2 Was it some golden star? (No.5) 2:44 * bl 3 Twilight (No.6)* 2:50 The King’s Way (1909)† 4:28 4 The Wind at Dawn (1888; orch.1912)† 3:43 Incidental Music to Grania and Diarmid (1901) 5 The Pipes of Pan (1900; orch.1901)* 3:46 bm Incidental Music 3:38 Two Songs, Op. 60 (1909/10; orch. 1912) bn Funeral March 7:13 6 The Torch (No.1)† 3:16 bo Song: There are seven that pull the thread† 3:33 7 The River (No.2)† 5:24 Total duration: 53:30 CD 2 Elgar Society Bonus CD Nathalie de Montmollin soprano, Barry Collett piano Kathryn Rudge • Henk Neven 1 Like to the Damask Rose 3:47 5 Muleteer’s Serenade♮ 2:18 9 The River 4:22 2 The Shepherd’s Song 3:08 6 As I laye a-thynkynge 6:57 bl In the Dawn 3:11 3 Dry those fair, those crystal eyes 2:04 7 Queen Mary’s Song 3:31 bm Speak, music 2:52 BBC Concert Orchestra 4 8 The Mill Wheel: Winter♮ 2:27 The Torch 2:18 Total duration: 37:00 Barry Wordsworth ♮First recordings CD 1: Recorded at Watford Colosseum on March 21-23, 2017 Producer: Neil Varley Engineer: Marvin Ware TURNER CD 2: Recorded at Turner Sims, Southampton on November 27, 2016 plus Elgar Society Bonus CD 11 SONGS WITH PIANO SIMS Southampton Producer: Siva Oke Engineer: Paul Arden-Taylor Booklet Editor: Michael Quinn Front cover: A View of Langdale Pikes, F. -

≥ Elgar Sea Pictures Polonia Pomp and Circumstance Marches 1–5 Sir Mark Elder Alice Coote Sir Edward Elgar (1857–1934) Sea Pictures, Op.37 1
≥ ELGAR SEA PICTURES POLONIA POMP AND CIRCUMSTANCE MARCHES 1–5 SIR MARK ELDER ALICE COOTE SIR EDWARD ELGAR (1857–1934) SEA PICTURES, OP.37 1. Sea Slumber-Song (Roden Noel) .......................................................... 5.15 2. In Haven (C. Alice Elgar) ........................................................................... 1.42 3. Sabbath Morning at Sea (Mrs Browning) ........................................ 5.47 4. Where Corals Lie (Dr Richard Garnett) ............................................. 3.57 5. The Swimmer (Adam Lindsay Gordon) .............................................5.52 ALICE COOTE MEZZO SOPRANO 6. POLONIA, OP.76 ......................................................................................13.16 POMP AND CIRCUMSTANCE MARCHES, OP.39 7. No.1 in D major .............................................................................................. 6.14 8. No.2 in A minor .............................................................................................. 5.14 9. No.3 in C minor ..............................................................................................5.49 10. No.4 in G major ..............................................................................................4.52 11. No.5 in C major .............................................................................................. 6.15 TOTAL TIMING .....................................................................................................64.58 ≥ MUSIC DIRECTOR SIR MARK ELDER CBE LEADER LYN FLETCHER WWW.HALLE.CO.UK -

52183 FRMS Cover 142 17/08/2012 09:25 Page 1
4884 cover_52183 FRMS cover 142 17/08/2012 09:25 Page 1 Autumn 2012 No. 157 £1.75 Bulletin 4884 cover_52183 FRMS cover 142 17/08/2012 09:21 Page 2 NEW RELEASES THE ROMANTIC VIOLIN STEPHEN HOUGH’S CONCERTO – 13 French Album Robert Schumann A master pianist demonstrates his Hyperion’s Romantic Violin Concerto series manifold talents in this delicious continues its examination of the hidden gems selection of French music. Works by of the nineteenth century. Schumann’s late works Poulenc, Fauré, Debussy and Ravel rub for violin and orchestra had a difficult genesis shoulders with lesser-known gems by but are shown as entirely worthy of repertoire their contemporaries. status in these magnificent performances by STEPHEN HOUGH piano Anthony Marwood. ANTHONY MARWOOD violin CDA67890 BBC SCOTTISH SYMPHONY ORCHESTRA CDA67847 DOUGLAS BOYD conductor MUSIC & POETRY FROM THIRTEENTH-CENTURY FRANCE Conductus – 1 LOUIS SPOHR & GEORGE ONSLOW Expressive and beautiful thirteenth-century vocal music which represents the first Piano Sonatas experiments towards polyphony, performed according to the latest research by acknowledged This recording contains all the major works for masters of the repertoire. the piano by two composers who were born within JOHN POTTER tenor months of each other and celebrated in their day CHRISTOPHER O’GORMAN tenor but heard very little now. The music is brought to ROGERS COVEY-CRUMP tenor modern ears by Howard Shelley, whose playing is the paradigm of the Classical-Romantic style. HOWARD SHELLEY piano CDA67947 CDA67949 JOHANNES BRAHMS The Complete Songs – 4 OTTORINO RESPIGHI Graham Johnson is both mastermind and Violin Sonatas pianist in this series of Brahms’s complete A popular orchestral composer is seen in a more songs. -

ONYX4206.Pdf
EDWARD ELGAR (1857–1934) Sea Pictures Op.37 The Music Makers Op.69 (words by Alfred O’Shaughnessy) 1 Sea Slumber Song 5.13 (words by Roden Noel) 6 Introduction 3.19 2 In Haven (Capri) 1.52 7 We are the music makers 3.56 (words by Alice Elgar) 8 We, in the ages lying 3.59 3 Sabbath Morning at Sea 5.24 (words by Elizabeth Barrett Browning) 9 A breath of our inspiration 4.18 4 Where Corals Lie 3.43 10 They had no vision amazing 7.41 (words by Richard Garnett) 11 But we, with our dreaming 5 The Swimmer 5.50 and singing 3.27 (words by Adam Lindsay Gordon) 12 For we are afar with the dawning 2.25 Kathryn Rudge mezzo-soprano 13 All hail! we cry to Royal Liverpool Philharmonic the corners 9.11 Orchestra & Choir Vasily Petrenko Pomp & Circumstance 14 March No.1 Op.39/1 5.40 Total timing: 66.07 Artist biographies can be found at onyxclassics.com EDWARD ELGAR Nowadays any listener can make their own analysis as the Second Symphony, Violin Sea Pictures Op.37 · The Music Makers Op.69 Concerto and a brief quotation from The Apostles are subtly used by Elgar to point a few words in the text. Otherwise, the most powerful quotations are from The Dream On 5 October 1899, the first performance of Elgar’s song cycle Sea Pictures took place in of Gerontius, the Enigma Variations and his First Symphony. The orchestral introduction Norwich. With the exception of Elizabeth Barrett Browning, all the poets whose texts Elgar begins in F minor before the ‘Enigma’ theme emphasises, as Elgar explained to Newman, set in the works on this album would be considered obscure -

Solving Elgar's Enigma
Solving Elgar's Enigma Charles Richard Santa and Matthew Santa On June 19, 1899, Elgar's opus 36, Variations on a Theme, was introduced to the public for the first time. It was accompanied by an unusual program note: It is true that I have sketched for their amusement and mine, the idiosyn crasies of fourteen of my friends, not necessarily musicians; but this is a personal matter, and need not have been mentioned publicly. The Varia tions should stand simply as a "piece" of music. The Enigma I will not explain-its "dark saying" must be left unguessed, and I warn you that the connexion between the Variations and the Theme is often of the slightest texture; further, through and over the whole set [of variations 1 another and larger theme "goes" but is not played ... So the principal Theme never appears, even as in some late dramas-e.g., Maeterlinck's "L'Intruse" and "Les sept Princesses" -the chief character is never on the stage. (Burley and Carruthers 1972:119) After this premier Elgar give hints about the piece's "Enigma;' but he never gave the solution outright and took the secret to his grave. Since that time scholars, music lovers, and cryptologists have been trying to solve the Enigma. Because the solution has not been discovered in spite of over 108 years of searching, many people have assumed that it would never be found. In fact, some have speculated that there is no solution, and that the promise of an Enigma was Elgar's rather shrewd way of garnering publicity for the piece. -
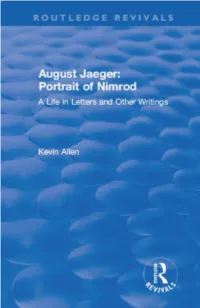
AUGUST JAEGER: PORTRAIT of NIMROD Frontispiece Visiting the Sick
AUGUST JAEGER: PORTRAIT OF NIMROD Frontispiece Visiting the sick. Lady Olga Wood and Professor Sanford take their leave of Jaeger and the children outside 37 Curzon Road, Muswell Hill, c. 1905. August Jaeger: Portrait of Nimrod A Life in Letters and Other Writings KEVIN ALLEN First published 2000 by Ashgate Publishing Reissued 2018 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY 10017, USA Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business Copyright © Kevin Allen, 2000 The author has asserted his moral right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as the author of this work. All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. Notice: Product or corporate names may be trademarks or registered trademarks, and are used only for identification and explanation without intent to infringe. Publisher s Note The publisher has gone to great lengths to ensure the quality of this reprint but points out that some imperfections in the original copies may be apparent. Disclaimer The publisher has made every effort to trace copyright holders and welcomes correspondence from those they have been unable to contact. A Library of Congress record exists under LC control number: 00023684 Typeset in Garamond by The Midlands Book Typesetting Company, Loughborough, Leics. ISBN 13: 978-1-138-73208-7 (hbk) ISBN 13: 978-1-315-18862-1 (ebk) Contents list of Plates vii Foreword by Percy M. -

Edward Elgar: Enigma Variations What Secret? Perusal Script Not for Performance Use Copyright © 2010 Chicago Symphony Orchestra
Edward Elgar: Enigma Variations What Secret? Perusal script Not for performance use Copyright © 2010 Chicago Symphony Orchestra. Duplication and distribution prohibited. In addition to the orchestra and conductor: Five performers Edward Elgar, an Englishman from Worcestershire, 41 years old Actor 2 (female) playing: Caroline Alice Elgar, the composer's wife Carice Elgar, the composer's daughter Dora Penny, a young woman in her early twenties Snobbish older woman Actor 3 (male) playing: William Langland, the mediaeval poet Arthur Troyte Griffith (Ninepin), an architect in Malvern Richard Baxter Townsend, a retired adventurer William Meath Baker, a wealthy landowner George Robertson Sinclair, a cathedral organist August Jaeger (Nimrod), a German music-editor William Baker, son of William Meath Baker Old-fashioned musical journalist Pianist Narrator Page 1 of 21 ME 1 Orchestra, theme, from opening to figure 1 48" VO 1 Embedded Audio 1: distant birdsong NARRATOR The Malvern Hills... A nine-mile ridge of rock in the far west of England standing about a thousand feet above the surrounding countryside... From up here on a clear day you can see far into the distance... on one side... across the patchwork fields of Herefordshire to Wales and the Black Mountains... on another... over the river Severn... Shakespeare's beloved river Avon... and the Vale of Evesham... to the Cotswolds... Page 2 of 21 and... if you're lucky... to the north, you can just make out the ancient city of Worcesteri... and the tall square tower of its cathedral... in the shadow of which... Edward Elgar spent his childhood and his youth.. -

January – February 2018 Concert Diary
JAN/ FEB 2017/18 SEASON www.wigmore-hall.org.uk How to Book Wigmore Hall Box Office TICKETS 36 Wigmore Street, London W1U 2BP Unless otherwise stated, tickets are divided into five prices ranges: In Person Stalls C – M Highest price 7 days a week: 10am – 8.30pm. Stalls A – B, N – P 2nd highest price Days without an evening concert 10am – 5pm. Balcony A – D 2nd highest price No advance booking in the half hour prior to Stalls BB, CC, Q – S 3rd highest price a concert. Stalls AA, T – V 4th highest price Stalls W – X Lowest price By Telephone: 020 7935 2141 7 days a week: 10.00am–7.00pm. AA AA Days without an evening concert: AA STAGE AA AA AA 10.00am–5.00pm. BB BB There is a non-refundable £3.00 administration CC CC A A charge for each transaction. B B C C D D Online: www.wigmore-hall.org.uk E E F FRONT FRONT F STALLS STALLS 7 days a week; 24 hours a day. G G There is a non-refundable £2.00 administration H H I I charge. J J K K L L Standby Tickets M M N N Standby tickets for students, senior citizens and O O P P the unemployed are available from one hour Q Q before the performance (subject to availability) R R S S with best available seats sold at the lowest price. REAR REAR T STALLS STALLS T U U NB standby tickets are not available for V V Lunchtime and Coffee Concerts. -

Sea Pictures Falstaff
ELGAR BARENBOIM SEA PICTURES- ELINA GARANČA FALSTAFF STAATSKAPELLE BERLIN EDWARD ELGAR 1857–1934 Sea Pictures Op.37 Falstaff Op.68 Song cycle for mezzo-soprano and orchestra Symphonic study for orchestra 1 I. Sea Slumber Song 4.41 (after Henry IV and Henry V by William Shakespeare) 2 II. In Haven (Capri) 1.45 6 I. Falstaff and Prince Henry 3.09 3 III. Sabbath Morning at Sea 6.11 7 II. Eastcheap – 2.52 4 IV. Where Corals Lie 3.58 8 Gadshill – The Boar’s Head – 8.56 5 V. The Swimmer 7.06 9 Revelry and Sleep 1.27 10 Dream Interlude: “Jack Falstaff, now Sir John, a boy, and page, to Thomas Mowbray, Duke of Norfolk” 2.32 11 III. Falstaff’s March – 2.49 12 The Return through Gloucestershire 1.27 13 Interlude: Gloucestershire, Shallow’s Orchard 1.49 14 The New King – The Hurried Ride to London 1.03 15 IV. King Henry V’s Progress – 3.21 16 The Repudiation of Falstaff, and his Death 5.48 58.58 Live recordings ELĪNA GARANČA mezzo-soprano (1–5) STAATSKAPELLE BERLIN 2 DANIEL BARENBOIM ea Pictures was written in the summer of 1899, in the weeks One reason for its failure (as the composer’s biographer after the successful premiere of the Enigma Variations had Michael Kennedy pointed out) was the extreme diffi culty of the broughtS Elgar to national prominence. It had been commissioned instrumental writing, unsuited to “the orchestral conditions of for the Norfolk and Norwich triennial festival that October, at those days when very few rehearsals were possible”. -

The Dream of Gerontius. a Musical Analysis
The Dream of Gerontius. A Musical Analysis A Musical Tour of the Work conducted by Frank Beck One of Elgar's favourite walks while writing Gerontius was from his cottage, Birchwood Lodge, down this lane to the village of Knightwick. 'The trees are singing my music,' Elgar wrote. "Or have I sung theirs?" (Photograph by Ann Vernau) "The poem has been soaking in my mind for at least eight years," Elgar told a newspaper reporter during the summer of 1900, just weeks before the première ofThe Dream of Gerontius in Birmingham. Those eight years were crucial to Elgar's development as a composer. From 1892 to 1900 he wrote six large-scale works for voices, beginning with The Black Knight in 1892 and including King Olaf in 1896, Caractacus in 1898 and Sea Pictures in 1899. He also conducted the premières of each one, gaining valuable experience in the practical side of vocal music. Most importantly, perhaps, he gained confidence, particularly after the great success of the Enigma Variations in 1899 made him a national figure. At forty-two, Elgar had waited long for recognition, and he now felt able to take on a subject that offered an imaginative scope far beyond anything he had done before: Cardinal Newman's famous poem of spiritual discovery. Elgar set slightly less than half of the poem, cutting whole sections and shortening others to focus on its central narrative: the story of a man's death and his soul's journey into the next world. Part 1 Gerontius is written for tenor, mezzo-soprano, bass, chorus and orchestra.