Hugo Weczerka Final 19092017.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Read the Full Article This Article Is Available for Download
Henri Pirenne and Karl La pre!"#$% Kulturgeschichte In#ellec#&al #ran%'er (r théorie fumeuse) G*N*+I,+*-./RL/N01 1111111111111111111111111/%%i%#an#e en p"il(%(p"ie 2 3a!&l#4% &ni5ersi#aire% 6ain#-L(&i% Karl La pre!"# 71856-1915) and Henri Pirenne 71862-1935) are re<arded a% #=( (' #he 'ine%# "i%#orian% in Ger an and Bel<ian hi%#ori(<raphy a# #he #urn (' #he 20t" !ent&r>. La pre!"# =a% a pr('e%%or a# #he ?ni5er%i#> (' Leipzi< 71891-1915), =hile Pirenne held #"e %a e po%# a# #"e ?ni5er%i#> (' Ghent 71889-1930). The> =orAed #( expand hi%#(ri!al re%ear!" in#( #"e %#udy (' e!onomi! and %(!ial i%%ue%. The> not onl> &%ed ne= #>pe% (' ar!"i5e% C&# al%o e pl(>ed ne= e#hods (' %#a#i%#i!al anal>%i%. / 'e= ill&%#ra#ions (' #"eir inn(5a#i5e %piri# are La pre!"#$% C((A, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter2, and Pirenne$% ar#i!le%, Les dénombrements de la population d'Ypres au XVe siècle (141!"1506)' (ontribution ) la statistique sociale du Moyen Age3 and Les documents d'archi.es comme sources de la démographie historique/4-- B(#" hi%#(rian% are al%( An(=n 'or #heir li'e-=orA%D La pre!"#$% Deutsche 0eschichte 715 5ol& e%, 1891-1909;5 and Pirenne$% 1istoire de 2elgique 77 5ol., 1900-1932).9 T"e%e #=( be%#%eller%7 are a%#erpie!e% (' liberal na#ional hi%#ori(<raph>. /l#"(&<" #he> are di''erent in (&#l((A, C(#" are ba%ed &pon 1. Corre%p(nden!e !(n!ernin< #"i% arti!le %"(&ld Ce addre%%ed #( Gene5iE5e .arlandD =arlandF'&%l.a!.Ce 2. -

Philip Grierson Among Belgian Historians and Numismatists
Peter SPUFFORD PHILIP GRIERSON AMONG BELGIAN HISTORIANS AND NUMISMATISTS hilip grierson was born on 15 november 1910 and spent his early years in the countryside of southern Ireland, then part of the United P Kingdom, where his father, previously a government land-surveyor, was running a small farm. His rural childhood came to an end when his father, a trained accountant, moved to Dublin and embarked on a business career. Philip later regretted that so much of his life had been exclusively urban. Aer mediocre local schools in Ireland he was sent to Marlborough, a prestigious boarding school in southern England, and from there took the entrance examination to the University of Cambridge and secured a place at Gonville and Caius College, which was to be his home for the rest of his long life. He was a devout young man, brought up in a somewhat rigid protestant tradition of churchmanship, and regularly read the lessons in his home church, but at some point he was to lose his faith. When the young Philip Grierson arrived in Cambridge from Dublin in 1929 the work of compiling the Cambridge Medieval History was still in ﬔll swing. e final three volumes were to come out in 1929, 1932 and 1936, under the editorship of Charles Previté-Orton and Zachary Brooke, who were to hold the chair of Medieval History in turn, and were to be his men- tors in Cambidge, along with Michael Oakeshott and George Coulton. It was to be this vast multi-national compilation which provided the background to Philip Grierson’s encyclopaedic knowledge of the political history of medieval Europe. -
Patterns of Episcopal Power Bishops in Tenth and Eleventh Century Western Europe
Sonderdruck aus: Patterns of Episcopal Power Bishops in Tenth and Eleventh Century Western Europe Strukturen bischöflicher Herrschaftsgewalt im westlichen Europa des 10. und 11. Jahrhunderts Herausgegeben von / edited by Ludger Körntgen und Dominik Waßenhoven De Gruyter 2011 ISBN 978-3-11-026202-5 e-ISBN 978-3-11-026203-2 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: Strukturen bischöflicher Herrschaftsgewalt im westlichen Europa des 10. und 11. Jahrhun- derts = Patterns of Episcopal power. p. cm. -- (Prinz-Albert-Forschungen ; Bd. 6 = Prince Albert research publications ; v.6) German and English. Edited by Ludger Körntgen and Dominik Wassenhoven. Proceedings of a workshop held in Apr. 2009 at the University of Bayreuth and of a session of the International Medieval Congress held in July 2009 in Leeds, England. Includes bibliographical references. ISBN 978-3-11-026202-5 1. Episcopacy--History--Congresses. 2. Church and state--Europe--History--Congresses. 3. Church history--Middle Ages, 600-1500--Congresses. I. Körntgen, Ludger. II. Wassen- hoven, Dominik. III. International Medieval Congress (2009 : Leeds, England) BV670.3.S77 2011 262‘.1209409021--dc23 2011024265 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2011 Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/Boston Satz: Dominik Waßenhoven Druck: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen ∞ Gedruckt auf säurefreiem Papier Printed in Germany www.degruyter.com ªPatterns of Episcopal Powerº (PAF 6) Ð 12. 7. 2011 16:22 Ð Seite 7 Contents AbkuÈrzungsverzeichnis/List of Abbreviations . 9 Ludger KoÈrntgen Introduction . 11 Timothy Reuter A Europe of Bishops. -
Institutions of Hanseatic Trade
Stephan Selzer / Ulf Christian Ewert / Stephan Selzer Ulf Christian Ewert / Stephan Selzer Institutions of Hanseatic Trade The merchants of the medieval Hanse The Authors Institutions of monopolised trade in the Baltic and Ulf Christian Ewert is Research Associate North Sea areas. The authors describe the at the Cluster of Excellence ‘Religion and structure of this trade system in terms of Politics’ and lecturer in economic history Hanseatic Trade network organisation and explain, on the at the University of Münster. He has grounds of institutional economics, the taught medieval and economic history Ulf Christian Ewert coordination of the merchants’ com- at Chemnitz University of Technology, mercial exchange by reputation, trust Helmut-Schmidt-University Hamburg, Studies on the Political Economy of a and culture. The institutional economics Free University of Berlin and the univer- Medieval Network Organisation approach also allows for a comprehen- sities of Munich, Halle and Regensburg. sive analysis of coordination problems He published numerous articles on the arising between merchants, towns and Hanse, the Portuguese overseas expan- the ‘Kontore’. Due to the simplicity and sion, the political economy of pre-modern flexibility of network trade the Hansards princely courts and on early-modern could bridge the huge gap in economic living standards. development between the West and the East. In the changing economic condi- Stephan Selzer is Professor for medieval tions around 1500, however, exactly these history at Helmut-Schmidt-University / characteristics proved to be a serious limit University of the Federal Armed Forces to further retain their trade monopoly. Hamburg. He is the author of numerous publications on the social and economic history of the later Middle Ages as well as specialist literature on the medieval TOWN Hanseatic League and on communication and mobility in the Hanse area. -
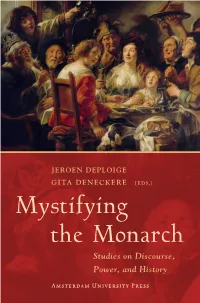
Mystifying the Monarch
omslag Monarch 31-10-2006 11:04 Pagina 1 Mystifying the Monarch The monarchy: no other political institution proved to be so durable and flexible through its age-long history. Despite the modernization, seculari- zation, and bureaucratization of power, the affective, archaic, and almost timeless relationship between sovereigns and their ‘subjects’ still prevails in several countries. Though troubled by the many recent scandals of their royals, many courts continue to perceive that the perennial maxim ‘the King can do no wrong’ has lost none of its strength. Yet the staging and sacralization of the monarchy in Western Europe have always been interwoven with practices of subversion and banalization. The different discourses aiming at the symbolic construction of royal power can not be studied without considering at the same time the popular appropriation of the official rhetoric. Hence, this collection of essays does not propose a strictly linear narrative from medieval sacralization to postmodern demystification of kingship. Choosing the perspective of the long run between the twelfth and the first half of the twentieth century, it clearly shows how the mystification and demystification of the monarch have always been two sides of the same coin. The contributors are Alain Boureau, Gita Deneckere, Jeroen Deploige, Lisa Jane Graham, Maria Grever, Marc Jacobs, Gilles Lecuppre, Elodie DENECKERE GITA JEROEN DEPLOIGE Lecuppre-Desjardin, Jürgen Pieters, Alexander Roose, Kevin Sharpe, Henk te Velde, Maarten Van Ginderachter, and Jaap van Osta. JEROEN DEPLOIGE The editors are Jeroen Deploige (Associate Professor of Medieval Cultural GITA DENECKERE [ EDS.] History, Ghent University) and Gita Deneckere (Associate Professor of Modern History, Ghent University). -

Before They Were Vikings: Scandinavia and the Franks up to the Death of Louis the Pious
Before They Were Vikings: Scandinavia and the Franks up to the death of Louis the Pious By Daniel Melleno A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Geoffrey Koziol, Chair Professor Maureen Miller Professor Maura Nolan Spring 2014 Copyright © 2014 Daniel Melleno All rights reserved Abstract Before They Were Vikings: Scandinavia and the Franks up to the death of Louis the Pious by Daniel Melleno Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Geoffrey Koziol, Chair Using textual and archaeological evidence to examine patterns of interaction and relationship between Francia and Scandinavia from 700-840 this dissertation demonstrates that the Viking attacks of the ninth century were not a sudden rupture of relations between Scandinavia and the wider world, nor a demonstration of unbridled violence. Rather, the attacks were part of an ongoing narrative of commerce, diplomacy, and strife between the Frankish Empire and its northern neighbors which began long before the Viking Age. Coin finds and excavations, accounts of merchants bearing luxury goods between trade sites, and stories of Frankish slaves taken from their homes connect Francia and Scandinavia across the North Sea. Chapter One of this dissertation focuses on these long lasting commercial links. At the heart of this trade lay Frisia, home of the emporium of Dorestad. Dorestad’s location as the cross roads between the North Sea and the heart of the Frankish Empire allowed Frankish, Frisian, and Scandinavian merchants to carry goods back and forth across the North Sea while at the same time facilitating the movement of ideas and cultural exchange. -

Linen, Silver, Slaves, and Coffee: a Spatial Approach to Central Europe’S Entanglements with the Atlantic Economy
Culture & History Digital Journal 4(2) December 2015, e020 eISSN 2253-797X doi: http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2015.020 Linen, Silver, Slaves, and Coffee: A Spatial Approach to Central Europe’s Entanglements with the Atlantic Economy Klaus Weber European University Viadrina Große Scharrnstraße 59,D - 15230 Frankfurt (Oder) e-mail: [email protected] Submitted: 5 September 2014. Accepted: 1 June 2015 ABSTRACT: In German scholarship of the post-war period, the category of space was regarded as discredited, be- cause of its abuse during the Nazi period. This applies in particular to the 1970s and 80s, when novel approaches in social and economic history were developed. Research on proto-industrialisation, broadly examining its internal structures, did not take into account the export orientation of Central Europe’s early modern commodity production. At the same time, the expanding research on Europe’s Atlantic empires, including the trans-Atlantic slave trade, did hardly take notice of the manufactures from the Holy Roman Empire, distributed all around the Atlantic basin. This paper examines those conditions favouring German proto-industries which are relevant for a ‘spatial approach’ to the phenomenon. It also covers the late medieval beginnings of this process, in order to demonstrate the continuity of Central Europe’s entanglement with the Atlantic world. The paper further emphasises that any future research using spatial categories must be aware of the ideological contamination of the German term ‘Raum’ during the 19th and 20th century. The interlace of economic and social history with historiography demands a compilation from current and older research literature, some of it on different regions and subjects. -

The Lubeck Uprising of 1408 and the Decline of the Hanseatic League Author(S): Rhiman A
The Lubeck Uprising of 1408 and the Decline of the Hanseatic League Author(s): Rhiman A. Rotz Reviewed work(s): Source: Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 121, No. 1 (Feb. 15, 1977), pp. 1-45 Published by: American Philosophical Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/986565 . Accessed: 02/03/2012 23:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. American Philosophical Society is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Proceedings of the American Philosophical Society. http://www.jstor.org THE LUBECK UPRISING OF 1408 AND THE DECLINE OF THE HANSEATIC LEAGUE* RHIMAN A. ROTZ Associate Professorof History, Indiana University Northwest THE URBAN uprisings of the fourteenth and at or near the height of her wealth and power fifteenth centuries in Western Europe remain a around 1400. She was also no stranger to urban vexing interpretive problem despite a wealth of unrest, having felt minor disturbances, apparently individual studies and occasional efforts to syn- stemming almost wholly from lesser artisans such thesize them. Debate still turns on even the most as butchers and bakers, in 1376, 1380, and 1384.3 basic questions, such as the nature of the groups The events of 1408, however, far outstripped this which took part in them, their causes, and whether previous experience: some two-thirds of the town or not they are part of the "crisis" which, increas- council went into exile, and the citizens established ingly, is seen to pervade many aspects of four- a wholly new constitution providing for artisan teenth- and fifteenth-century life. -

Marketing the Hanse Experience
Marketing the Hanse experience Hanseatic cultural heritage in the marketing of German towns Master thesis Economic Geography Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen Student: Pieter-Jan Schut Student nr.: 4167015 Supervisor: Prof. Dr. Gert-Jan Hospers 0 1 Table of contents Acknowledgements 4 Abstract 5 1. Introduction 8 1.1 Marketing the Hanzesteden on the IJssel 8 1.2 Positioning and potential of the Hanzesteden brand 9 1.3 Project framework 13 1.4 Scientific and societal relevance 14 1.5 Research objectives 14 1.6 Research Questions 15 2. Methodology 16 2.1 Qualitative inquiry 16 2.2 Choice of cases 17 2.3 Research strategy and process 19 3. Theory 20 3.1 Cultural heritage as a tourism commodity 20 3.2 Hanse heritage and authenticity 22 3.3 Placemarketing 23 3.4 Place branding and cultural heritage 25 4. The Hanseatic League: then and now 28 4.1 The Hanse: 1200 - 1700 28 4.2 Historical perspectives on the Hanse 31 4.3 The Hanse in Germany and The Netherlands 35 4.4 The legacy of the Hanse in modern day Europe 40 5. Marketing Wesel 43 5.1 Introduction 43 5.2 Target audiences 46 5.3 Hanse heritage in Wesel’s place brand 47 5.3.1 The rebuilding of the Rathaus facade 48 5.3.2 Renewed Pedestrian Area 50 5.3.3 City partnerships 52 6. Marketing Soest 54 6.1 Introduction 54 2 6.2 Target audiences 55 6.3 Green sandstone and Allerheiligenkirmes 55 6.4 Hanse heritage in Soest’s place brand 56 7. -

Prussian. Ciety and the German Aristocratic
T H 6 (réRM AN ORDER A n10> PRUSS/Ats/ 5oC(£T'f : A N 0 6 L ^ CoRPoRATlOÏ^ IN CRlSlS^ 1^+IO-lU.ki) PRUSSIAN. CIETY AND THE GERMAN ARISTOCRATIC CORPORATION IN CRISIS c.^410-1466 Thesis presented for the Degree of PhD of the Universitv of London by MICHAEL CHRISTOPHER BENNET BURLEIGH Bedford College, University of London May 198 2 ProQuest Number: 10098432 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10098432 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ABSTRACT This thesis attempts to use the exceptionally rich archives of the German Order to reveal something of the actuality of life in an aristocratic ecclesiastical corporation in society and under stress between c. 1410 and 1466. It differs from previous histories of the Order in that it attempts to combine analysis of long term social change with a narrative of political events. The first chapter attempts to characterise German peasant society on the Marienburger Werder in the fourteenth and fifteenth centuries. It seeks to give precision to social and economic relationships and argues that peasant communal organisation and powers of resis tance to seigneurial coercion were not retarded in medieval Prussia. -

The Hanse in Medieval and Early Modern Europe: an Introduction
THE HANSE IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN EUROPE: AN INTRODUCTION Justyna Wubs-Mrozewicz The Hanse Game Just for fun, let’s imagine that the scholars who contributed to this volume did not meet at an international congress. Instead, they gathered to play a board game called ‘The Hanse: 500 years in the Baltic and North Sea’. They enjoyed a bite of bread with herring and a good glass of beer, distributed pawns, joked about winning and cooked up crafty strategies. Yet, scholars being scholars, they first squabbled about the rules of the game: Carsten: ‘Why is Lübeck in the middle of the board? Come on, guys, there’s gotta be a better starting point for the Game! After all, Lübeck wasn’t the centre of the Hanseatic world from the word go. Also, nobody could count on selling his goods there, so “Go directly to Lübeck, collect 250 marks” is wrong.’ Edda: ‘Wait, before we start: it’s all about trade at sea. But the game doesn’t have any instructions about what happens if something goes wrong, like shipwreck, piracy and stuff like that. Worse yet, the Hanse didn’t have a unified set of rules about this. Each town made up its own. So we’re gonna to have to work through those Jeopardy and Chance cards carefully before we start!’ Sofia: ‘Hey, that’s true for all the other commercial regulations, like sales contracts. Each town had its own bylaws, just look at Scandinavia! And right at the beginning we can chuck that old bit of nonsense about how Lübeck law smoothed out all the differences that mattered. -

"Ceci N'est Pas Un Historien" Construction and Deconstruction of Henri Pirenne
"Ceci n'est pas n hist"#ien" Const# cti"n an$ $ec"nst# cti"n "% Hen#i Pirenne '(LT)R*&R)+)NI)R1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, &#"%ess"# )-e#it s . /ni0e#siteit Gent The %i#st a-bition "% this a#tic2e is t" %ind out 3hic! t4pe "% p#"%essiona2 app#"ac! and 3hic! %"#- "% socia2ising Henri &i#enne 3as suppose$ t" ha0e const#ucte$ in "#$e# t" bec"-e one "% the 5#eatest scientists "% !is 5ene#ation and a success% 2 societ4 -an. 64 second question is8 di$ !e hi-se2%, "# di$ his c"nte-p"#a#ies, const# ct that ic"n? 1. :IR;T TH);I;8 TH) C<N;TR/CTI<N*<: &IR)NN)*(;*(*&R<6IN)NT HI;T<RI(N*(N= (; TH) ':</N=ING*:(TH)R'*<: TH) GH)NT HI;T<RIC(L*;CH<<L I;*(*&)R:)CT )X(6&L)*<:*(*;/CC);;:/L 6>TH<L<GI;(TI<N The (-e#ican hist"#ian G#a4 B"4ce ?1940, 449-464), %#"- Be#Ce2e4, a student "% &i#enne in t!e 1920s, c"nfe##e$ t!e pate#nit4 "% the G!ent sc!""2 inte#nationa2 1#i22iance in !is st $4 on "The Le5ac4 "% Henri &i#enne" %#"- 1940. In %act he c"##"1"#ate$ a %"#-at and an i-a5e that ha$ been const#ucte$ 14 &i#enne's students and c"22ea5ues in t!e "laudationes" on the occasion o% eac!*"% the*!on"#a#4*-eetings, f#"- 1926 on.2*( st#ong s4-pt"- "% the ai- "% de%ining &i#enne as t!ei# ic"nic %athe# is the c"22ecti0e oat! 14 a22 !is a2 -ni at &i#enne's %une#a2 in 1935 t" prepa#e a 'liber alumnorum' an$ t3" s"2i$*0"2 -es*"% 'hommages' and -e-"#ies3, but, e0en -"#e i-portant24, t" #eDect %i#-24 the e$ition "% a si-i2a# 'liber' %"# t!e-se20es in the % t #e, a decision that -ost "% these a2 -ni indee$ #especte$.