PHOBILITY Sondierungsstudie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Universidad Nacional Abierta Y a Distancia Unad
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES PROGRAMA DE PSICOLOGÍA MODULO DEL CURSO DE PSICODIAGNOSTICO DE LA PERSONALIDAD Elaborado Por: Jorge Enrique Bejarano B. 2007 Bogotá Ajustado por: Edgar O. Anaya Herrera 2009 Bucaramanga CURSO DE PSICODIAGNÓSTICO DE LA PERSONALIDAD TABLA DE CONTENIDO Pág. UNIDAD 1: CONCEPTO DE PERSONALIDAD 2 Capítulo 1 - Origen e historia del concepto “persona” y “personalidad” 2 Lección 1 - Evolución de las teorías de la personalidad 7 Lección 2 - Integradoras del Yo – Biosociales 19 Lección 3 - Simbólica 27 Lección 4 - Humanista 28 Lección 5 - Conductista 30 Capítulo 2 - Construcciones personalizadas 34 Lección 6 - Evolutiva 34 Lección 7 - Interpersonal 34 Lección 8 - Definición de Personalidad 37 Lección 9 - La personalidad como sistema complejo 39 Lección 10 - Características del sistema personalidad 40 Capítulo 3 - Retroalimentación y Autoorganización 41 Lección 11 – Indeterminación 42 Lección 12 - Temperamento 43 Lección 13 - Carácter 45 Lección 14 - Estilo de Vida 46 Lección 15 – Voluntad 47 UNIDAD 2: PSICODIAGNOSTICO 50 Capítulo 4 – Concepto de normalidad y anormalidad 50 Lección 16 - Trastornos de la Personalidad 55 Lección 17 - Proceso de Psicodiagnóstico 75 Lección 18 - Aplicación de diferentes pruebas de personalidad 79 Lección 19 - La evaluación proyectiva de la personalidad 82 Lección 20 - Finalización de la Evaluación Psicodiagnóstica 87 Capítulo 5 - Pruebas y Técnicas para la Evaluación y Psicodiagnóstico de la Personalidad 88 Lección 21 - 16 -

Neglected Emotions: an Introduction
Penultimate version. For final version go to: https://academic.oup.com/monist/article- abstract/103/2/135/5771241 Neglected Emotions: An Introduction Andreas Elpidorou Department of Philosophy, University of Louisville [email protected] Abstract Given the importance of emotions in our everyday lives, it is no surprise that in recent decades the study of emotions has received tremendous attention by a number of different disciplines. Yet despite the many and great advantages that have been made in understanding the nature of emotions, there still remains a class of emotional states that are understudied and that demand further elucidation. All contributions to the special issue consider either emotions or aspects of emotions that deserve the label ‘neglected.’ In doing so, they break new theoretical ground and further our understanding of the nature of the emotions that they consider. The aim of the present paper is to introduce the special issue on neglected emotions by articulating the different ways in which emotions can be said to be neglected. 1.Introduction For most of us, emotions permeate our waking life—not just by coloring it with this or that affective shade, but by profoundly shaping it. The presence of emotions is what commits us to the various projects that we choose to make our own and what defines our dealings with the world, others, and ourselves. Emotions can influence cognition, memory, decision making, and perception (e.g., Bradley et al. 1995; Forgas 1995; Niedenthal & Kitayama 1994; Phelps & Anderson 1997; Schwarz & Clore 1996; Zadra & Clore 2011). They prepare us for what is to come and connect us to what has passed. -

Download Innovations in Clinical Practice: a Source
Innovations in clinical practice: a source book, Volume 1, , Pete R. A. Keller, Lawrence G. Ritt, Professional Resource Exchange, Incorporated, 1982, 0943158001, 9780943158006, 454 pages. DOWNLOAD HERE Psychotherapy, theory and research , Orval Hobart Mowrer, 1953, Psychology, 700 pages. Clinical handbook of behavior therapy, Volume 2 , Gerald Tarlow, Anne Maxwell, 1989, Medical, 360 pages. Practical psychotherapy , Myron F. Weiner, 1986, Psychology, 322 pages. The Handbook of clinical psychology: theory, research, and practice, Volume 1 theory, research, and practice, Clarence Eugene Walker, Frederick H. Kanfer, 1983, Psychology, 1439 pages. The healing companion simple and effective ways your presence can help people heal, Jeff Kane, Jun 1, 2000, Family & Relationships, 190 pages. A guide to creating inner peace, balance, and physical health through the skillful and compassionate application of mind-body principles.. Humanistic psychiatry: from oppression to choice , Roy D. Waldman, 1971, Medical, 164 pages. Persuasion and Healing A Comparative Study of Psychotherapy, Jerome D. Frank, Mar 1, 1993, Medical, 343 pages. "Anyone treating patients or engaging in clinical research to develop new drug or psychosocial treatments should take a few hours to absorb, once again, the brilliance of .... An outline of psychotherapy for medical students and practitioners , Harold Maxwell, 1986, Psychology, 107 pages. Theories and strategies in counseling and psychotherapy , Burl E. Gilliland, Richard K. James, Mar 30, 1998, Psychology, 436 pages. Theories and Strategies in Counseling and Psychotherapy emphasizes core theories and current trends in the world of counseling and psychotherapy. This is a book that operates .... Witchdoctors and psychiatrists the common roots of psychotherapy and its future, Edwin Fuller Torrey, Oct 8, 1986, Psychology, 316 pages. -

Introduction Marina Bianchi and Neil De Marchi
Introduction Marina Bianchi and Neil De Marchi Over much of the past half century, sporadic attention has been given to the possible links between economics and psychology, though recently there has been a steady rise in the numbers of both psychologists and economists interested in behavioral economics. From both disciplines have come behavioral challenges to the strong version of rational choice thinking. And, along with them, have come challenges to the challengers to relate their observations to mathematical models, as favored by econo- mists (Camerer 1999), and to explain how people come to make the choices that they do. This recent trend is not part of what we set out to examine, though the one essay in the volume by a laboratory psychologist, John Staddon, offers a methodological reflection on a particular form of behavioral economics, prospect theory. For the rest, the focus is historical, which is to say that we wish first and foremost to identify and shed light on different contexts and episodes involving contact between the two disciplines, and on the ques- tions that either spurred or were raised by such contact. Correspondence may be addressed to Marina Bianchi, Department of Economics and Law, University of Cassino, Via S. Angelo, 03043 Cassino, Italy 03043 (e-mail: marina.bianchi @unicas.it); or to Neil De Marchi, Duke University (e-mail: [email protected]). The edi- tors wish to thank all the participants at the HOPE conference, “Economizing Mind, 1870–2015: When Economics and Psychology Met . or Didn’t,” held at Duke University in April 2015. Special thanks to Jeff Biddle, for his many interventions and thoughtful suggestions throughout that conference. -

OH Mowrer (1907-1982), De La Teoría Del Aprendizaje a Los Grupos De
O.H. Mowrer (1907-1982), de laRevista Teoría delde AprendizajeHistoria de laa losPsicología, Grupos de vol. Integridad 28, núm. 2/3, 2007 11-1711 O.H. Mowrer (1907-1982), de la Teoría del Aprendizaje a los Grupos de Integridad José María Gondra Universidad del País Vasco Resumen O.H. Mowrer fue uno de los principales colaboradores de Clark L. Hull (1884-1952) en el Instituto de Relaciones Humanas de la Universidad de Yale durante los años 1936-1940. Coautor con Dollard y Miller del libro Frustración y Agresión (1939), sus trabajos sobre el condicionamiento de la ansiedad (Mowrer, 1939, 1940) infl uyeron en las teorías neoconductistas de la personalidad, y sus experimentos sobre la enuresis infantil (Mowrer y Mowrer, 1938) fueron pioneros de las técnicas del «feedback» y de la terapia de la conducta. Presidente de la APA, en el discurso presidencial (Mowrer, 1954) explicó el len- guaje y la transmisión del signifi cado en unos términos parecidos a los de las teorías mediacionales (Os- good y Sebeok, 1965) que desarrolló en otros escritos posteriores (Mowrer, 1960b, 1980). Sin embargo, en sus obras sobre psicoterapia y personalidad (Mowrer, 1950, 1953) cambió de opinión y reconoció en la culpa la principal fuente de ansiedad, lo que le llevó a una terapia basada en la confesión de los propios fallos y la restitución del daño causado a los demás (Mowrer, 1964, 1972). El artículo analiza su evolu- ción y las razones que le llevaron a estas posiciones próximas a las de la psicología humanística. Palabras clave: Ansiedad aprendida, psicoanálisis, relación interpersonal, teoría del aprendizaje, terapia grupal. -

Handbook of Ptsd
HANDBOOK OF PTSD Handbook of PTSD Science and Practice edited by Matthew J. Friedman Terence M. Keane Patricia A. Resick THE GUILFORD PRESS New York London © 2007 The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc. 72 Spring Street, New York, NY 10012 www.guilford.com All rights reserved No part of this book may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilming, recording, or otherwise, without written permission from the Publisher. Printed in the United States of America This book is printed on acid-free paper. Last digit is print number:987654321 The authors have checked with sources believed to be reliable in their efforts to provide information that is complete and generally in accord with the standards of practice that are accepted at the time of publication. However, in view of the possibility of human error or changes in medical sciences, neither the authors, nor the editor and publisher, nor any other party who has been involved in the preparation or publication of this work warrants that the information contained herein is in every respect accurate or complete, and they are not responsible for any errors or omissions or the results obtained from the use of such information. Readers are encouraged to confirm the information contained in this book with other sources. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Handbook of PTSD : science and practice / edited by Matthew J. Friedman, Terence M. Keane, Patricia A. Resick. p. ; cm. Includes bibliographical references and index. ISBN-13: 978-1-59385-473-7 (hardcover : alk. -

Experimental Evidence of Scapegoating
DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 14608 Shifting Punishment on Minorities: Experimental Evidence of Scapegoating Michal Bauer Jana Cahlíková Julie Chytilová Gérard Roland Tomáš Želinský JULY 2021 DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 14608 Shifting Punishment on Minorities: Experimental Evidence of Scapegoating Michal Bauer Gérard Roland CERGE-EI and Charles University and IZA UC Berkeley, CEPR and NBER Jana Cahlíková Tomáš Želinský Max Planck Institute for Tax Law and Public Technical University of Košice and Durham Finance University Julie Chytilová Charles University and CERGE-EI JULY 2021 Any opinions expressed in this paper are those of the author(s) and not those of IZA. Research published in this series may include views on policy, but IZA takes no institutional policy positions. The IZA research network is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The IZA Institute of Labor Economics is an independent economic research institute that conducts research in labor economics and offers evidence-based policy advice on labor market issues. Supported by the Deutsche Post Foundation, IZA runs the world’s largest network of economists, whose research aims to provide answers to the global labor market challenges of our time. Our key objective is to build bridges between academic research, policymakers and society. IZA Discussion Papers often represent preliminary work and are circulated to encourage discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be available directly from the author. ISSN: 2365-9793 IZA – Institute of Labor Economics Schaumburg-Lippe-Straße 5–9 Phone: +49-228-3894-0 53113 Bonn, Germany Email: [email protected] www.iza.org IZA DP No. -

Autotelic Principle: the Role of Intrinsic Motivation in the Emergence And
Autotelic Principle : the role of intrinsic motivation in the emergence and development of artificial language Miquel Cornudella Gaya To cite this version: Miquel Cornudella Gaya. Autotelic Principle : the role of intrinsic motivation in the emergence and development of artificial language. Artificial Intelligence [cs.AI]. Université Paris sciences et lettres, 2017. English. NNT : 2017PSLEE082. tel-01765234v2 HAL Id: tel-01765234 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01765234v2 Submitted on 7 Mar 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. THÈSE DE DOCTORAT de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres PSL Research University Préparée à l’École Normale Supérieure Autotelic Principle: the role of intrinsic motivation in the emergence and development of artificial language Autotelic Principle : le rôle de la motivation dans l’apparition et le développement d’un langage artificiel École doctorale no540 ECOLE DOCTORALE TRANSDISCIPLINAIRE LETTRES/SCIENCES Spécialité SCIENCES DU LANGAGE COMPOSITION DU JURY : M. OUDEYER Pierre-Yves DR INRIA, Président du Jury M. DOMINEY Peter Ford DR CNRS, Rapporteur M. DE BOER Bart Professeur, Vrije Universiteit Brussel, Rapporteur Soutenue par Mme. BOUVERET Myriam Miquel Cornudella Gaya Maître de conférences HDR le 19 Décembre 2017 Université de Rouen, Examinatrice M. -
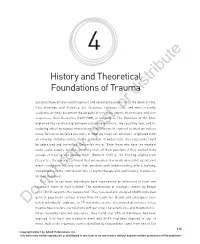
History and Theoretical Foundations of Traumadistribute Societies Have Encountered Traumatic and Devastating Events Since the Dawn of Time
4 History and Theoretical Foundations of Traumadistribute Societies have encountered traumatic and devastating events since the dawn of time. Cave drawings, oral histories, art, literature, religious texts,or and more recently, academic writings document the ubiquity of traumatic events, their nature and con- sequences. René Descartes (1649/1989), in his treatise The Passions of the Soul, explained the relationship between disruptive emotions, the resulting fear, and its enduring effect on human interactions and behavior. In contrast to what we believe today, Descartes believed passions, or what we today call emotions, originated from an external stimulus acting on the individual.post, If understood, these passions could be addressed and controlled. Descartes wrote, “Even those who have the weakest souls could acquire absolute mastery over all their passions if they worked hard enough at training and guiding them” (Bennett, 2017, p. 16). Pivoting slightly from Descartes, the general sentiment that one weakened or made vulnerable by external events could gain masterycopy, over their emotions with understanding, effort, training, and guidance is the central principle of psychotherapy and, particularly, trauma-in- formed treatment. It is safe to say most individuals have experienced or witnessed at least one traumaticnot event in their lifetime. The examination of traumatic events by Benjet et al. (2015) supports this supposition. They reviewed and analyzed 68,894 individual general population surveys drawn from 24 countries. Benjet and colleagues eval- Douated individuals’ exposure to 29 traumatic events, determined prevalence rates, trauma type clusters, correlations with personal characteristics, and traumatic his- tories including repeated exposures. They found over 70% of individuals had been exposed to at least one traumatic event and 30.5% had been exposed to four or more. -

Hindu Psychology
The International Library of Psychology HINDU PSYCHOLOGY Founded by C. K. Ogden The International Library of Psychology PSYCHOLOGY AND RELIGION In 6 Volumes I Hindu Psychology Akhilananda II Religious Conversion de Sanctis III The Psychology of Religious Mysticism Leuha IV Indian Psychology Sinha V Isaac and Oedipus Wellisch VI Man in his Relationships Westmann HINDU PSYCHOLOGY Its Meaning for the West SWAMI AKHILANANDA Introduction by Gordon W Allport First published in 1948 by Routledge and Kegan Paul Ltd Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2001. © 1948 Swami Akhilananda All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. The publishers have made every effort to contact authors/copyright holders of the works reprinted in the International Library of Psychology. This has not been possible in every case, however, and we would welcome correspondence from those individuals/companies we have been unable to trace. These reprints are taken from original copies of each book. In many cases the condition of these originals is not perfect. The publisher has gone to great lengths to ensure the quality of these reprints, but wishes to point out that certain characteristics of the original copies will, of necessity, be apparent in reprints thereof. British Library Cataloguing in Publication Data A CIP catalogue record for this book is available from the British Library Hindu Psychology ISBN 0415-21110-7 (Print Edition) Psychology and Religion: 6 Volumes ISBN 0415-21133-6 (Print Edition) The International Library of Psychology: 204 Volumes ISBN 0415-19132-7 (Print Edition) ISBN 0-203-00266-0 Master e-book ISBN ISBN 0-203-17319-8 (Glassbook Format) Table of Contents INTRODUCTION by Gordon W. -
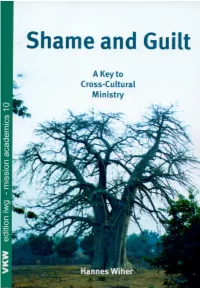
3 Shame and Guilt in Scripture
Hannes Wiher Shame and Guilt edition iwg - mission academics Band 10 herausgegeben für das Institut für Weltmission und Gemeindebau von Dr. Thomas Schirrmacher Band 9 Robert Badenberg The Body, Soul and Spirit Concept of the Bemba in Zambia Band 10 Hannes Wiher Shame and Guilt: A Key to Cross-Cultural Ministry Hannes Wiher Shame and Guilt A Key to Cross-Cultural Ministry edition iwg - mission academics scripts 10 Verlag für Kultur und Wissenschaft Culture and Science Publ. Dr. Thomas Schirrmacher Bonn 2003 Die Deutsche Bibliothek - CIP Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Bibliographic information published by Die Deutsche Bibliothek Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie;detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.ddb.de. © 2003 by Hannes Wiher eMail: [email protected] ISBN 3-932829-65-4 ISSN 0944-1069 (edition igw - mission academics) Printed in Germany Lektorat & Satz: Hans-Christian Beese Umschlaggestaltung und Gesamtherstellung: BoD Beese Druck, Friedensallee 76, 22765 Hamburg Verlag für Kultur und Wissenschaft (Culture and Science Publ.) Friedrichstr. 38, 53111 Bonn Fax 0228/9650389 www.vkwonline.de/[email protected] Verlagsauslieferung: Hänssler Verlag 71087 Holzgerlingen, Tel. 07031/7414-177 Fax -119 www.haenssler.de/[email protected] Understanding Shame and Guilt as a Key to Cross-Cultural Christian Ministry An Elenctical Study Hannes Wiher Thesis submitted in accordance with the requirements for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) in Missiology Department of Theology of the Potchefstroom University for Christian Higher Education Promotor: Prof. -

Covid-19 Crisis Fuels Hostility Against Foreigners
Covid-19 Crisis Fuels Hostility against Foreigners Vojtěch Bartoš (LMU Munich) Michal Bauer (CERGE-EI Prague) Jana Cahlíková (MPI for Tax Law and Public Finance Munich) Julie Chytilová (CERGE-EI Prague) Discussion Paper No. 243 May 14, 2020 Collaborative Research Center Transregio 190 | www.rationality-and-competition.de Ludwig-Maximilians-Universität München | Humboldt-Universität zu Berlin Spokesperson: Prof. Dr. Klaus M. Schmidt, University of Munich, 80539 Munich, Germany +49 (89) 2180 3405 | [email protected] Covid-19 Crisis Fuels Hostility against Foreigners Vojtěch Bartoš1, Michal Bauer2,3, Jana Cahlíková4, Julie Chytilová2,3 First version: April 25, 2020 This version: May 12, 2020 1 Department of Economics, University of Munich, Geschwister-Scholl-Platz 1, D-80539, Germany 2 CERGE-EI, a joint workplace of Charles University and the Economics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Politickych veznu 7, 111 21, Czech Republic 3 Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Opletalova 26, 110 00, Prague, Czech Republic 4 Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Marstallplatz 1, D - 80539 München, Germany Abstract Intergroup conflicts represent one of the most pressing problems facing human society. Sudden spikes in aggressive behavior, including pogroms, often take place during periods of economic hardship or health pandemics, but little is known about the underlying mechanism behind such change in behavior. Many scholars attribute it to scapegoating, a psychological need to redirect anger and to blame an out-group for hardship and problems beyond one’s own control. However, causal evidence of whether hardship triggers out-group hostility has been lacking.