Seemannslexikon Überarbeitet V. H.B
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
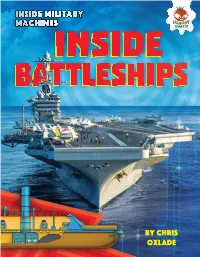
Inside Military Machines Inside Military Machines
Inside Military Machines INSIDE BattleShips By Chris Oxlade THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK INSIDE BATTLESHIPS Thanks to the creative team: Senior Editor: Alice Peebles Fact Checking: Tom Jackson Illustrations: Mat Edwards and Victor Mclindon Picture Research: Nic Dean Design: www.collaborate.agency Original edition copyright 2017 by Hungry Tomato Ltd. Copyright © 2018 by Lerner Publishing Group, Inc. Hungry Tomato® is a trademark of Lerner Publishing Group All rights reserved. International copyright secured. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without the prior written permission of Lerner BATTLESHIPS Publishing Group, Inc., except for the inclusion of brief quotations in an acknowledged review. Hungry Tomato® A division of Lerner Publishing Group, Inc. 241 First Avenue North Minneapolis, MN 55401 USA For reading levels and more information, look up this title at www.lernerbooks.com. Main body text set in Avenir Next Condensed Medium 11/15. Typeface provided by Linotype AG. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Oxlade, Chris, author. Title: Inside battleships / Chris Oxlade. Description: Minneapolis : Hungry Tomato, [2017] | Series: Inside military machines | Includes index. | Audience: Grades 4–6. | Audience: Ages 8–12. Identifi ers: LCCN 2017014445 (print) | LCCN 2017012916 (ebook) | ISBN 9781512450026 (eb pdf) | ISBN 9781512432251 (lb : alk. paper) Subjects: LCSH: Battleships—Juvenile literature. | Warships—Juvenile literature. Classifi cation: LCC V815 (print) | LCC V815 .O93 2017 (ebook) | DDC 623.825—dc23 LC record available at https://lccn.loc.gov/2017012916 Manufactured in the United States of America 1-41780-23541-4/3/2017 INSIDE BATTLESHIPS An Iowa-class World War II battleship fires her guns in action. -

Phoenician Ships: Types, Trends, Trade and Treacherous Trade Routes
PHOENICIAN SHIPS: TYPES, TRENDS, TRADE AND TREACHEROUS TRADE ROUTES by ANNE MARIE SMITH Submitted in accordance with the requirements for the degree of MASTER OF ARTS In the subject BIBLICAL ARCHAEOLOGY at the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA SUPERVISOR: PROF. CL vW SCHEEPERS November 2012 Student number: 31063543 I declare that PHOENICIAN SHIPS: TYPES, TRENDS, TRADE AND TREACHEROUS TRADE ROUTES is my own work and that all the sources that I have used or quoted have been indicated and acknowledged by means of complete references. _________________________ ___________________________ SIGNATURE DATE (Mrs) ii TABLE OF CONTENTS LIST OF ILLUSTRATIONS ............................................................ ix ACKNOWLEDGMENTS ................................................................. xi SUMMARY .................................................................................... xii CHAPTER 1 .................................................................................... 1 INTRODUCTION ............................................................................. 1 1.1 BACKGROUND ............................................................................................. 1 1.2 PROBLEM STATEMENT ............................................................................... 1 1.3 HYPOTHESIS................................................................................................ 2 1.4 AIM AND OBJECTIVES OF THE STUDY ...................................................... 2 1.5 RESEARCH QUESTIONS ............................................................................ -

Medieval Shipping
Medieval Shipping A Wikipedia Compilation by Michael A. Linton Contents 1 Caravel 1 1.1 History ................................................. 1 1.2 Design ................................................ 1 1.3 See also ................................................ 2 1.4 References ............................................... 2 1.5 External links ............................................. 2 2 Carrack 6 2.1 Origins ................................................ 8 2.2 Carracks in Asia ........................................... 10 2.3 Famous carracks ............................................ 10 2.4 See also ................................................ 12 2.5 References ............................................... 12 2.6 Further reading ............................................ 12 2.7 External links ............................................. 12 3 Cog (ship) 13 3.1 Design ................................................. 14 3.2 History ................................................. 14 3.3 Gallery ................................................. 15 3.4 See also ................................................ 15 3.5 References ............................................... 15 3.5.1 Footnotes ........................................... 15 3.5.2 Bibliography ......................................... 15 3.6 External links ............................................. 15 4 Fire ship 16 4.1 History ................................................. 16 4.1.1 Ancient era, first uses .................................... -

John H. Pryor and Elizabeth M. Jeffreys, Age of the Dromon: the Byzantine Navy, Ca. 500-1204. Leiden: Brill, 2006. 832 Pp. $213
376 Book Reviews / Medieval Encounters 13 (2007) 363-384 John H. Pryor and Elizabeth M. Jeffreys, Age of the Dromon: Th e Byzantine Navy, ca. 500-1204. Leiden: Brill, 2006. 832 pp. $213.00 (cloth). Over the years, a great deal of ink has been spilled concerning the origins and characteristics of the Byzantine war galley known as the dromon. Vir- tually all of these works have assumed that the dromon developed as a particular type of warship at the end of the Roman Empire and persisted unchanged, both in construction and its employment, until its disappear- ance in the eleventh century. John H. Pryor and Elizabeth M. Jeffreys set out to attack these assumptions with a thorough and detailed literary and textual analysis of all the primary sources relating to the dromon that has not been undertaken hitherto. As the authors clearly state, this work is not an institutional history of the Byzantine navy or its themes, but a study of the ship itself, along with its crew and weapons as well as the tactics employed by the Byzantine navy. Th e authors start with an overview of the operational history of the Roman and Byzantine navies from the Late Roman Empire until the Fourth Crusade. In this rather thick chapter, the authors detail the various opera- tions and battles of the period. In doing so, they deliberately use the names of the various ship types as they appear in each of the sources relating to each operation. It soon becomes clear that far from there being a uniform terminology for ship types, the sources are a quagmire of inconsistent usage of names as well as of archaic terminology inserted by writers who were more interested in impressing their patrons with their erudition than pro- viding an accurate description of the event or ships. -

Register of Thoroughbred Stallions of New Zealand 2019
VOLUME XLVI Register of Thoroughbred Stallions of New Zealand 2019 CLICK TO READ THE 2019 STALLION REGISTER ONLINE CONTENTS INDEX CONTENTS INDEX Index to Advertised Stallions ........................................................................................................................................................ 3 An alphabetical index of all stallions with full or half page pedigrees in this Register. Full page pedigrees begin on page 17, and half page pedigrees on page 98 Pedigree Pedigree Pedigree Foreword and NZTBA Life Members ............................................................................................................................................ 4 Page Page Page Ace High ...................................... 17 Mongolian Falcon (AUS) .............. 44 Shocking (AUS) ............................ 73 Alamosa ...................................... 18 Mongolian Khan (AUS) ................. 45 Staphanos (JPN) ......................... 74 Award Winners and NZTBA Membership ...................................................................................................................................... 5 Almanzor (FR) .............................. 19 Mulaazem (AUS) ......................... 46 Summer Passage (AUS) ............. 75 Ardossan (AUS) ........................... 20 Nadeem (AUS) ............................ 47 Sun Ruler (AUS) ........................... 99 Stallions ....................................................................................................................................................................................... -

Warfarin and Cataract Surgery Under Topical Anesthesia Visual Impairment and Depression in Elderly Diode Laser-Assisted Transca
issn 0004-2749 versão impressa A rquivos brasileiros de publicação oficial do conselho brasileiro de oftalmologia maio/Junho 2015 78 03 Warfarin and cataract surgery under topical anesthesia Visual impairment and depression in elderly Diode laser-assisted transcanalicular dacryocystorhinostomy Insulin replacement in diabetic rat lacrimal gland Contrast sensitivity in Sjögren’s indexada nas bases de dados MEDLINE | EMBASE | ISI | SciELO OFFICIAL PUBLICATION OF THE BRAZILIAN COUNCIL OF OPHTHALMOLOGY (CBO) PUBLICAÇÃO OFICIAL DO CONSELHO BRASILEIRO ISSN 0004-2749 DE OFTALMOLOGIA Continuous publication since 1938 (Printed version) CODEN - AQBOAP ISSN 1678-2925 (Electronic version) Frequency of publication: Bimonthly Arq Bras Oftalmol. São Paulo, v. 78, issue 3, pages 141-206, May/Jun. 2015 Administrative Board Chief-Editor Associate Editors Harley E. A. Bicas Wallace Chamon Augusto Paranhos Jr. José Álvaro Pereira Gomes Milton Ruiz Alves Bruno Machado Fontes Karolinne Maia Rocha Roberto Lorens Marback Former Editors Eduardo Melani Rocha Luiz Alberto S. Melo Jr. Rubens Belfort Jr. Waldemar Belfort Mattos Eduardo Sone Soriano Mário Luiz Ribeiro Monteiro Wallace Chamon Rubens Belfort Mattos Galton Carvalho Vasconcelos Michel Eid Farah Rubens Belfort Jr. Haroldo Vieira de Moraes Jr. Norma Allemann Harley E. A. Bicas Ivan Maynart Tavares Rodrigo Pessoa Cavalcanti Lira Jayter Silva de Paula Suzana Matayoshi Editorial Board National Marcelo Hatanaka (São Paulo-SP) Silvana Artioli Schellini (Botucatu-SP) Marcelo Vieira Netto (São Paulo-SP) Tiago Prata (São Paulo-SP) Ana Luísa Höfling-Lima (São Paulo-SP) Marcony Santhiago (Rio de Janeiro-RJ) Vital Paulino Costa (São Paulo-SP) André Augusto Homsi Jorge (Ribeirão Preto-SP) Maria Cristina Nishiwaki Dantas (São Paulo-SP) Walter Yukihiko Takahashi (São Paulo-SP) André Messias (Ribeirão Preto-SP) Maria de Lourdes V. -

Vegetius on Liburnae·. Naval Terminology in the Late Roman Period
Vegetius on Liburnae·. Naval Terminology in the Late Roman Period Michael B. Charles Flavius Vegetius Renatus, who wrote at some time between the years 383 and 450,1 pro vides much information about the Roman military in his well-known treatise, the Epitoma Rei Militaris. Despite this, a good deal of confusion remains about how much of the information that he presents pertains to his own age, and how much pertains to an earlier era. Indeed, the contused nature of much of the material contained within the Epitoma, which ostensibly seeks to provide solutions to Rome’s flagging martial prow ess, has caused many scholars to question the accuracy of much of what Vegetius wrote. A particularly fine example of this is provided by Vegetius’ discussion of naval vessels called liburnae or, in the standard English translation, Libumian galleys. These vessels receive considerable attention in that part of book 4 devoted to naval warfare, which is usually referred to as the praecepta belli naualis (which begins at Epit. 4.31.1). But what does Vegetius mean by the term liburna? This article seeks to determine three things: a) what Vegetius meant when he used this word, b) how much of Vegetius’ treatment of liburnae may be used as evidence for naval combat in the Late Empire, and c) how much of what he writes was gleaned from earlier sources. In short, it is hoped that the present discussion will explain some of the more puzzling — and oftentimes contradictory — Vegetian references to the naval craft under investigation, in addition to providing a case-in-point study of the way military terminology can change its meaning over time, or be used in both specific and general senses. -

Trireme Remes & Triton Tons
TRI REMES & TRI TONS A Marine Supplement for Revised Mazes & Minotaurs 1 TRIREMES & TRITONS A Marine Supplement for Revised Mazes & Minotaurs NEW UPDATED & EXPANDED 2012 EDITION Table of Contents I: HEROES OF THE SEA Tritons 3 Tritonides 4 Delphins 5 Mariners 6 II: WAR SHIPS & SEA BATTLES Naval Warfare in Mythika 7 Rules for Naval Warfare 9 III: ISLANDS & COLONIES Foreword & Credits The History of Colonization 11 Back in the 1970s, when the first edition of Mazes & The Nature of Colonies 14 Minotaurs was the only roleplaying game around, M&M players and Maze Masters used to joke about IV: POSEIDON’S KINGDOM a “forever forthcoming” supplement called Triremes Undersea Adventuring 101 16 & Tritons (or was it Tritons & Triremes ?). Although the “definitive marine supplement for M&M” was The Unseen Oceanids 18 regularly announced, promised and trumpeted in the pages of the Griffin magazine, it simply never came V: DENIZENS OF THE DEEP out – apparently for a variety of obscure contractual reasons. As the years went by, Triremes & Tritons Abyss Lurker & Amphydra 19 became known as “the sea serpent of M&M”; like its Cetoceros & Hexapod 20 mythic namesake, it would regularly show its head before disappearing beneath the waves again. Hogrebos & Ichtyosatyr 21 Now, more than 25 years after its first mention in the Jaskonos & Killer Fish 22 Coming Soon section of the Griffin magazine, we Langustos & Large Octopus 23 are proud, at last, to bring you Triremes & Tritons for the 2012 Silver Jubilee of Revised M&M – not Lyrian 24 the original supplement -
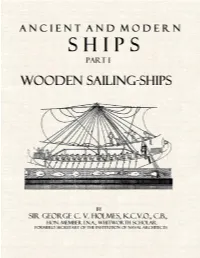
Ancient and Modern Ships, Part I. Wooden Sailing-Ships, by Sir George C
Ancient and Modern Ships, Part I. Wooden Sailing-ships, by Sir George C. V. Holmes Project Gutenberg's Ancient and Modern Ships., by George C. V. Holmes This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Ancient and Modern Ships. Part 1. Wooden Sailing Ships Author: George C. V. Holmes Release Date: July 6, 2010 [EBook #33098] Language: English Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ANCIENT AND MODERN SHIPS. *** Produced by Chris Curnow, Turgut Dincer and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive) VICTORIA AND ALBERT MUSEUM SCIENCE HANDBOOKS. A N C I E N T A N D M O D E R N S H I P S. PART I. file:///C|/...ern%20Ships,%20Part%20I.%20Wooden%20Sailing-ships,%20by%20Sir%20George%20C.%20V.%20Holmes.htm[4/1/2013 5:27:12 PM] Ancient and Modern Ships, Part I. Wooden Sailing-ships, by Sir George C. V. Holmes WOODEN SAILING-SHIPS. BY SIR GEORGE C. V. HOLMES, K.C.V.O., C.B., HON. MEMBER I.N.A., WHITWORTH SCHOLAR. FORMERLY SECRETARY OF THE INSTITUTION OF NAVAL ARCHITECTS WITH SEVENTY-FOUR ILLUSTRATIONS. (Revised.) LONDON: PRINTED FOR HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE, BY WYMAN AND SONS, Limited, Fetter Lane, E.C. -
12 Apostolov (12 Apostles) (1841) 8 De Febrero (Dona Januaria) (1827
12Apostolov(12Apostles)(1841) 8deFebrero(DonaJanuaria)(1827) Achilles Albion Alert(1818) Alma(1891) AltMecklenburg(1856) AltaMar America(1851) AmerigoVespucci(1931) Amsterdam(1800) AndrewJackson(1855) ArabicBaggaley ArboladurayJarcia(1775) Archangelgukor(Kronshlot)(1717) Ariel(1865) Arizona ArkRoyal(1587) ArnanesYawl Astrolabe(1781) Augusta(1763)andSaintAlbans(1764) Avrora(Aurora)(1833) AxelThorsen(1810) Azov Bajkal(Baikal) Balclutha(StarofAlaska,PacificQueen)(1886) Balthasar(XIX) Balticbrigantine(XVIII) BaltimoreClipperSchooner BanksDory Barcadikalmar(XIII) BarunelRascid Batavia(1628) Belgica BenjaminW.Latham Berbice(1780)&18thCenturySwedishYacht BergantinGoleta(1850) Berlin(1674) Bermudasloop BilancellaLigure BlackFalcon BlackPearl Bluenose(1921) Bovoligure Bracera BragozzoVeneto Bretagne(1866) BrigantinoGolettaAraldo BrigantinoToscano Burchio Byzantinemerchantship C.A.Thayer(1895) Cairngorm CapitanMiranda Carlo(1906) Carolina(1808) Carrak(karakka)(XV) Caspianreyushka CastellFriedrichsburg(1688) Chaleur(1764) Challenge Chaluoupearmeeenguerre CharlesW.Morgan ChineseJunk Churfurstlichejacht(1694) ClipperAurora(1855) ClipperCity ClipperGretsian(Grecian) ClipperNewport ClipperPinco ClipperSeaWitch(1846) ClipperTitania ClipperWitchOfTheWave ColinArcher Columbia Comet(1851) CorallinaNapoletana CutterItaliano CuttySark(1869) Danmark DarMlodziezy(TheGiftofYouth)(1982) DarPomorza DeZevenProvincien(1665) Derflinger(1595) Dewarutji DhowArabe Diana Dove Dr.BernardoHoussay Dubel'shljupka(Dubielboat) Dubrovaèkagalijica Dubrovaèkanava DueSorelle Dundee -

The Maritime History and Archaeology of Malta
TRADE, PIRACY, AND NAVAL WARFARE IN THE CENTRAL MEDITERRANEAN: THE MARITIME HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF MALTA A Dissertation by AYŞE DEVRİM ATAUZ Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May 2004 Major Subject: Anthropology TRADE, PIRACY, AND NAVAL WARFARE IN THE CENTRAL MEDITERRANEAN: THE MARITIME HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF MALTA A Dissertation by AYŞE DEVRİM ATAUZ Submitted to Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Approved as to style and content by: Kevin Crisman Cemal Pulak (Chair of Committee) (Member) James Bradford Luis Filipe Vieira de Castro (Member) (Member) David Carlson (Head of Department) May 2004 Major Subject: Anthropology iii ABSTRACT Trade, Piracy, and Naval Warfare in the Central Mediterranean: The Maritime History and Archaeology of Malta. (May 2004) Ayse Devrim Atauz, B.S., Middle East Technical University; M.A., Bilkent University Chair of Advisory Committee: Dr. Kevin Crisman Located approximately in the middle of the central Mediterranean channel, the Maltese Archipelago was touched by the historical events that effected the political, economic and cultural environment of Europe, North Africa, and the Middle East. The islands were close to the major maritime routes throughout history and they were often on the border between clashing military, political, religious, and cultural entities. For these reasons, the islands were presumed to have been strategically and economically important, and, thus, frequented by ships. An underwater archaeological survey around the archipelago revealed the scarcity of submerged cultural remains, especially pertaining to shipping and navigation. -

Mediaeval Navigation According to Akidographemata in Byzantine Churches and Monasteries (Πίν
Mediaeval Navigation according to Akidographemata in Byzantine Churches and Monasteries (πίν. 15-18) Otto MEINARDUS Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969)• Σελ. 29-52 ΑΘΗΝΑ 1972 MEDIAEVAL NAVIGATION ACCORDING TO AKIDOGRAPHEMATA IN BYZANTINE CHURCHES AND MONASTERIES (PL. 17-20) The purpose of this study is to record the evidence of certain major types of mediaeval Mediterranean and Black Sea ships according to some selected akidographemata scratched by sailors in the walls of Byzantine churches and monasteries. Whereas this paper cannot claim to be all inclusive, we hope, nevertheless, to have collected sufficient material to justify an interim report on the subject. To the student of mediaeval Mediterranean and Black Sea maritime studies these akidographemata should be of significant assi stance to his understanding of mediaeval navigation, in so far as they confirm but also clarify our knowledge of these vessels. Since these akidographemata are the scratchings of members of the respective crews, we should expect an emphasis on those parts of the ships with which the sailors were most intima tely involved, i.e. the sails, the oars and the rudder. In fact, an analytical study of these akidographemata confirms this observation. The great diversity of types of vessels represented in these scratchings is clearly noticeable. At the same time, however, it must be well understood that it is not always easy to determine the particular classification of a vessel on the basis of a single akidographema. As to-day, the peculiarities of the ships were largely determined by the requirements of the particular type of navigation, and we must distinguish between Mediterranean and Black Sea ships.