Richard Wagner
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Apocalypticism in Wagner's Ring by Woodrow Steinken BA, New York
Title Page Everything That Is, Ends: Apocalypticism in Wagner’s Ring by Woodrow Steinken BA, New York University, 2015 MA, University of Pittsburgh, 2018 Submitted to the Graduate Faculty of the Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2021 Committee Page UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Woodrow Steinken It was defended on March 23, 2021 and approved by James Cassaro, Professor, Music Adriana Helbig, Associate Professor, Music David Levin, Professor, Germanic Studies Dan Wang, Assistant Professor, Music Dissertation Director: Olivia Bloechl Professor, Music ii Copyright © by Woodrow Steinken 2021 iii Abstract Everything That Is, Ends: Apocalypticism in Wagner’s Ring Woodrow Steinken, PhD University of Pittsburgh, 2021 This dissertation traces the history of apocalypticism, broadly conceived, and its realization on the operatic stage by Richard Wagner and those who have adapted his works since the late nineteenth century. I argue that Wagner’s cycle of four operas, Der Ring des Nibelungen (1876), presents colloquial conceptions of time, space, and nature via supernatural, divine characters who often frame the world in terms of non-rational metaphysics. Primary among these minor roles is Erda, the personification of the primordial earth. Erda’s character prophesies the end of the world in Das Rheingold, a prophecy undone later in Siegfried by Erda’s primary interlocutor and chief of the gods, Wotan. I argue that Erda’s role changes in various stage productions of the Ring, and these changes bespeak a shifting attachment between humanity, the earth, and its imagined apocalyptic demise. -

Transcendence” in German History and Politics
THE ACOLYTES OF BEING: A DEFINITION OF “TRANSCENDENCE” IN GERMAN HISTORY AND POLITICS by Emily Stewart Long Honors Thesis Appalachian State University Submitted to the Department of History, the Department of Political Science, and the Honors College in partial fulfillment of the requirements for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science May, 2015 _____________________________________________________________________ Michael C. Behrent, PhD., History, Thesis Director _____________________________________________________________________ Nancy S. Love, Ph.D., Political Science, Thesis Director ____________________________________________________________________ Benno, Weiner, Ph.D., Department of History, Honors Director ___________________________________________________________________ Elicka Peterson-Sparks, PhD., Department of Political Science, Honors Director _____________________________________________________________________ Leslie Sargent Jones, Ph.D., Director, The Honors College 1 ABSTRACT Acting as my Senior Honors Thesis in the departments of History, Political Science, and University Honors, this project, “The Acolyte of Being,” aims to present an aesthetic history of twentieth century German philosopher Martin Heidegger’s concept of “Da-sein:” the “thereness” of Being (or existence) itself. Taking into account 2,500 years of Western metaphysics, my thesis begins by redefining one key philosophical term: transcendence, and in so doing revive four others as well: truth, beauty, freedom and the term metaphysics itself. As such, this work begins with a “Definition of Transcendence,” informing the following five chapters. These chapters, in keeping with the historicity of Da-sein as an aesthetic one, each name great works of art, opening of the oblivions of Being to man. Each of my chapters follow the guiding definition of “Transcendence” and correspond as well to one of five Wagnerian operas: Das Rheingold, Die Walkyrie, Siegfried, Götterdämmerung and, finally, Parsifal. -

Geschichtliches Zum Werk Lulu Von Alban Berg
PHLU FS17 Musikvermittlung Florian Muff, Daria Suppiger, Minna Doynov Instrument der Musikvermittlung Geschichtliches zum Werk Lulu von Alban Berg Infos zum Komponisten Alban Berg wurde im Jahr 1885 in Wien geboren. Sein Vater war wohlhabender Geschäftsmann, er verstarb jedoch als Alban Berg 15 Jahre alt war. Alban Berg, welcher vielseitig begabt war, war als Schüler an Literatur und Musik gleichermassen interessiert. Mit seiner jüngeren Schwester Smaragda erhielt er Klavierunterricht und begann mit 16 Jahren Lieder zu komponieren – diese wurden von seinem älteren Bruder und Smaragda gesungen. Als 17-jähriger verliebte er sich in das im elterlichen Haushalt tätige Küchenmädchen Marie Scheuchl. Aus dieser Liebschaft entstand im Jahre 1902 ein uneheliches Kind, zu dessen Vaterschaft sich Berg aber erst ein Jahr später bekannte. Aus seiner späteren Ehe mit Helene Berg (ehem. Nahowski) entstanden keine Kinder. Anfang 1900 besuchte er einen Kompositionskurs, der durch den damals 30-jährigen Komponisten Arnold Schönberg geleitet wurde. Alban Bergs Bruder hatte Schönberg Noten von Alban vorgelegt. So erklärte sich Schönberg bereit, den jungen Alban zu unterrichten. Nach dem Ende des Kurses wurde Alban von Schönberg unentgeltlich und privat weiter unterrichtet, weil die finanziellen Mittel zu diesem Zeitpunkt für Berg fehlten. Im Jahre 1912 entstanden die Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg , zwei dieser Lieder brachte Arnold Schönberg zur Uraufführung. Dieses Konzert galt später als das berüchtigte Skandalkonzert, welches zu einem grossen Tumult führte und abgebrochen werden musste. Von da an komponierte Berg mehrere Orchesterstücke. Im Jahre 1915-1918 diente Berg der österreichischen Armee. Zu dieser Zeit arbeitete er an seiner ersten Oper Wozzeck, die er 1917, in enger Anlehnung an Georg Büchners Drama Woyzeck, abschloss. -

Patrice Chéreau, London: Bloomsbury (The Arden Shakespeare) Gherardo Ugolini – When Heroism Is Female
S K E N È Journal of Theatre and Drama Studies 4:2 2018 Kin(g)ship and Power Edited by Eric Nicholson SKENÈ Journal of Theatre and Drama Studies Founded by Guido Avezzù, Silvia Bigliazzi, and Alessandro Serpieri General Editors Guido Avezzù (Executive Editor), Silvia Bigliazzi. Editorial Board Simona Brunetti, Francesco Lupi, Nicola Pasqualicchio, Susan Payne, Gherardo Ugolini. Managing Editor Francesco Lupi. Editorial Staff Francesco Dall’Olio, Marco Duranti, Maria Serena Marchesi, Antonietta Provenza, Savina Stevanato. Layout Editor Alex Zanutto. Advisory Board Anna Maria Belardinelli, Anton Bierl, Enoch Brater, Jean-Christophe Cavallin, Rosy Colombo, Claudia Corti, Marco De Marinis, Tobias Döring, Pavel Drábek, Paul Edmondson, Keir Douglas Elam, Ewan Fernie, Patrick Finglass, Enrico Giaccherini, Mark Griffith, Daniela Guardamagna, Stephen Halliwell, Robert Henke, Pierre Judet de la Combe, Eric Nicholson, Guido Paduano, Franco Perrelli, Didier Plassard, Donna Shalev, Susanne Wofford. Copyright © 2018 SKENÈ Published in December 2018 All rights reserved. ISSN 2421-4353 No part of this book may be reproduced in any form or by any means without permission from the publisher. SKENÈ Theatre and Drama Studies http://www.skenejournal.it [email protected] Dir. Resp. (aut. Trib. di Verona): Guido Avezzù P.O. Box 149 c/o Mail Boxes Etc. (MBE150) – Viale Col. Galliano, 51, 37138, Verona (I) Contents Kin(g)ship and Power Edited by Eric Nicholson Eric Nicholson – Introduction 5 Anton Bierl – The mise en scène of Kingship and Power in 19 Aeschylus’ Seven Against Thebes: Ritual Performativity or Goos, Cledonomancy, and Catharsis Alessandro Grilli – The Semiotic Basis of Politics 55 in Seven Against Thebes Robert S. -

Musikkdrama Og Dekonstruksjon
Musikkdrama og dekonstruksjon Postdramatiske lesninger av Richard Wagners tetralogi Der Ring des Nibelungen Masteroppgave i musikkvitenskap Marianne Berglöf Studentnummer 240065 Institutt for musikkvitenskap Universitetet i Oslo Høstsemesteret 2014 Innhold side 1. Innledning og problemstilling 1 1.2. Metode 3 2. Paradigmeskiftet modernisme – postmodernisme 4 2.1. Strukturalisme 4 2.2. Modernisme kontra postmodernisme 5 2.3. Jean-Francois Lyotard 6 2.4. Jacques Derrida og dekonstruksjonsbegrepet 8 3. Følgene av det postmodernes idé for iscenesettelsen av Wagners musikkdramaer 10 3.1. DerRing des Nibelungen i Bayreuth1976 11 4. Postdramatisk teater og performativ estetikk 19 4.1. Hans-Thies Lehmanns teori om postdramatisk teater 20 4.2. Erika Fischer-Lichtes performative teori 26 4.2.1. Historisk oversikt over performativitetsbegrepet 26 4.2.2. Performative teorier: Austin, Butler, Derrida 28 4.2.3. Teorier rundt oppførelser og performances 30 4.2.4. Teateroppførelsen og 'verket' 32 4.2.5. Legemets materialitet 36 4.2.6. Iscenesettelse 37 4.2.7. Estetisk erfaring 38 4.3. Oppsummering og kommentarer 40 5. Postmoderne og postdramatiske lesemåter av Der Ring des Nibelungen 1994 – 2002 43 5.1. Lek med assosiasjoner og materialer: Der Ring des Nibelungen i Bayreuth1994 44 5.2. Robert Wilsons durative teaterestetikk: Der Ring des Nibelungen i Zürich 2000-2002 46 5.3. Dekonstruksjon av verk-strukturen: Der Ring des Nibelungen i Stuttgart 1999-2000 52 5.3.1. Das Rheingold 54 5.3.2. Die Walküre 56 5.3.3. Siegfried 58 5.3.4. Götterdämmerung 61 5.3.5. Generelle postdramatiske trekk ved Ringen i Stuttgart 64 5.3.5.1. -
''Quand Chéreau Lit Wagner: Parcours D'un ''Ring'' (1976-1980)''
”Quand Chéreau lit Wagner : Parcours d’un ”Ring” (1976-1980)” Élise Petit To cite this version: Élise Petit. ”Quand Chéreau lit Wagner : Parcours d’un ”Ring” (1976-1980)”. Patrice Chéreau en son temps, Nov 2016, Paris, France. hal-02861052 HAL Id: hal-02861052 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02861052 Submitted on 8 Jun 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Copyright É L IS E P ETIT « Q U A N D C HÉREAU LIT W AGNER : P A R C O U R S D ’ UN R ING ( 1 9 7 6 - 1 9 8 0 ) 1 » 1973 : Wolfgang Wagner propose à Pierre Boulez la direction musicale de la tétralogie du Ring de Richard Wagner, à l’occasion du centenaire de la première production prévu en 1976. À une période où les œuvres wagnériennes connaissent des mises en scène audacieuses à travers toute l’Europe, l’enjeu est d’imposer Bayreuth dans le paysage de la modernité. Boulez sollicite tout d’abord Ingmar Bergman, qui lui répond par télégraphe que Wagner représentait « ce qu’il détestait le plus au monde »2. -

Staging the Past: Richard Wagner's Ring Cycle in Divided Germany
Staging the Past: Richard Wagner’s Ring Cycle in Divided Germany during the 1970s and 1980s Alexander K. Rothe Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2015 © 2015 Alexander K. Rothe All rights reserved ABSTRACT Staging the Past: Richard Wagner’s Ring Cycle in Divided Germany during the 1970s and 1980s Alexander K. Rothe The staging of Richard Wagner’s Ring des Nibelungen provides an ideal site to examine representations of the German past in the opera house and the broader cultural world surrounding it, in particular how these representations reveal different conceptions of the past in the German Democratic Republic (GDR) and the Federal Republic of Germany (FRG). By looking at three different productions of the Ring cycle in divided Germany during the 1970s and 1980s, I will show how Wagner stagings both reflected and contributed to historical debates about the Nazi past and discussions about cultural and national identity. The introduction considers why stagings of Wagner’s Ring cycle are so important for understanding national identity and the process of coming to terms with the Nazi past (Vergangenheitsbewältigung) in the two German states. Along with describing my own methodology, I give an overview of the different approaches to opera staging in recent musicological scholarship. Chapter One provides contextual information on divided Germany during the 1970s and 1980s, and it also introduces three historical debates that appear in the case studies. Chapter Two begins by looking at the Leipzig Ring (1973- 1976), directed by Joachim Herz, as a parable about nineteenth-century class conflict. -

1987 Molière Du Comédien
HISTORIQUE DES NOMINATIONS AUX MOLIERES 1987 – 2017 ____________________ 1987 Molière du comédien - Philippe Clévenot, dans Elvire Jouvet 40 - Claude Rich, dans Faisons un rêve - Jacques Dufilho, dans L'Escalier - Michel Bouquet, dans Le Malade imaginaire - Michel Serrault, dans L'Avare Molière de la comédienne - Suzanne Flon, dans Léopold le bien-aimé - Denise Grey, dans Harold et Maude - Jeanne Moreau, dans Le Récit de la servante Zerline - Dominique Valadié, dans Hedda Gabler - Nicole Garcia, dans Deux sur la balançoire Molière du comédien dans un second rôle - Pierre Arditi, dans La Répétition ou l’Amour puni - Jean-Paul Roussillon, dans Conversations après un enterrement - Patrick Raynal, dans Tel quel - Didier Sandre, dans La Folle Journée ou le Mariage de Figaro - Jean-Michel Dupuis, dans Conversations après un enterrement Molière de la comédienne dans un second rôle - Anne Alvaro, dans Ce soir on improvise - Sabine Haudepin, dans Kean - Magali Noël, dans Cabaret - Lucienne Hamon, dans Conversations après un enterrement - Catherine Arditi, dans Adriana Monti Molière de l'auteur - Yasmina Reza, pour Conversations après un enterrement - Jean-Claude Brisville, pour L'Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune - Jean Anouilh, pour La Répétition ou l'Amour puni - Philippe Caubère, pour Ariane ou l'âge d'or - Nathalie Sarraute, pour Pour un oui ou pour un non Molière du metteur en scène - Jérôme Savary, pour Cabaret - Pierre Mondy, pour C'est encore mieux l'après-midi - Sophie Loucachevski, pour Madame de Sade - Jorge Lavelli, -
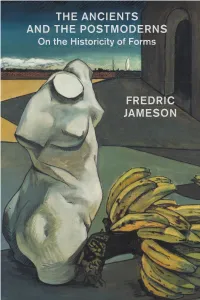
THE ANCIENTS and the POSTMODERNS on the Historicity of Forms
THE ANCIENTS AND THE POSTMODERNS On the Historicity of Forms FREDRIC JAMESON THE ANCIENTS AND THE POSTMODERNS THE ANCIENTS AND THE POSTMODERNS N FREDRIC JAMESON Y VERSO London • New York First published by Verso Books 2015 © Fredric Jameson 2015 Author and publisher would like to acknowledge the prior appearance of earlier versions of certain chapters in the following publications: Chapter 2, Modernist Cultures 8: 11 (2013); Chapter 4, Andrew Horton, ed., The Last Modernist: The Films ofTheo Angelopolous (Trowbridge: Flicks Books, 1997); Chapter 5, Critical Inquiry 1: 33 (2006); Chapter 6, D. Kellner and S. Homer, eds., Fredric jameson: A Critical Reader (London: Palgrave, 2004); Chapter 7, New LeftReview 64 Quly-Aug. 2010); Chapter 10, Criticism 52: 3-4 (Summer/Fall 2010); Chapter 11, New LeftReview 71 (Sept.-Oct. 2011); Chapter 12, New LeftReview 75 (May-June 2012); Chapter 13, London Review of Books 34: 22 (22 November 2012) All rights reserved The moral rights of the author have been asserted 1 3 57 9 10 8 6 4 2 Verso UK: 6 Meard Street, London W1F OEG US: 20 Jay Street, Suite 1010, Brooklyn, NY 11201 www.versobooks.com Verso is the imprint of New Left Books ISBN-13: 978-1-78168-593-8 (HC) eiSBN-13: 978-1-78168-594-5 (US) eiSBN-13: 978-1-78168-744-4 (UK) British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Jameson, Fredric. The ancients and the postmoderns I Frederic Jameson. pages em Includes bibliographical references and index. -

Two Landmarks in Wagner Production: Patrice Chéreau's Centenary Ring
2015 © Michael Ewans, Context 39 (2014): 25–35. Two Landmarks in Wagner Production: Patrice Chéreau’s Centenary Ring (1976) and Nikolaus Lehnhof’s Parsifal (2004) Michael Ewans Staging is all-important for opera. An opera is not a score (though scholars often write as if the score is the opera). Indeed, not even a sound recording represents an opera fully; it only exists when produced on stage. It is therefore essential to analyse the work of directors and singing actors, not at the relatively general level of newspaper and magazine reviews, but rather more deeply.1 Wagner took production very seriously. Although he was a highly experienced conductor, he entrusted the pit for the frst season of the Ring at Bayreuth to Hans Richter, and he himself took on the then new role of stage director to develop what was clearly, from Heinrich Porges’ record of the rehearsals, for some of his cast an entirely novel attention to the details of posture and gesture.2 But he was dissatisfed with the costume and set designs for the premiere of the Ring in 1876.3 It is clear that Wagner, having created a wholly new kind of opera, felt that his reforms had not extended to the mise-en-scène. Indeed, after seeing the designs that he had commissioned for his own production of Parsifal, Wagner jested that having invented the invisible orchestra, he now wished he had invented the invisible stage!4 1 This is a shortened version of a paper that I delivered as a plenary keynote address to the conference Richard Wagner’s Impact on his World and Ours in Leeds in May–June 2013, and again at the Wagner and Us conference in Melbourne in December 2013. -

Journal De Travail Tome 3
JOURNAL DE TRAVAIL – L’INVENTION DE LA LIBERTÉ – TOME 3, 1972-1974 Acteur, scénariste, metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur, Patrice Chéreau (1944-2013) a joué un rôle majeur sur la scène artis- tique et culturelle européenne durant plus de quarante ans. En 1972, il quitte le Piccolo Teatro de Milan pour rejoindre le TNP de Villeurbanne. C’est un moment de liberté artistique, intellectuelle et politique. Le metteur en scène peut se consacrer exclusivement à ses créations. Il s’essaye à la réalisation audio- visuelle et s’intéresse à la psychanalyse. Nourri par sa lecture de Jean Starobinski (L’Invention de la liberté, 1700-1789, Skira, 1964), il ne cesse de réfl échir aux moyens dont un groupe ou un individu en situation disposent pour conquérir et affi rmer leur souveraineté. Les notes réunies dans cet ouvrage concernent ses mises en scène de Massacre à Paris de Christopher Marlowe, Toller, scènes d’une révolution allemande de Tankred Dorst, La Dispute de Marivaux, Les Contes d’Hoff mann de Jacques Off enbach et Jules Barbier, ainsi que la réalisation du court métrage Le Compagnon et l’adaptation cinématographique de La Chair de l’orchidée. Ce volume inclut les écrits relatifs à des projets inaboutis tels qu’Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, la reprise de Lulu de Frank Wedekind, Lucio Silla de Wolfgang Amadeus Mozart ou encore La Gioconda d’Amilcare Ponchielli et Arrigo Boito. Il contient les premières traces de l’implication de Patrice Chéreau à la mise en scène de L’Anneau du Nibelung de Richard Wagner. -

Mcgill Community for Lifelong Learning | Rory O'sullivan Music
Rory O’Sullivan Opera and Music DVD Collection McGill Community for Lifelong Learning McGill Community for Lifelong Learning | Rory O’Sullivan Music Collection Table of Contents Introduction ................................................................................................................ 3 Borrowing Procedure ................................................................................................. 4 DVD Request Form ................................................................................................... 5 Opera Collection ........................................................................................................ 6 Opera Compilations ...............................................................................................263 Orchestral and Other Works ..................................................................................287 Last Update: 29 March 2017 Page 2 McGill Community for Lifelong Learning | Rory O’Sullivan Music Collection Introduction McGill Community for Lifelong Learning is now in possession of a unique collection of opera DVDs. The family of the late Rory O’Sullivan has generously donated his personal collection for the pleasure and enjoyment of all MCLL members. Rory, through his very popular and legendary Opera Study Groups, inspired huge numbers with his knowledge, love and passion for opera. An architect by profession, Rory was born, raised and educated in Ireland. In his youth he participated in school productions of Gilbert and Sullivan operettas. This instilled