About Individual Experiences of Cult from the Design of the Sacred Space and Its Transformations
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BIBLE STUDY: Golgotha - the Place of Both Goliath of Gath’S Skull, and the Death of Jesus Christ (Part I)!!!
One Nation Under God Ministries www.onug.us BIBLE STUDY: Golgotha - The Place of Both Goliath of Gath’s Skull, and The Death of Jesus Christ (Part I)!!! 1 One Nation Under God Ministries www.onug.us BIBLE STUDY: Golgotha - The Place of Both Goliath of Gath’s Skull, and The Death of Jesus Christ (Part I)!!! Imagine, if YOU could travel back in time to Passover Day, 31 A.D.! Imagine, if YOU could personally witness the Mocking and the Taunting of Jesus Christ, as He stumbled through the streets, to the place of His Public Execution! Imagine, YOU being an Eyewitness to EVERYTHING that was Said, and Done, the morning after Jesus ate His Last Supper with His Disciples, in the Upper Room; and Broke Bread as His Body, Gave Wine as His Blood, and Washed His Disciples’ Feet – Establishing The Annual New Testament Passover in His Church - FOREVER (John 13:12- 17)! If YOU could actually Witness, as Jesus Christ’s Disciples did - The Crucifixion of The Passover Lamb of God (John 1:29); WHAT WOULD YOU REPORT BACK? WHAT WOULD YOU WRITE DOWN? WHAT WOULD YOU PASS ON to your children, and future generations, so as to Preserve History, and to Prepare Humanity - for The Future Return of The Son of Man? www.onug.us 2 Let us open up our Bibles today, and go Back in Time! Let us READ, and DISCOVER, and PROVE - These Remarkable TRUTHs for ourselves; from Actual EYEWITNESS accounts of those who were Really There!!! www.onug.us Bible Study Instructions: One Nation Under God Ministries (www.onug.us) publishes and distributes weekly Bible Studies, worldwide – FREE of charge, to anyone who requests them, in both printed and electronic formats. -

Scripta Judaica 11-1-Łam.Indd
What Does Tel Shalem Have to Do with the Bar Kokhba Revolt? 93 ABBREVIATIONS AE – L’Année Épigraphique, Paris. CIIP – H.M. Cotton, L. Di Segni, W. Eck et al. (eds.), Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palestinae, vols. 3, Berlin – New York. CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin. SEG – Supplementum Epigraphicum Graecum, Leiden – Boston. BIBLIOGRAPHY Adams, M.J. David, J., Tepper, Y. (2013): Legio. Excavations at the Camp of the Roman Sixth Legion in Israel, Biblical Archaeology Review 39. Abramovich, A. (2011): Building and Construction Activities of the Legions in Roman Palestine 1st-4th Centuries CE, Ph.D. Thesis, University of Haifa, Dept. of Archaeology, Haifa ( in Hebrew). Applebaum, S. (1989): Tineius Rufus and Julius Severus, in: S. Applebaum, Judaea in Hellenistic and Roman Times. Historical and Archaeological Essays, Leiden: 118-123. Avi-Yonah, M. (1970-71): The Caesarea Porphyry Statue Found in Caesarea”, IEJ 20: 203-208 [= For an Hebrew version, see: Avi-Yonah, The Caesarea Porphyry Statue, Eretz Israel 10 (1970): 50-52]. Birley, A.R. (2003): Hadrian’s Travels, in: L. de Blois et al. (eds.), The Representation and Perception of Roman imperial Power. Proceedings of the Third Workshop of the International Network Im- pact of Empire (Roman Empire c. 200 B.C.-A.D. 476), Rome, March 20-23, 2002, Amsterdam: 425-441. Bowerscock, G.W. (1982): rev. of A. Spijkerman, The Coins of the Decapolis and Provincia Arabia, Jerusalem 1978, Journal of Roman Studies 72: 197-198. Bowersock, G.W. (1983): Roman Arabia, Cambridge, Mass. Bowersock, G.W. (2003): The Tel Shalem Arch and P. Nahal Heer/Seiyal 8, in: P. -

The Crucifixion Is a Uniquely Distinctive Work on the Extraordinary Historical Odyssey of the Jews During a Pivotal Slice of History
THE DIRECT TRAJECTORY FROM THE CANON GOSPELS IN THE FIRST CENTURY TO AUSCHWITZ IN THE TWENTIETH www.Crucifixion1000.com TM NewHAR ParadigmVARD M AMatrixTRIX TM HARVARD MATRIX TM 21st CENTURY PUBLISHING www.NewParadigmMatrix.com OF THE JEWS David Birnbaum’s The Crucifixion is a uniquely distinctive work on the extraordinary historical odyssey of the Jews during a pivotal slice of history. This work focuses on the 1300 year time frame bracketing the emergence of Christianity in the First Century, followed by the Christianizing of the Roman Empire post–Constantine, and finally, by the ending of the Crusades c. 1300 CE. The author focuses on the crushing historical forces at–play. The Jewish nation which entered this period, is unrecognizable from the Jewish nation which emerged…. * * * 21st CENTURY PUBLISHING New Paradigm Matrix Publishing David Birnbaum Editor-in-Chief [email protected] About the Author David Birnbaum is known globally as “the architect of Poten- tialism Theory” – a unified philosophy/cosmology/metaphysics. The paradigm-challenging theory is delineated in Birnbaum’s 3-volume Summa Metaphysica series (1988, 2005, 2014). A riposte to Summa Theologica of (St.) Thomas Aquinas, the Birnbaum treatise (see PotentialismTheory.com) challenges both the mainstream Western philosophy of Aristotelianism and the well-propped-up British/atheistic cosmology of Randomness (see ParadigmChallenge.com). The focus of over 150 reviews and articles (see SummaCoverage.com), a course text at over 15 insti- tutions of higher learning globally (see SummaCourseText.com), Summa Metaphysica was the focus of an international academic conference on Science & Religion April 16-19, 2012 (see BardCon- ference.com). -
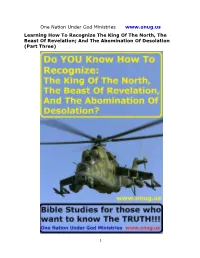
One Nation Under God Ministries Learning How to Recognize the King of the North, the Beast of Revelation; and the Abomination of Desolation (Part Three)
One Nation Under God Ministries www.onug.us Learning How To Recognize The King Of The North, The Beast Of Revelation; And The Abomination Of Desolation (Part Three) 1 One Nation Under God Ministries www.onug.us Learning How To Recognize The King Of The North, The Beast Of Revelation; And The Abomination Of Desolation (Part Three) Do you KNOW where YOU are now in Biblical Prophecy? You should! Jesus Christ has much to say to us, about the Last and Final Resurrection of the Holy Roman Empire; and another ten kings who will each give their power, for three and a half years before the Battle of Armageddon and the Second Coming of Christ, to an end-time dictator known as “The Beast” (Revelation 17:7-14)!!! Bible Study Instructions: One Nation Under God Ministries (www.onug.us) publishes and distributes weekly Bible Studies, worldwide – free of charge, to anyone who requests them, in both printed and electronic formats. Our Studies are intended to be a simple and fun way to learn the Scriptures, and are very easy to follow! We adhere to Jesus Christ’s Biblical instructions to teach and feed the flock of God portions of meat in due season, on weekly Sabbaths, and on the seven annual Holy Days throughout each calendar year (Luke 12:42 / Isaiah 28:9-10 / Matthew 13:52). Using both the Old and New Testaments, our Bible Studies are designed to present a premise, make a statement, or ask a question – followed by one or more Scriptural references. Just look up and read from your Bible the Scriptures listed. -

Syria Palästina Die Auseinandersetzung Einer Provinz Mit Römischer Politik Und Kultur
Texts and Studies in Ancient Judaism Texte und Studien zum Antiken Judentum Edited by Peter Schäfer (Princeton / Berlin) Annette Y. Reed (Philadelphia, PA) Seth Schwartz (New York, NY) Azzan Yadin (New Brunswick, NJ) 157 Werner Eck Judäa – Syria Palästina Die Auseinandersetzung einer Provinz mit römischer Politik und Kultur Mohr Siebeck Werner Eck: geboren 1939; 1968 Promotion; 1974/75 Habilitation; 1975–1979 ordentlicher Professor Universität des Saarlandes; 1979–2007 ordentlicher Professor Universität zu Köln; Projektleiter der Prosopographia Imperii Romani und des Corpus Inscriptionum Latinarum an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Mitherausgeber der Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik und des Corpus Inschriptionum Iudaeae/Palaestinae. ISBN 978-3-16-153026-5 ISSN 0721-8753 (Texts and Studies in Ancient Judaism) Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio graphie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2014 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro verfilmungen und die Einspeicherung undVer arbeitung in elektronischen Systemen. Das Buch wurde von Martin Fischer in Tübingen aus der Times belichtet, von Gulde-Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Großbuchbinderei Spinner in Ottersweier gebunden. Vorwort Im Jahr 1968, kurz vor Abschluss meiner Dissertation an der Universität Er- langen, wurde ich über einen Bekannten mit Martin Hengel bekannt gemacht. Als ich diesem von zwei neuen Inschriften des L. Flavius Silva Nonius Bassus, des Eroberers von Masada, berichtete, war er sofort höchst daran interessiert und fragte mich, ob ich darüber nicht in der Zeitschrift für Neutestamentliche Wissenschaft einen Beitrag publizieren wollte. -

Project Aneurin
The Aneurin Great War Project: Timeline Part 1 - (Ape)men at War, Prehistory to 730 Copyright Notice: This material was written and published in Wales by Derek J. Smith (Chartered Engineer). It forms part of a multifile e-learning resource, and subject only to acknowledging Derek J. Smith's rights under international copyright law to be identified as author may be freely downloaded and printed off in single complete copies solely for the purposes of private study and/or review. Commercial exploitation rights are reserved. The remote hyperlinks have been selected for the academic appropriacy of their contents; they were free of offensive and litigious content when selected, and will be periodically checked to have remained so. Copyright © 2013-2021, Derek J. Smith. First published 09:00 BST 30th May 2013. This version 09:00 GMT 20th January 2021 [BUT UNDER CONSTANT EXTENSION AND CORRECTION, SO CHECK AGAIN SOON] This timeline supports the Aneurin series of interdisciplinary scientific reflections on why the Great War failed so singularly in its bid to be The War to End all Wars. It presents actual or best-guess historical event and introduces theoretical issues of cognitive science as they become relevant. UPWARD Author's Home Page Project Aneurin, Scope and Aims Master References List FORWARD IN TIME Part 1 - (Ape)men at War, Prehistory to 730 Part 2 - Royal Wars (Without Gunpowder), 731 to 1272 Part 3 - Royal Wars (With Gunpowder), 1273-1602 Part 4 - The Religious Civil Wars, 1603-1661 Part 5 - Imperial Wars, 1662-1763 Part 6 - The Georgian -

ISRAEL – the LAND of the BIBLE Orientation Week Three 10/23/12
ISRAEL – THE LAND OF THE BIBLE Orientation Week Three 10/23/12 6:30 – Opening Prayer & Greetings 6:35 – Important Dates and People in Israel’s History 538 BC. – The edict of Cyrus the Great of Persia • The Persian Empire • The Jews return to Jerusalem 515 BC. – The 2 nd temple finished • The later prophets (Haggai, Zechariah, Malachi) • Ezra, Nehemiah, under Artaxerxes, c.450 BC • Esther & Purim (March 14 th ) • The Jews under Persian rule • The end of the Old Testament (c. 430 BC) 334-323 BC. – The conquests of Alexander the Great The beginning of the process of Hellenization 301-167 BC. – The Ptolemy and the Seleucid Empires • The contest between Egypt & Syria (Daniel) • The rise of Rome 167 BC. – The Maccabean Revolt 2 • Antiochus IV, Epiphanes • The rededication of the temple, December 164 3 142-63 BC. The Hasmonean Kings • The rise of the Pharisees & Sadducees • The founding of Qumran by the Essenes 63 BC. – The Romans capture Jerusalem • Pompey the Great 37-4 BC. – Herod the Great, King of the Jews • Herod builds Caesarea & Masada • Herod rebuilds the 2 nd Temple • Augustus and the Roman Empire 7:20 – Break 7:30 - Important Dates and People in Israel’s History (cont.) 4 BC. – The death of Herod the Great • Jesus birth and his return to Nazareth from Egypt • Augustus divides Herod's Kingdom among his three sons: Judea and Samaria given to Archelaus, Philip receives north and east of the Sea of Galilee, Antipas receives west of the Sea of Galilee & Perea • Augustus deposes Archelaus and installs a Roman Procurator (governor) over Judea in 6 AD 4 28-30 – Public ministry, death and resurrection of Jesus of Nazareth • Pontius Pilate becomes the fifth Roman Procurator of Judea, 26 AD • Pentecost and birth of the church • Tiberius, emperor of Rome 5 33-64 - The mission to the Gentiles • Conversion of Saul of Tarsus, 33 • Conversion of Cornelius in Caesarea 38-39? • Claudius now emperor of Rome (41-54). -

Imperial Secrets Remapping the Mind of Empire
Imperial Secrets Remapping the Mind of Empire Patrick A. Kelley Major, U.S. Army Director of National Intelligence and National Defense Intelligence College Research Fellow NATIONAL DEFENSE INTELLIGENCE COLLEGE WASHINGTON, DC October 2008 Th e views expressed in this work are those of the author and do not refl ect the policy or position of the Department of Defense or the U.S. Government Th e National Defense Intelligence College supports and encourages re- search that distills lessons and improves Intelligence Community capabilities for policy-level and operational consumers Imperial Secrets: Remapping the Mind of Empire—Major Patrick A. Kelley, U.S. Army. In this work, Patrick Kelley interprets the intelligence environment of political, military and information empires. His contribution sheds light on the cause of enduring intelligence collection defi cits that affl ict the center of such empires, and that can coincide with their ebb and fl ow. Alert intelligence practitioners, present and future, can note here just how useful a fresh inter- pretation of the intelligence enterprise can be to a coherent understanding of the global stream of worrisome issues. Th e long-term value of this work will be realized as readers entertain the implications of Churchill’s comment that “Th e empires of the future are the empires of the mind.” Th e manuscript for this book was reviewed by scholars and intelligence practitioners, and was approved for public release by the Department of De- fense’s Offi ce of Security Review. [email protected], Editor and Director Center for Strategic Intelligence Research and NDIC Press Library of Congress Control Number 2008929709 ISBN 978-1-932946-20-8 ~ ii ~ CONTENTS vii ACKNOWLEDGMENTS ix COMMENTARIES 1 INTRODUCTION In which a purpose is declared—explanations are off ered and the author sets out his scheme. -

Jerusalem in the First Millennium Ad: Stratigraphy Vs
1 Gunnar HEINSOHN [May 2021] JERUSALEM IN THE FIRST MILLENNIUM AD: STRATIGRAPHY VS. THE SCHOLARLY BELIEF IN ANNO DOMINI CHRONOLOGY For Ruthie LAHAV, Tony RIGG, and Dori DERDIKMAN who gave me a home when I came to JERUSALEM. I Can Jerusalem substantiate the 700 years missing in the strata of first millennium Rome, Ravenna, or Constantinople? 2 II Jerusalem’s enigmatic periods of walls without gates and of gates without walls. 5 III Two attacks of Gallus and the repetition of 1-66 AD during 284-350/51 AD. 21 IV Umayyad Iliya and Hadrian’s Aelia. 46 V Severan power and Justinian’s arch itecture in Jerusalem's final blossoming before the Tenth Century Collapse. 88 VI Conclusion [summarizing table on page 111] 107 VII Bibliography 112 Appx 1 Synopsis of same events in Roman and Jewish history that were artificially separated by 284 AD-years [by Jan Beaufort]. 119 Appx 2 Theodosian wall builders: Eudocia and Audofleda 122 Address and acknowledgements 124 2 I. CAN JERUSALEM SUBSTANTIATE THE 700 YEARS MISSING IN THE STRATA OF FIRST MILLENNIUM ROME, RAVENNA, OR CONSTANTINOPLE? Alert readers of former texts of the author (in https://q-mag.org/the-1st-millennium-ad-chronology-controversy.html) let him know that the excavators of Rome may be right that the city did not build any new housing between the 230s and 930s AD, which is why hard evidence is lacking even for the wealthiest and mightiest (see illustration below; Heinsohn 2018a). No residential quarters, latrines, aqueducts, sewers, roads, ports, fast food eateries (thermopolia), bakeries, etc. -

PDF Download Rome and Judaea 1St Edition Ebook Free Download
ROME AND JUDAEA 1ST EDITION PDF, EPUB, EBOOK Linda Zollschan | 9781317392583 | | | | | Rome and Judaea 1st edition PDF Book Another confusion must be remarked at the close of this passage, where Strabo evidently places Tarichiae on the Dead Sea, whereas it is situated on the shores of the sea of Tiberias. Mount Tabor, and the eastern part of the plain of Esdraelon, in which Tabor is situated, containing sixteen cities, among which were Shunem and Jezreel of Scripture note, the latter for many years the capital of the kingdom of Israel. Over the next 2 centuries Roman occupation of Palaestina-Judaea was a relatively uneventful period. Format see all. The Jews were granted various benefits owing to the uniqueness of their monotheistic religion and Hyrcanus was officially made the King or Ethnarch. Renewing the Documentary Hypothesis First Edition. He does what he can to Author David Blixt has written another wonderful historical novel, this one set in ancient Rome during the reign of the depraved emperor Nero. Afterwards subject to Syria; conquered by Pompey, B. The native traditions of the catastrophe of the cities of the plain, and the still existing monuments of their overthrow, are facts not mentioned by the earlier historian. If, as Robinson states, extensive beds of salt occur immediately round its margin, the solution of the contents of these by the waters of the lake would account for their present composition, its saltness increasing nearly to the point of saturation, owing to the gradual accession of waters from above, which, on evaporating, would leave their salt behind; whilst the bitumen might either have existed there previously as a consequence of antecedent volcanic eruptions, or have been produced by the very one to which reference is here made. -

Prof. Dr. Werner Eck Schriftenverzeichnis Übersicht I. Bücher A. Selbständige Publikationen B. Herausgeberschaft
Prof. Dr. Werner Eck Schriftenverzeichnis 1 Übersicht I. Bücher a. Selbständige Publikationen b. Herausgeberschaft II. Aufsätze III. Rezensionen I. Bücher a. Selbständige Publikationen 1. Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluß der Jahres- und Provinzialfasten der Statthalter, Vestigia 13, München 1970. 2. Die staatliche Organisation Italiens in der Hohen Kaiserzeit, Vestigia 28, München 1979. 3. Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.-3. Jh., Epigraphische Studien 14, Bonn 1985. 4. Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit. Textauswahl und Übersetzung, hg. mit J. Heinrichs, Darmstadt 1993. 5. Agrippina – die 'Stadtgründerin' Kölns. Eine Frau in der frühkaiserzeitlichen Politik, Köln 21993. 6. Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erwei- terte Beiträge, Bd. 1, hg. R. Frei-Stolba - M.A. Speidel, Basel 1995. 7. (mit A. Caballos - F. Fernández) Das senatus consultum de Cn. Pisone patre, Vestigia 48, München 1996. 8. (mit A. Caballos - F. Fernández) El senadoconsulto de Gneo Pisón padre, Sevilla 1996. 9. Tra epigrafia, prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati ed aggiornati, Rom 1996 (= Vetera 10). 10. Augustus und seine Zeit, München 1998, 22000, 32003, 42006, 52009, 62014 (auch als-book. 11. Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erwei- terte Beiträge, Bd. 2, hg. R. Frei-Stolba - M.A. Speidel, Basel 1998. 12. L'Italia nell'Impero Romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale, 2. überarbeitete Aufl., Bari 1999. 13. Augusto e il suo tempo, übersetzt v. C. Salvaterra, Bologna 2000. 14. Augusto y su tiempo, Madrid 2001. 15. The Age of Augustus, Oxford 2002, 22007. -

Josephus, Pilate and Paul: It’S Just a Matter of Time
Josephus, Pilate and Paul: It’s Just a Matter of Time On the Chronology of Paul and the Identity of Jesus By Laura Knight-Jadczyk May 2016 Source: https://www.academia.edu/25105062/Josephus_Pilate_and_Paul_Its_Just_a_Matter_of_Time Introduction The study of Paul, the most important figure of early Christianity, has taken on an all-new importance in recent years due to the development of new critical methods. As more research, utilizing those methods, indicates that the search for a historical Jesus of Nazareth, as depicted in the gospels, only leads to negative returns, the focus has turned to Paul. The realization is growing that Paul invented what we know as Christianity today.[1] Perhaps “invented” is too strong a word, since he had a full field of inspiration all around him in the abundant and varied theological speculations of his time.[2] While it appears that “Christian churches” – ecclesia populated by individuals following something referred to as Chrestus (Latin) or Chrestos (Greek)[3] – existed even before Paul, Paul’s writings influenced those organizations and ultimately became foundational for a particular variation of early Christianity. But that, in itself, poses the important question: If, in the end, we find that there is no “Jesus of Nazareth” – which seems certain – what then are we to make of what Paul was claiming about the Cross of Christ? How and why did Paul come to see a man on a cross as a symbol of triumph over evil powers and principalities? In order to get a full grip on who Paul was and what he was thinking and doing with such passionate conviction and intensity, we need to dispense with any reference to the later invention of Jesus of Nazareth.