Diplomarbeit Online
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Eine Welt Allein Ist Nicht Genug“ Großbritannien, Hannover Und Göttingen 1714 – 1837
1 Göttinger Bibliotheksschriften 31 2 3 „Eine Welt allein ist nicht genug“ Großbritannien, Hannover und Göttingen 1714 – 1837 Herausgegeben von Elmar Mittler Katalogredaktion: Silke Glitsch und Ivonne Rohmann Göttingen 2005 4 Ausstellung in der Paulinerkirche Göttingen 20. März–20. Mai 2005 Unterstützt von: © Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 2005 Redaktionelle Assistenz: Meike Holodiuk • Anica Rose Umschlag: Ronald Schmidt • Satz: Michael Kakuschke • Jürgen Kader Digital Imaging: Martin Liebetruth • Einband: Burghard Teuteberg ISBN 3-930457-75-X ISSN 0943-951X 5 Zum Geleit Elmar Mittler .............................................................................................. 9 Von der Manufakturstadt zum „Leine-Athen“. Göttingen, 1714–1837 Hermann Wellenreuther ........................................................................... 11 Exponate A .............................................................................................. 29 Personalunion mit England und Mitglied im Reich: Von Kurhannover zum Königreich Hannover, 1690–1837 Hermann Wellenreuther ........................................................................... 32 Exponate B .............................................................................................. 49 Britische Bilder und Vorstellungen von Deutschland im 18. Jahrhundert Frauke Geyken ......................................................................................... 52 Exponate C ............................................................................................. -

The Architectural Wishes of the Viennese Bourgeoisie 1857-1873
The architectural wishes of the Viennese bourgeoisie 1857-1873 Eelke Smulders UU 0244295 thesis MA History of Politics and Culture University of Utrecht, tutor: Joes Segal |1 The architectural wishes of the Viennese bourgeoisie 1857-1873 Eelke Smulders UU 0244295 thesis MA History of Politics and Culture University of Utrecht, tutor: Joes Segal |2 The Architectural Wishes of the Viennese Bourgeoisie 1857-1873 EELKE SMULDERS Thesis MA History of Politics and Culture University of Utrecht, Institute of History Tutor: Dr. Joes Segal July 2007 The architectural wishes of the Viennese bourgeoisie 1857-1873 Eelke Smulders UU 0244295 thesis MA History of Politics and Culture University of Utrecht, tutor: Joes Segal |3 Table of Contents Preface 4 Introduction 5 Chapter One Vienna: its Bourgeoisie and its Architecture Introduction 13 Vienna’s architecture before 1857 14 The specific situation of Vienna’s bourgeoisie 17 Social structure and social change in the second half of the nineteenth century 19 Jews in Vienna 21 The Ringstraβe project 23 The bourgeois palais 27 The organization of Vienna’s building industry 30 ‘Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft’ and the prefabricated ornaments 33 Styles of the Ringstraβe buildings 34 The world exhibition of 1873 and the crash of the stock exchange 37 Modern Vienna, or ‘Fin-de-Siècle Vienna’ 39 Chapter Two The Builder’s Wishes Introduction 41 Theophil Hansen 43 Johann Romano and August Schwendenwein 45 Heinrich Ferstel 47 Heinrich Drasche - Heinrichhof 48 Eduard Todesco - Palais Todesco 53 Jonas -
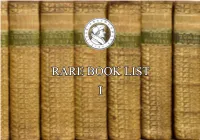
Rare Book List I
RARE BOOK LIST I Rare Book List I ERASMUSHAUS HAUS DER BÜCHER AG • BÄUMLEINGASSE 18 • 4001 BASEL • +41 61 228 99 44 • [email protected] • WWW.ERASMUSHAUS.CH 1 AMMAN, Jost (1539-1591) & Philipp LONITZER (+1599). Insignia sacrae caesareae maiestatis, principum electorum, ac aliquot illustrissimarum, illustrium, nobilium, & aliarum familiarum, formis artificiosissimis expressa: Addito cuiq; peculiari symbolo, & carmine octastico, quibus cum ipsum Insigne, tum symbolum, ingeniosè, ac sine ulla arrogantia vel mordacitate, liberaliter explicantur ... 4° (198x147 mm). [118 of 120] ll. lacking ll. [82 and 83]. 19th century half Russia leather gilt. Top and bottom of spine slightly scuffed. Frankfurt am Main, (Georg Corvinus for Siegmund Feyerabend, August), 1579. CHF 2500 Jost Amman’s famous book of coat-of-arms in its rare first edition, published before its German translation (Stam- und Wapenbuch). The illustrations are generally family arms on the versos, and allegories, mythological figures, social types, etc., on the rectos. The allegorical interpretations of both are by the historian Philipp Lonitzer (-1599), a brother of the physician and botanist Adam Lonitzer. The last 14 p. before the colophon have blank shields, four to a page. The preceding 40 p. mostly have full-page blank shields with figures, alternating with allegorical figures, both without text. The woodcuts are by Jost Amman (some signed IA) and other artists represented by the initials MF, LF, MB, MT(?), CS. Provenance: Damiano Muoni (1820-1894), Italian historian and bookdealer (stamp on ll. 2, 4, 26, 50 and last leaf). – Leon S. Olschki (1861-1940), famous Italian antiquarian bookdealer and publisher. References: Becker 24; VD 16 (Online Kat.) L-2468; Lipperheide 638; Hiler/Hiler 25; Stirling Maxwell Emblem Catalogue SM-647; Adams L 1458. -

3. Theophil Hansen Und Das Parlament 9 3
MAGISTERARBEIT Titel der Magisterarbeit Der Mosaikfries von Eduard Lebiedzki, ausgeführt durch die Tiroler Glasmalerei und Mosaikanstalt, an der Fassade des Österreichischen Parlaments in Wien. Verfasserin Ilse Knoflacher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuerin / Betreuer: Univ. Prof. Dr. Lioba Theis Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 2. Forschungsstand 4 2. 1. Theophil Hansen 5 2. 2. Eduard Lebiedzki und sein Mosaikfries 6 2. 3. Tiroler Glasmalerei und Mosaikanstalt in Innsbruck 7 2. 4. Mosaik 8 3. Theophil Hansen und das Parlament 9 3. 1. Hansens Jugend und Ausbildung in Kopenhagen 9 3. 2. Hansens Studien und erste Arbeiten in Athen 10 3. 3. Hansen erhält den Auftrag zur Errichtung des Parlaments 11 3. 4. Hansens Überlegungen zur Polychromie bzw. zum malerischen und bildhauerischen Schmuck des Parlaments 13 3. 5. Theophil Hansens Alter und Tod 18 4. Eduard Lebiedzki und der Mosaikfries 19 4. 1. Eduard Lebiedzkis Biographie 19 4. 2. Der Wettbewerb für den Fries, der Sieger Eduard Lebiedzki und die Entscheidung den Fries in Glasmosaik auszuführen 25 4. 3. Die Wiederentdeckung des Mosaiks 29 4. 4. Beschreibung der Tiroler Glasmalerei und Mosaikanstalt 35 4. 5. Entwurf und Erstellung der Kartons bis 1900 38 4. 6. Die Zusammenarbeit von Eduard Lebiedzki und der Tiroler Glasmalerei und Mosaikanstalt (Bestellbuch, Briefe…) 39 4. 7. Die Kosten 46 5. Der Mosaikfries 48 5. 1. Beschreibung des Frieses 48 5. 1. 1. Der Mittelteil 48 5. 1. 2. Die beiden Mosaiken an den Seitenwänden der Vorhalle 54 1 5. 1. 2. 1. Handel und Gewerbe 54 5. -

Klimt and the Ringstrasse
— 1 — Klimt and the Ringstrasse Herausgegeben von Agnes Husslein-Arco und Alexander Klee Edited by Agnes Husslein-Arco and Alexander Klee Inhalt Agnes Husslein-Arco 9 Klimt und die Ringstraße Klimt and the Ringstrasse Cornelia Reiter 13 Die Schule von Carl Rahl. Eduard Bitterlichs Kartonzyklus für das Palais Epstein The Viennese School of Carl Rahl. Eduard Bitterlich’s series of cartoons for Palais Epstein Eric Anderson 23 Jakob von Falke und der Geschmack Jakob von Falke and Ringstrasse-era taste Markus Fellinger 35 Klimt, die Künstler-Compagnie und das Theater Klimt, the Künstler Compagnie, and the Theater Walter Krause 49 Europa und die Skulpturen der Wiener Ringstraße Europe and the Sculptures of the Ringstrasse Karlheinz Rossbacher 61 Salons und Salonièren der Ringstraßenzeit Salons and Salonnières of the Ringstrasse-era Gert Selle 77 Thonet Nr. 14 Thonet No. 14 Wiener Zeitung, 28. April 1867 84 Die Möbelexposition aus massiv gebogenem Längenholze der Herren Gebrüder Thonet The exhibition of solid bentwood furniture by Gebrüder Thonet Alexander Klee 87 Kunst begreifen. Die Funktion des Sammelns am Ende des 19. Jahrhunderts in Wien Feeling Art. The role of collecting in the late nineteenth century in Vienna Alexander Klee 93 Anton Oelzelt. Baumagnat und Sammler Anton Oelzelt. Construction magnate and collector Alexander Klee 103 Friedrich Franz Josef Freiherr von Leitenberger. Das kosmopolitische Großbürgertum Baron Friedrich Franz Josef von Leitenberger. The cosmopolitan grande bourgeoisie Alexander Klee 111 Nicolaus Dumba. Philanthrop, -

The History of Modern Painting Volume 2
The History of Modern Painting Volume 2 by Richard Muther The History Of Modern Painting BOOK III THE TRIUMPH OF THE MODERNS CHAPTER XVI THE DRAUGHTSMEN INASMUCH as modern art, in the beginning of its career, held commerce almost exclusively with the spirits of dead men of bygone ages, it had set itself in opposition to all the great epochs that had gone before. All works known to the history of art, from the cathedral pictures of Stephan Lochner down to the works of the followers of Watteau, stand in the closest relationship with the people and times amid which they have originated. Whoever studies the works of Dürer knows his home and his family, the Nuremberg of the sixteenth century, with its narrow lanes and gabled houses; the whole age is reflected in the engravings of this one artist with a truth and distinctness which put to shame those of the most laborious historian. Dürer and his contemporaries in Italy stood in so intimate a relation to reality that in their religious pictures they even set themselves above historical probability, and treated the miraculous stories of sacred tradition as if they had been commonplace incidents of the fifteenth century. Or, to take another instance, with what a striking realism, in the works of Ostade, Brouwer, and Steen, has the entire epoch from which these great artists drew strength and nourishment remained vivid in spirit, sentiment, manners, and costume. Every man whose name has come down to posterity stood firm and unshaken on the ground of his own time, resting like a tree with all its roots buried in its own peculiar soil; a tree whose branches rustled in the breeze of its native land, while the sun which fell on its blossoms and ripened its fruits was that of Italy or Germany, of Spain or the Netherlands, of that time; never the weak reflection of a planet that formerly had shone in other zones. -

The Academy of Athens
THE ACADEMY OF ATHENS work includes: the compilation of the Historical Dictionary of the Greek stone was ceremoniously laid on August 2nd 1859 in the presence of King Language, the editing and publication of Ancient Greek, Byzantine Otto and Queen Amalia, the members of the Government and the Holy The Academy was the philosophical school founded in 387 B.C. in Athens and Latin texts, the conducting of research on Greek Folklore, Greek Synod. The building was completed in 1887 and was presented to the by the philosopher Plato near the sanctuary of the hero Academos to Philosophy, History of Greek Law, Theoretical and Applied Mathematics Prime Minister Charilaos Trikoupis by the architect Ernst Ziller (1837- the south-east of present-day Kolonos district. The school, after nine and Astronomy, Scientific Terms and Neologisms, Atmospheric Physics 1923), Hansen’s assistant. The Academy building is considered as the centuries of functioning, was closed down in 529 A.D. by an imperial and Climatology, Medieval Hellenism, Modern Greek History, Byzantine most beautiful neoclassical edifice in the world. The masterpiece of the decree banning the teaching of philosophy. Subsequently, mainly from and Post-Byzantine Art, Antiquity, and Greek Society. Erechtheion inspired Theophil Hansen for the architectural elements of the the Renaissance and on, the fame of the Platonic Academy triggered, Ionic order, which characterizes the edifice. On the exterior, the building in several countries, the foundation of Supreme Centres of Learning, has rich sculptural decoration, the main element of which is the central which adopted the name «Academy». In modern Greece attempts were pediment, which depicts Athena’s birth and is the work of the sculptor repeatedly made, but it was only in 1926 that the Academy of Athens was Leonidas Drossis (1834-1882). -

Friedrich Overbeck's 'Portrait'
AUF DEN SPUREN DER NAZARENER: Re-reading Vittoria Caldoni: Friedrich Overbeck’s ‘Portrait’ in the Neue Pinakothek by Charles Davis One of the indubitable masterpieces of the somewhat uneven collection of paintings displayed in the Neue Pinakothek in Munich is Johann Friedrich Overbeck’s seemingly perfect Vittoria Caldoni. During a recent Sunday morning visit to the museum, undertaken with the intention of looking at the Nazarene paintings in the collection, the portrait of Vittoria Caldoni exercised its curious fascination, and, as pictures often do, it appeared increasingly puzzling upon prolonged inspection. Only much later did I come across Keith Andrews’s conclusion to his brief commentary upon this painting in his seminal book of 1964, The Nazarenes, a work instrumental in reviving a more widespread interest in these long-neglected and often disparaged painters. Of Overbeck’s Vittoria Caldoni, the author writes: “The frontal disposition draws the spectator into the picture and forces him, intentionally, to seek a meaning beyond mere portrait representation” (pp. 113-114). Nowhere does Andrews enlarge upon what this ‘meaning’ might be, but nevertheless his observation, if inadvertently, corresponds to the agendum of the present essay. Although a book published in 2011 by the Akademie Verlag in Berlin describes Andrews as a ‘Scottish scholar’ and a ‘non-German art historian’, it might be remembered that he was born as Kurt Aufrichtig in Hamburg on 11 October 1920. 2 Friedrich Overbeck, Vittoria Caldoni, 1821. Neue Pinakothek, München Overbeck’s Vittoria Caldoni is universally referred to as her portrait, but, paradoxically, in his representation the artist is at pains to attribute to the young girl from Albano whom he portrays a social rôle in the world of work which she, in reality, did not perform. -

Collectors' Marks
EX LIBRIS Cooper Union Museum for the Arts of Decoration GIVEN BY Leo Wallers tein IN 1952 Collectors' Marks ARRANGED AND EDITED BY MILTON I. D. EINSTEIN OF NEW YORK AND MAX A. GOLDSTEIN PRESIDENT SAINT LOUIS ART LEAGUE The Laryngoscope Press saint LOUIS 1 9 18 A ra This copy is This edition is limited to 300 copies. Number .•5w?....??V DEC 3 1&3 sift Editors' Preface The publication of an unusual book justifies a state- ment of the reasons which promoted it. The discovery of its need affords the best apologia. Some years ago, a chance meeting with my collaborator elicited the mutual query: "Have you a copy of Fagan's Collectors' Marks?" We had reference to a little volume compiled and pub- lished at London in 1883, containing 671 'marks," and designated in Bourcard's Bibliography as "de toute rarete." We agreed that this excellent compendium deserved a place of honor in the literature of the Collector, and that the task of bringing it to more general notice was well worth the labor. As we ourselves had included this volume among our chief "desiderata," we believed that it would be esteemed by collectors generally, and therefore we decided to reprint the original and subjoin an appendix of the more recent "marks." Plans were developed for the publica- tion, correspondence was initiated with foreign museums, collectors and dealers, when, in an evil hour, the war supervened. Thereupon, the restrictions of censorship operated to place an embargo on all communications containing "marks" and ciphers, with the result that our appendix can be offered only in its fragmentary and incomplete state. -
PARABASIS 15 ENGLISH.Pdf
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 3 4 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 5 PARABASIS ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ Journal of the Επιστημονικό Περιοδικό Department of Theatre Studies Τμήματος Θεατρικών Σπουδών University of Athens Πανεπιστημίου Αθηνών Volume 15/1 Τόμος 15/1 6 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Παράβασις· τοῦτο λέγεται παράβασις, ἅπερ ἔλεγον ἐπιστρέφοντες οἱ χο- ρευταὶ πρὸς τοὺς θεωμένους. ἔστι δὲ ὁ τρόπος, ὅταν καταλιπὼν τὰ ἑξῆς τοῦ δράματος ὁ ποιητὴς συμβουλεύῃ τοῖς θεωμένοις ἢ ἄλλο ἐκτὸς λέγῃ τι τῆς ὑποθέσεως. Παράβασις δὲ λέγεται, ἐπειδὴ ἀπήρτηται τῆς ἄλλης ὑποθέσε- ως, ἢ ἐπεὶ παραβαίνει ὁ χορὸς τὸν τόπον. ἐστᾶσι μὲν γὰρ κατὰ στοῖχον οἱ πρὸς τὴν ὀρχήστραν ἀποβλέποντες· ὅταν δὲ παραβῶσιν, ἐφεξῆς ἑστῶτες καὶ πρὸς τὸ θέατρον ἀποβλέποντες τὸν λόγον ποιοῦνται. ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 7 PARABASIS ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ Journal of the Επιστημονικό Περιοδικό Department of Theatre Studies Τμήματος Θεατρικών Σπουδών University of Athens Πανεπιστημίου Αθηνών Volume 15/1 Τόμος 15/1 C. FANOURAKI Κ. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ V. GARAVAGLIA Β. ΓΚΑΡΑΒΑΛΙΑ E. HALL E. ΧΩΛ CHR. OIKONOMOPOULOU Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ W. PUCHNER Β. ΠΟΥΧΝΕΡ A. VASILIOU Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ G. VARZELIOTI Γ. ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗ BOOK REVIEWS ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ SUMMARIES ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ THE AUTHORS OF THE VOLUME ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ NATIONAL AND KAPODISTRIAN ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ UNIVERSITY OF ATHENS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ DEPARTMENT OF THEATRE STUDIES ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ATHENS 2017 ΑΘΗΝΑ 2017 8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ PARABASIS Journal of the Department of Theatre Studies of the National and Kapodistrian University of Athens Editorial Board Minas I. Alexiadis, Alexia Altouva, Kaiti Diamantakou-Agathou, Spyros A. Evangelatos, Sofia Felopoulou Konstantza Georgakaki, Grigoris Ioannidis, Anna Karakatsouli, Platon Mavromoustakos, Kyriaki Petrakou, George P. Pefanis, Walter Puchner, Ioanna Remediaki, Chrysothemis Stamatopoulou-Vassilakou, Eva Stefani, Manos Stefanidis, Evanthia Stivanaki, Anna Tabaki, Gogo K. -
The Greek Sale Nicosia Tuesday 1 December 2015
The Greek Sale nicosia tuesday 1 december 2015 athens london nicosia www.cypria-auctions.com The Greek Sale nicosia tuesday 1 december 2015 previews: athens london nicosia athens london nicosia managing director Ritsa Kyriacou AUCTION marketing & sales director Marinos Vrachimis Tuesday 1 December 2015, at 7 pm auctioneer John Souglides 14 Evrou Street, Strovolos Nicosia, 2003 for bids and enquiries Tel. +357 22341122/23 Mob. +357 99582770 viewing - ATHENS Fax +357 22341124 Email: [email protected] Hotel GRANDE BRETAGNE, Syntagma Square to register and leave an on-line bid www.cypria-auctions.com Friday 23 october - sunday 25 october 10 am to 10 pm catalogue design Miranda Violari viewing - LONDON The CONINGSBY GALLERY, 30 Tottenham Street, London W1T 4RJ english text Marinos Vrachimis Eleni Kyriacou monday 9 november to saturday 14 november 2015, 11 am to 7 pm photography Vahanidis Studio, Athens viewing - NICOSIA Christos Panayides, Nicosia CYPRIA , 14 Evrou Street, Strovolos, Nicosia, 2003 printing Cassoulides MasterPrinters tuesday 24 to monday 30 november 2015, 10 am to 9 pm tuesday 1 december 2015, 10 am to1 pm ISBN 978-1-907983-10-8 8 01 Nikiforos LYTRAS Greek, 1832 -1904 Dog signed lower right pastel on paper 29 x 28 cm PROVENANCE private collection, Athens LITERATURE Nikiforos Lytras, Nelli Missirli, Athens, 2009, National Bank of Greece Editions, no 118, p. 206, illustrated 3 000 / 5 000 € Nikiforos Lytras was born on the island of Tinos in 1832. In 1879 he married Irene Kyriakidi, the daughter of a tradesman from Smyrna, At the age of eighteen he moved to Athens to study at together they had six children. -

International Conference
1 | Page International Conference September 2016 8 -9 Athens, Greece http://daissy.eap.gr/ime-2016 Useful information Conference – Accommodation - Venues 2 | Page Contents Conference venue ............................................................................................................................................................................... 3 Accessing the Conference Hotel ......................................................................................................................................................... 4 Accommodation .................................................................................................................................................................................. 7 Sightseeing .......................................................................................................................................................................................... 8 Project meeting................................................................................................................................................................................. 18 Information / contact ........................................................................................................................................................................ 18 3 | Page Conference venue The 2-day Conference, the Workshops, the Cocktail and the Conference Closing will all take place in the Airotel Stratos Vassilikos Hotel, 114 Michalakopoulou str., Athens. 4 | Page Accessing the