Kalkriese Und Arminiusschlacht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
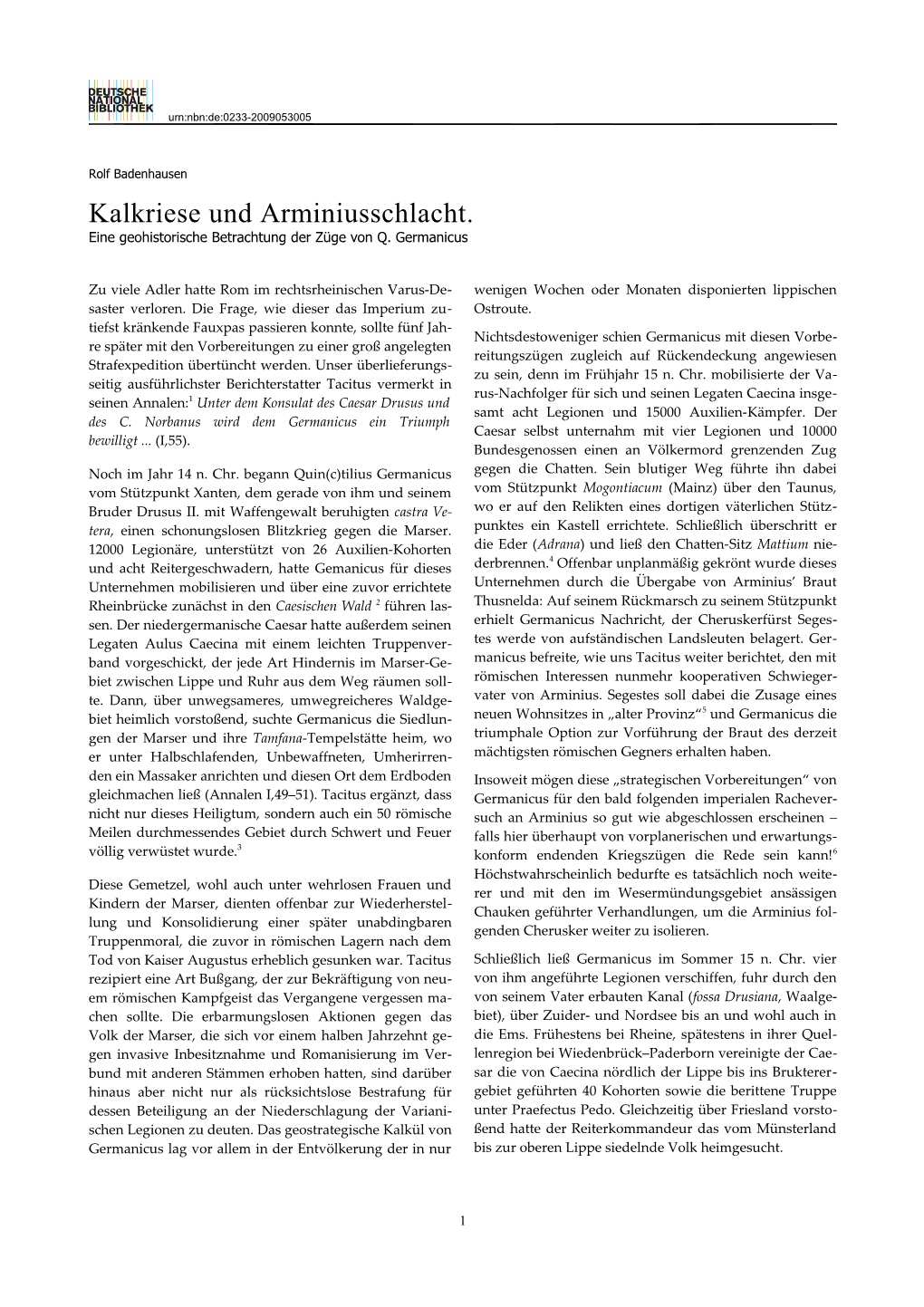
Load more
Recommended publications
-

Roman Reflections in Scandinavia ROMAN REFLECTIONS in Scandinavia
MALMÖ MUSEER MALMÖ STAD STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGLIGA ΜΥΝΤΚΑBINETTET AND MEDELHAVSMUSEET STOCKHOLM SOVRAINTENDENZA COMUNALE DI ROMA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI ROMAN REFLECTIONS in Scandinavia «L'ΕRΜΑ» di BRETSCHNEIDER Roman Reflections in Scandinavia ROMAN REFLECTIONS in Scandinavia SCANDINAVIAN ACKNOWLEDGEMENTS Exhibition. Conception, coordination and Catalogue Photography production Eva Björklund Nationalmuseet, Kobenhavn Eva Björklund Lena Hejll Kit Weiss, Niels Elswing, Lennart Larsen Lena Hejll Kent Andersson Henning Örsnes (drawings) Míkael Dahlgren Haderslev Museum Scientific committee Charlotte Fabech Carlo Krassel Eva Björklund Märit Gaimster Svendborg 0g Omegns Museum Lena Hejll Ulf Erik Hagberg Odense Bys Museer ο Luisa Franchi dell'Ort Ulla Lund Hansen Wermund Bendtsen Ulf Näsman Forhistorisk Museum Moesgárd Klaus Randsborg Arkeologísk Museum í Stavanger Administration Gad Rausing Bergen Museum Börje Svensson Ulla Silvegren Ann-Mari Olsen Göran Hedlund Berta Stjernquist Landesmuseum, Mainz Robert Odeberger Marie Stocklund Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Ulf Erik Hagberg Mainz Bengt Peterson Italian contacts Volker Iserhardt, Christin Beeck Piero Palazzi Römisch-Germanisches Museum, Köln Scientific advisors Rheinisches Bildarchiv Kent Andersson Saalburgmuseum Α Exhibition design Anders ndrén Statens Hístoriska Museum, Stockholm Lise Bender Jorgensen Tore Saether Gabriel Hildebrand, Ulf Bruxe, Christer Míkael Dahlgren Ahlin, Martin Sandberg ΑΤΑ Märit Gaimster Logotype Medelhaysmuseet Stockholm Dick Harrison -

Roman Soldier Germanic Warrior Lindsay Ppowellowell
1st Century AD Roman Soldier VERSUS Germanic Warrior Lindsay Powell © Osprey Publishing • www.ospreypublishing.com 1st Century ad Roman Soldier Germanic Warrior Lindsay PowellPowell © Osprey Publishing • www.ospreypublishing.com INTRODUCTION 4 THE OPPOSING SIDES 10 Recruitment and motivation t Morale and logistics t Training, doctrine and tactics Leadership and communications t Use of allies and auxiliaries TEUTOBURG PASS 28 Summer AD 9 IDISTAVISO 41 Summer AD 16 THE ANGRIVARIAN WALL 57 Summer AD 16 ANALYSIS 71 Leadership t Mission objectives and strategies t Planning and preparation Tactics, combat doctrine and weapons AFTERMATH 76 BIBLIOGRAPHY 78 INDEX 80 © Osprey Publishing • www.ospreypublishing.com Introduction ‘Who would leave Asia, or Africa, or Italia for Germania, with its wild country, its inclement skies, its sullen manners and aspect, unless indeed it were his home?’ (Tacitus, Germania 2). This negative perception of Germania – the modern Netherlands and Germany – lay behind the reluctance of Rome’s great military commanders to tame its immense wilderness. Caius Iulius Caesar famously threw a wooden pontoon bridge across the River Rhine (Rhenus) in just ten days, not once but twice, in 55 and 53 bc. The next Roman general to do so was Marcus Agrippa, in 39/38 bc or 19/18 bc. However, none of these missions was for conquest, but in response to pleas for assistance from an ally of the Romans, the Germanic nation of the Ubii. It was not until the reign of Caesar Augustus that a serious attempt was made to annex the land beyond the wide river and transform it into a province fit for Romans to live in. -

Zum Namen Arminius. Sind Wir Auch Durch Unsere Quellen in Den Stand
53 Zum Namen Arminius. Sind wir auch durch unsere Quellen in den Stand gesetzt, die weltgeschichtliche Bedeutung der Taten des großen Cheruskerfürsten einigermaßen gut zu übersehen und zu bewerten, so bleibt es doch bestehen, daß wir den Namen des Helden nur in der Form, wie sie die griechisch-römische Überlieferung bietet — ’Ap- giviopbei Strabo; ’Apgfjvio? bei Cassius Dio; Armenius (Armenus) bei Florus, Tacitus 1, Frontinus; Arminius bei Yelleius, Tacitus —, kennen und es der Wissenschaft bisher nicht gelungen ist, einwandfrei festzustellen, wie er in dessen eigener Sprache gelautet hat. Jüngst hat 0. Meisinger in der Zeitschr. Gymnasium 53, 1942, 61 ff. diese Frage von neuem angeschnitten, ohne freilich die einschlägige Literatur voll zu berück sichtigen oder zu kennen. So ist weder auf den Aufsatz von E. Bickel im Rhein. Mus. f. Philologie N. F. 84, 1935, lff. noch auf meine Ausführungen im Nieders. Jahrb. 13, 1936, 235 ff. und Geschichte der deutschen Stämme 22, 1 (1938) 99ff. Bezug genommen. Meisinger vertritt, wie das auch Bickel getan, die ältere Ansicht, daß der Cherusker, als er mit dem römischen Bürgerrecht und dem Ritterrang die üblichen drei römischen Namen, praenomen, gentile und cognomen, empfing, den ihm in der Literatur ge gebenen Namen Arminius der römisch-etruskischen gens Arminia verdanke, dieser also als römischer Geschlechtsname anzusehen sei. Demgegenüber ist folgendes zu be merken. ,,In republikanischer Zeit nahm der Neubürger den Geschlechtsnamen des römischen Bürgers an, der ihm vorzugsweise zum römischen Bürgerrecht verhalf, — unter dem Prinzipat aber galt es, daß, wenn der vom Kaiser mit dem Bürgerrecht Beschenkte einen anderen Geschlechtsnamen als den des Kaisers annahm, dies als ein Mangel von Loyalität angesehen wurde. -

Klienten, Klientelstaaten Und Klientelkönige Bei Den Germanen
Klaus-Peter Johne Klienten, Klientelstaaten und Klientelkönige bei den Germanen Zusammenfassung Der Beitrag geht der Frage nach, ob die Begriffe Klienten, Klientelstaaten und Klientelköni- ge für die Beziehungen zwischen Römern und Germanen im 1. und 2. Jh. n. Chr. verwendet werden können. Ein Klientelkönigtum als Instrument römischer Herrschat existierte bei den Germanen nur in Ausnahmefällen, in denen ein persönliches Verhältniszum Kaiser be- stand. Dies dürte am ehesten bei den Cheruskern für Italicus und Chariomerus zutreffen. Dagegen ist die Installierung eines Klientelkönigtums bei Marbod und Vannius gescheitert. Die im Nahen Osten ausgebildete Herrschatsform ließ sich nicht auf Germanien übertra- gen. Dort bestand die Gefahr, dass aus einem Klientelkönig ein Rivale wurde, während die hellenistischen Potentaten in eine geopolitische Situation zwischen den Großreichen der Römer und Parther eingebunden waren. So werden bei den Germanen weder ein einheit- licher Klientelstatus noch längerfristig bestehende Klientelstaaten fassbar. Keywords: Germanien; Marbod; Ariovist; Vannius; Italicus; Chariomerus; Cherusker. The paper deals with the question whether the terms clients, client states and client kings can be used to describe the relationships between the Romans and Germanic tribes in the 1st and 2nd centuries AD. Among the Germanic tribes a client kingship as an instrument of Roman rule only occurred in exceptional cases, when there existed a personal relationship to the Emperor. This was most true for Italicus and Chariomerus among the Cherusci. On the other hand the establishment of a client kingship with Marbod and Vannius failed. This type of power relationship, which had developed in the Middle East, could not be transferred to the Germanic tribes. There was the threat that a client king could become a rival, while the Hellenistic potentates were embedded in a geopolitical situation between the Roman and Parthian empires. -

Print Version
Deutsche Biographie – Onlinefassung ADB-Artikel Segest (Sigi-gast), cheruskischer Gaukönig (oder Edler), Vater der Thusnelda, welche, einem Andern verlobt, Armin (s. A. D. B. I, 534) nach dem Jahre 9 n. Chr. entführte. Die Cherusker hatten keinen König oder Richter (Grafen) der ganzen Völkerschaft, nur Vorsteher der einzelnen Gaue, welche man Könige nannte, wenn sie, obzwar durch Volkswahl, aus einem bestimmten Geschlecht, Richter (Grafen), wenn ohne Rücksicht auf ein solches Geschlecht bestellt wurden. Bei den Cheruskern walteten Könige: denn das Geschlecht Armins, der seinem Vater Segimer folgte, heißt ein „königliches“. Während nun Armin|der Führer der gegen Rom kämpfenden Gaue der Cherusker und der ihnen Verbündeten Völkerschaften ward, während Inguiomer, der Vaterbruder Armin's, in all den sieben Jahren gewaltigster Erhebung gegen Rom an der Spitze seines Gaues neutral zu bleiben vermochte, stand S. von Anfang bis zu Ende — eine kurze nothgedrungene Unterbrechung abgerechnet — auf der Seite Roms. Er verrieth Varus vor dem verhängnißvollen Aufbruch aus dem Sommerlager den ganzen Plan der Verschwörer und Empörer und forderte die Römer auf, ihn selbst, Armin und die andern Führer, ohne welche die Gemeinfreien nichts wagen würden, sofort zu verhaften. Varus verschmähte den Rath und zog in sein Verderben. Nun ward auch S. trotz allen Widerstrebens von der allgemeinen Begeisterung gezwungen gegen Rom zu fechten. Aber so bald er konnte, trat er auf die Seite Roms zurück und ward nun (a. 15) von Armin in seinem befestigten Hofe belagert. Es gelang ihm, Boten, darunter seinen Sohn Segimund, an Germanicus, der am Rheine stand, zu senden mit der Bitte um Hülfe. Der Römerfeldherr fand die Hoffnung, die Zwietracht zu schüren unter den Feinden, schwer wiegend genug, um, soeben von einem Zuge wider die Chatten am Taunus zurückgekehrt, nochmal umzuwenden und in das Cheruskerland zu eilen zum Entsatz: die Belagerer wurden durch Gefecht zum Abzug gezwungen, S. -

Mişcătoarea Mărilor Singurătate
AUI, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LI, 2005 Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu Nume de populaţii şi de triburi germanice în antichitate într- un viitor lexicon românesc de etnonime de CONSTANTIN DOMINTE Acest volum omagial consacrat profesorului Constantin Frâncu îmi oferă agreabila ocazie de a prezenta porţiuni dintr-un Lexicon românesc de etnonime, în pregătire de cîteva decenii şi, de cîţiva ani, în colaborare. 1. Este vorba, aici şi acum, numai de articolele lexicografice referitoare la etnonimele germanice antice, intrate în lexicul românesc, ca neologisme, îndeosebi prin filieră latină savantă sau greacă veche, dar în mod precar înregistrate în dicţionarele româneşti, inclusiv în cele mai noi, de circulaţie mai largă. Cunoaşterea lor este utilă, în primul rînd, istoricilor şi etnologilor, dar şi lingviştilor, în special lingviştilor germanişti, chiar dacă sursele antice, din traducerile româneşti ale cărora au fost extrase lexemele inventariate şi definite mai jos, oferă foarte puţine date de ordin lingvistic propriu-zis. Aflăm din surse antice, de exemplu, că unele etnii vechi germanice se asemănau între ele după idiomul (dialect sau grai?) pe care îl vorbeau; a se vedea Tacitus, Despre originea şi ţara germanilor, XLIII, 1-2, relativ la marsigni şi buri în raport cu suebii, sau XLVI, 1-2, despre peucini, neam bastarnic, în raport cu ceilalţi germanici. Mai rar, aceleaşi surse menţionează şi cîte o vocabulă germanică antică, izolată şi, cîteodată, glosată, fie şi indirect, prin descrierea concisă a referentului, ca: bardit „intonare specială a unui cîntec de război”, framee „(un fel de) suliţă” (Idem, op. cit., III, 1, respectiv, VI, 1). -

Reinventing 'The Invention of Tradition'?
DIETRICH BOSCHUNG, ALEXANDRA W. BUSCH AND MIGUEL JOHN VERSLUYS (EDS.) REINVENTING ‘THE INVENTION OF TRadition’? Indigenous Pasts and the Roman Present MORPHOMATA Thirty years ago Eric Hobsbawm and Terence Ranger introduced The invention of tradition as a concept to explain the creation and rise of certain traditions in times of profound cultural change. Taking stock of current theoretical understandings and focusing on the Roman world, this volume explores the concept of ‘inventing traditions’ as a means to understand pro- cesses of continuity, change and cultural innovation. The notion has been highly influential among studies concerned with the Greek and Roman eastern Mediter- ranean. Elsewhere in the Roman world and traditions other than Greek, however, have been neglected. This volume aims to evaluate critically the usefulness of the idea of ‘inventing traditions’ for the successor culture that was Rome. It focuses on the western part of the Roman Empire, which has been virtually ignored by such studies, and on non-Greek traditions. Why, in the Roman present, were some (indigenous) traditions forgotten while others invented or maintained? Using the past for reasons of legitimation in a highly volatile present is a cultural strategy that (also) characterises our present-day, globalized world. Can ‘inventing traditions’ be regarded as a common human charac- teristic occurring throughout world history? BOSCHUNG, BUSCH, VERSLUYS (EDS.) – REINVENTING ‘THE INVENTION OF TRADITION’? INDIGENOUS PASTS AND THE ROMAN PRESENT MORPHOMATA EDITED BY GÜNTER BLAMBERGER AND DIETRICH BOSCHUNG VOLUME 32 EDITED BY DIETRICH BOSCHUNG, ALEXANDRA W. BUSCH AND MIGUEL JOHN VERSLUYS REINVENTING ‘THE INVENTION OF TRADITION’? Indigenous Pasts and the Roman Present WILHELM FINK unter dem Förderkennzeichen 01UK0905. -

The Ethnology of Germany. Part I. the Saxons of Nether Saxony Author(S): H
The Ethnology of Germany. Part I. The Saxons of Nether Saxony Author(s): H. H. Howorth Source: The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 6 (1877), pp. 364-378 Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2841091 . Accessed: 10/06/2014 08:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.149 on Tue, 10 Jun 2014 08:06:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions 364 H. H. HOWORTH.-l7he Saxons of NetherSacxony. DISCUSSION. Dr. CAMPBELL, R.N., said he considered the age referredto of maternityto be too low, though it mightbe correctto say the women did sometimesmarry as young as stated. It is generallyadmitted that conceptio-ndoes not take place till afterthe appearance of the menses; and fromstatistics he collected with referenceto a neigh- bouring country(" Edin. -

The Battle of the Teutoburg Forest (Described As the “Varus Disaster” by Roman Historians) Took Place in A.D
The Battle of the Teutoburg Forest (described as the “Varus disaster” by Roman historians) took place in A.D. 9 from Sept. 9 to Sept. 11 when an alliance of Germanic tribes led by Arminius, the son of Segimer of the Cheruski, ambushed and slaughtered three entire Roman legions led by veteran warrior Publius Quinctilius Varus. The battle began a seven-year war which eventually established the Rhine as the boundary of the Roman Empire for the next 400 years, until Western Rome was completely overrun by her “barbarian” neighbors. After its defeat at Teutoburg Forest, the Roman Empire made no further concerted attempts to conquer continental Europe beyond the Rhine—although Germanicus did lead a punitive expedition to avenge Varus and bury the thou- sands of Roman skeletons still left on the battlefield. Teutoburg Forest has been called one of the 10 most important battles in human history and saved half of Europe from centuries of Roman domination. Above, Arminius signals his forces to attack the Romans. (For more on Arminius, see TBR November/December 2008 and TBR January/February 2000.) 4 SEPTEMBER/OCTOBER 2009 BARNESREVIEW.COM • 1-877-773-9077 ORDERING THE 2000-YEAR ANNIVERSARY OF THE BATTLE THAT HELPED LIBERATE EUROPE ARMINIUS: The Liberator of Europe TWO THOUSAND YEARS AGO A HERO LIVED, a charismatic man who changed the course of global history.Yet his name, Arminius, or Hermann, or Armin, is seldom heard. The Germanics probably called him Armin, but his name became Hermann in the centuries to follow (generally attributed to Martin Luther). The Romans knew him asArminius, it being the habit of the Romans to add the suffix “ius” or “us” to names. -

Who Is Arminius? a Handbook (Pdf)
Torres 1 Who is Arminius? A Handbook By: Danielle Torres Under the direction of: Professor Barbara Saylor Rodgers University of Vermont Undergraduate Honors Thesis College of Arts and Sciences, Honors College Department of Classics April, 2013 Torres 2 Table of Contents: 1. Who is Arminius and why do I care?.........................................................1 2. Die Schlacht im Teutoburger Wald………………………………………6 3. The Historical Arminius………………………………………………...13 4. How do we get to Hermann?....................................................................22 5. Why YOU should care……………………………………..…………...30 6. Bibliography……………………………………………………....…….32 7. Appendix of ancient sources………………………………………...….39 Torres 3 1. Who is Arminius and why do I care? Who is this Arminius? He is firmly rooted in Roman history, yet he remains a mystery to us as inhabitants of the modern world. The historical figure Arminius is believed to have been born around 16 BCE to Segimer, the Chief of the German Cherusci tribe.1 As the Romans began to explore Germany as an extension of the Empire, beginning under the leadership of Caesar,2 they incorporated some noble German families into their ways, taking on guardianship of chieftains’ sons and raising them in the Roman manner. Arminius and his younger brother, Flavus, both served in the Roman army, were given Roman-sounding names, and earned full Roman citizenship upon reaching manhood. Arminius even led his own auxiliary unit of Cherusci-Roman troops in various military efforts for the Romans. Arminius learned to speak Latin and attained equestrian status within Roman society. We know the basics of the life of Arminius from the writings of ancient Roman historians, although there are many details which none of the historians are able to give, such as Arminius’ given name before acquiring his Roman citizenship. -

The Barnes Review AJOURNALOFNATIONALISTTHOUGHT&HISTORY
15tBhRINGING HISTORY INTO ACCORD WITH THE FACTS IN THE TRADITION OF DR. HARRY ELMER BARNES AnniTvEedristaiorhny e Barnes Review VOLUME XV NUMBER 5 SEPTEMBER/OCTOBER 2009 BARNESREVIEW.COM ALSO: Don’t forget our culture heroes • Greek vs. Persian • The modern-day betrayal of Greece • Interview with Konstaninos Plevris • The Real John Muir • Viktor Suvorov and Operation Barbarossa • How Lend-Lease saved Stalin • Father Tiso • Historian says Poland started WWII • Hitler on why he invaded the USSR • Plot against Hitler fails • Mayhem at the Bendlerblock BRINGING HISTORY INTO ACCORD WITH THE FACTS IN THE TRADITION OF DR.HARRY ELMER BARNES the Barnes Review A JOURNAL OF NATIONALIST THOUGHT & HISTORY SEPTEMBER/OCTOBER 2009 O VOLUME XV O NUMBER 5 TABLE OF CONTENTS ARMINIUS:EUROPEAN CULTURE HERO 1941: WHY DID GERMANY ATTACK RUSSIA? BY MERLIN MILLER BY UDO WALENDY One of history’s greatest military strategists, he lived Relating to Hitler’s “Russia” proclamation is this 4 exactly 2,000 years ago and fought the tyrannical Ro- 41article on how Germany’s only hope for national mans. Thanks to Arminius the Cheruskan, the empire’s survival was a pre-emptive strike against the USSR, expansion was stopped in its tracks. which we now know had deployed massive numbers of men and materiel for use against Europe. HIDDEN TRUTH OF OUR ANCESTORS HE AN HO EWROTE ORLD AR BY DR.INGRID RIMLAND ZÜNDEL T M W R W W II Even today we must struggle against those who BY DANIEL W. MICHAELS 10 would hide from us the glorious struggle of Armin- Exposing the lies of Stalin, the bold Russian his- ius and the true history of our white culture heroes. -

III Ikonographie
III Ikonographie „Nicht wenn brandend heran das Meer wälzt all sein Wogen, Nicht wenn Germanien schickt her uns den völligen Rhein, Beugt Romas Kraft, so lang an dem rechten Regierer Caesar muthig sie hält, treu in bewährtem Vertraun.“ Anth. Pal. 9,291 (Krinagoras)1 Der römische Barbaren-2 und Germanenbegriff Für die Römer hatte der aus dem Griechischen entlehn- sierung erfolgt in den Perserkriegen, aber es kommt te Begriff barbari die Bedeutung der außerhalb des noch zu keiner Herabsetzung des Gegners. Aischylos Imperiums lebenden, insbesondere europäischen hat in dem Stück „Die Perser“ Asia und Europa gleich- Menschheit, dann auch weiters „das östliche Gegenüber wertig dargestellt. Erst im Verlaufe des 5. Jhs. v. Chr. von Parthern und Sassaniden“ 3. Barbaren stellen eine entwickelt sich allmählich ein entschieden pejorativer Gegenwelt4 dar (G. Dobesch). Sie sind oder gelten noch Charakter des Barbarenbegriffes. Im 4. Jh. v. Chr. im Lauf des 5. Jhs. oft als „rechtlos, untreu, feindlich, kämpft Demosthenes darum, die Makedonen als Bar- aggressiv“, Attribute, die sich fast beliebig vermehren baren zu brandmarken. Alexandros, König der Make- ließen. Im alten Griechenland ist der Barbar derjenige, donen, durfte wiederum bei den Olympischen Spielen der nicht Griechisch zu sprechen vermag. Eine Polari- antreten, weil seine Abstammung von Herakles als ge- 1 Schneider, BB 42 mit Anm. 189. Die altertümliche Übertra- (1972) (= Fontes et commentationes, Suppl. 1) 146 ff.; H. gung des Textes nach Th. Mommsen. Kuch, Die ‘Barbaren’ und der antike Roman, Altertum 35, 2 Die Literaturliste zum antiken – und nicht nur dem antiken 2, 1989, 80 ff.; H. H. Bacon, Barbarians in Greek Tragedy – Barbarenbegriff ist endlos.