Publikation „GRIMSEL“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Grimselwelt Karte
Grimselerlebnis deutsch Willkommen in der Luzern/Zürich/Basel Grimselhotels Ausflug-Tipps Tourist Center Detaillierte Informationen zu den Wandermöglichkeiten in der Grimselwelt #Grimselwelt finden Sie unter www.grimselwelt.ch/erlebnisse Besucherzentrum ie Grimselwelt – eine Welt der Berge und Gletscher, mit bizarren Granit- Engstlenalp Baustellenrundgang Spitallamm 1835 m Dfelsen, Schluchten, Alpweiden und tiefen Tälern. Und eine Welt des Titlis Engstlensee Wassers, der Wasserfälle und Stauseen. 1925 begann die KWO, Kraftwerke 3259 m Campingplatz Oberhasli AG, diesen Wasserreichtum für die Elektrizität zu nutzen. Die Gelmersee erste Staumauer entstand an der Grimsel. Seinerzeit die grösste der Mit der Gelmerbahn auf 1860 m ü. M. zum kristallblauen Gelmersee. 2- Feuerstelle Welt. Über die Jahrzehnte ist unter den Granitfelsen ein gigantisches System stündige Bergwanderung um den See oder Spaziergang auf der Staumauer Brünigpass l von Kraftwerkskavernen und Stollen entstanden – ein Wunderwerk der a 6-8h nahe der Bergstation. Kulinarischer Abschluss im Hotel und Naturresort PostAuto/Engstlenalp-Bus Technik inmitten einer kraftvollen Natur. Tauchen Sie ein in diese span- H t Handeck – zu Fuss erreichbar über die Handeckfallbrücke. a n Klettersteig Zudem führt ab dem Gelmersee eine ausserordentlich schöne Wande- nende Welt der Kontraste. s e 3h l rung hinein ins Diechterbach-Tal, wo der steile Aufstieg zur SAC-Gelmer- i G Berghaus Tälli Bergbahn 1726 m hütte führt. Interlaken/Bern/Brünig b Aare Sustenpass Oberalp/Gotthard e Sätteli 2h r 1.5h -

Kraftwerke Oberhasli: Weiterausbaustudien Kraftwerke Oberhasli Und Wirkung Der UVP
Kraftwerke Oberhasli: Weiterausbaustudien Kraftwerke Oberhasli und Wirkung der UVP Autor(en): Benelli, Franz Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt Band (Jahr): 105 (1987) Heft 39 PDF erstellt am: 07.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-76716 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Ökologie/Umwelt Schweizer Ingenieur und Architekt 39/87 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) Hochdruckanlagen mit Speicherseen, zur Darstellung. Von besonderem Interesse ist bei diesem Beispiel auch die Option der «freiwilligen UVP» sowie deren Rückwirkungen auf die Projektierung, welche im revidierten Konzessionsprojekt 1987 (Bild 3) Niederschlag gefunden Unter diesem Serientitel veröffentlicht der «Schweizer Ingenieur und hat. -

Handel Und Wandel an Der Grimsel Trade and Changes on the Grimsel Deutsch | English 1
Handel und Wandel an der Grimsel Trade and Changes on the Grimsel Deutsch | English 1 Überleben in karger Landschaft In jahrhundertelanger Arbeit haben sich die ihre bescheidene Lebensgrundlage zu verbessern, versuchten die Men- Bewohner des Grimselgebiets auf steinigem Boden schen im Grimselgebiet schon früh, im Passverkehr ein kleines Neben- eine Existenz geschaffen. Mit zähem Willen und einkommen zu erzielen. Als Säumer und Träger kämpften sie sich bei grosser Umsicht haben sie Dörfer gebaut, Weiden Schnee und Sturm über schlecht gangbare Pfade. Wer ganz verwegen bewirtschaftet und Alpen bestossen. Das Ergebnis war, stieg hoch in die Berge hinauf, um dort nach verborgenen Kristallen ist eine eindrückliche Kulturlandschaft. zu suchen. 2 Von Anfang an hatten die Bewohner dieser Ge- Heute ist vieles anders. Rationelle Bewirtschaftung hat auch in der Berg- gend den Unbilden der Natur zu trotzen. Lawinen, landwirtschaft Einzug gehalten: Es gibt weniger, dafür grössere Betriebe. Murgänge und Feuersbrünste waren ständige Be- Mit der Nutzung der Wasserkraft hat die Region ein zusätzliches wirt- gleiter. Immer wieder mussten Weiden, Wege und schaftliches Standbein erlangt. Doch wie zu früheren Zeiten prägt die Gebäude saniert oder gar neu erstellt werden. Um Landschaft auch heute die Geschicke ihrer Bewohner. 1 Bergbauernfamilie mit Zugkarren und Heubündeln um 1942 Mountain farmers family with carts and hay stacks, around 1942 2 «z' Bärg gahn» (Bergheu heimholen) “z' Bärg gahn” (Bringing the hay back home) 2 Surviving in a barren landscape In a centuries-long effort, the inhabitants of the Grimsel region Many things have changed today. Efficient farming made a living on stony soil. Doggedly and with great prudence, they has become part of the mountainous agriculture. -

Info Deutsch
Grimsel 2 – eines der grössten Pumpspeicherwerke der Schweiz Grimsel Hydro – Kompetenzzentrum Wasserkraft Gauli Wasserfälle – tosende Naturkraft Seeforellen in einer Restwasserstrecke der KWO Gelmerbahn – früher Werkbahn heute Touristenattraktion Grimseltor Innertkrichen – Dorfzentrum mit Tourist Center PIONIERGEIST TATENDRANG NATURKRAFT PARTNERSCHAFT ERLEBNIS BERGREGION Die Geschichte der KWO reicht zurück bis 1908. Damals Die Schweiz arbeitet an der Energiewende: Hin zu den Die Landschaft an Grimsel und Susten ist beeindruckend Die Symbiose von Natur und Technik prägt die Landschaft Die Kraftwerke der KWO stehen offen für einen Besuch. Die KWO lässt sich um keinen Preis der Welt an einen ande- kamen Ingenieure mit viel Pioniergeist in das Grimselgebiet erneuerbaren Energien. Die KWO trägt mit ihren leistungs- schön und gleichzeitig höchst energiegeladen. Von hier an Grimsel und Susten. Die Nutzung der Energie des Wassers Gehen Sie selbst in diese Unterwelt aus Tunnels, Schächten, ren Standort zügeln. Sie ist eng verbunden mit der Bergwelt und erkannten das grosse Wasserkraftpotential. Dann, 1925, fähigen Anlagen bereits heute dazu bei. In Innertkirchen stammt die Kraft des Wassers. Das Zusammenspiel bewähr- beruht auf einer Partnerschaft mit der Natur. Als erstes Was- Kavernen, Turbinen und Generatoren! Hier können Sie sich im Oberhasli. Nur hier sind die natürlichen Voraussetzungen begannen sie, hier die erste Staumauer zu bauen – seiner- und an der Handeck wurden neue Kraftwerke gebaut. Wei- ter Maschinen und modernster Technik ermöglicht es der serkraftwerk der Schweiz hat die KWO einen Fachbereich ein Bild machen von der Technik zur Stromproduktion aus gegeben, von hier kommt der Wasserreichtum, hier stimmen zeit die höchste der Welt. Mit unternehmerischem Mut und tere Projekte sind aufgegleist oder in Vorbereitung – für KWO, im Bedarfsfall schnell mit der Stromproduktion ein- Ökologie geschaffen. -

Wir Investieren in Erneuerbare Energien. 2 Die KWO in Stichworten Wasserschloss Schweiz
Wir investieren in die Wasserkraft der Zukunft. Kraftwerke Oberhasli AG Wir bauen an der Wasserkraft der Zukunft. Wir investieren in erneuerbare Energien. 2 Die KWO in Stichworten Wasserschloss Schweiz • gegründet 1925 Die Alpen mit ihren Höhenunterschieden und ihrem Niederschlags- • Aktionäre reichtum ermöglichen die Gewinnung grosser Mengen elektrischer 50 % BKW FMB Beteiligungen AG, Bern Energie aus Wasserkraft. 60 Prozent der Schweizer Stromproduktion entstammen dieser heimischen Energiequelle. 2 16 /3 % Industrielle Werke Basel IWB Aus Wasser wird Strom 2 16 /3 % Energie Wasser Bern Wolken spenden Wasser. Wir borgen es uns für den Umweg durch 2 Druckleitungen und Turbinen aus und geben es im Tal unverändert 16 /3 % Stadt Zürich der Natur zurück. Die Sonne trägt das Wasser wieder empor und damit schliesst sich der ewige Kreislauf: Wasserkraft ist erneuerbare • Aktienkapital: 120 Millionen Franken Energie – langlebig und umweltfreundlich. Wasser arbeitet seit Jahr- • Mitarbeitende: 530 Personen tausenden für die Menschen. • Installierte Leistung: 1125 MW Grimselstrom • Stromproduktion: durchschnittlich 2350 Gigawatt-Stunden (GWh) pro Jahr Die KWO ist eines der führenden Wasserkraftunternehmen der • Grimsel Hydro Schweiz. Dank der grossen Stauseen, die auch im Winter eine Menge Fabrikationsbetrieb für «Treibstoff» zur Verfügung stellen, kann die KWO das ganze Jahr Kraftwerkskomponenten über augenblicklich auf die ständigen Schwankungen des Strombe- • Grimselwelt darfs reagieren und ihre Produktion jederzeit auf den Bedarf ausrich- Tourismusangebote rund um die ten. Grimselstrom ist deshalb ein hochwertiges Produkt. Stromproduktion aus Wasserkraft Das Gebiet der KWO an Grimsel und Susten bietet ideale Vorausset- zungen für die Stromproduktion aus Wasserkraft: Grosse Höhenun- terschiede, viel Wasser, grosse Geländekammern für Seen und festen Fels als idealen Baugrund. Grimselstrom leistet einen wichtigen und naturverträglichen Beitrag zur Stromversorgung der Schweiz. -
Press Information
Press information Liebherr MK 88 Plus mobile construction crane masters 1,600 lifts in the Swiss Alps Liebherr MK 88 Plus completes up to 15 lifts per hour 900-square-metre foundation erected for concrete mixing plant Low crane structure enables work underneath material ropeways Biberach / Riss (Germany), February 2020 – In the autumn of last year, a crane operation of epic proportions was required for one of the largest infrastructure projects currently under way in Switzerland. Under considerable time pressure, a new 900-square-metre base structure needed to be constructed for the new imposing Lake Grimsel arch dam in the Alps before the onset of winter. A large- scale concrete mixing plant is due to be built on the base this spring. The construction company Frutiger AG is involved in the project and in October deployed its MK 88 Plus Liebherr mobile construction crane to the construction site, located at an altitude of almost 2,000 metres, for this Alpine assignment. Over the next six years, an enormous dam will be built at Lake Grimsel in the Bernese Alps. It will replace the 90-year-old, damaged dam already there. The foundations for the planned concrete mixing plant had to be completed near the future dam’s location before the onset of winter. However, construction couldn’t begin until the beginning of October, so speed was of the essence. For Reto Mathis, Head of the Mobile Crane Division at Frutiger, the solution was obvious straight away, “The MK is perfect for this job.” The tight time frame as well as spatial restrictions on site led him to choose the Liebherr mobile construction crane. -

Kwo-Gb-2018.Pdf
Geschäftsbericht 2018 Facts & Figures Die Aktionäre der KWO 1 ⁄6 1 3 BKW Energie AG, Bern ⁄6 ⁄6 IWB Industrielle Werke Basel Energie Wasser Bern 1 Stadt Zürich ⁄6 Produktion 2018 2017 Energieabgabe an Aktionäre (GWh) 2 149 2 225 Pumpenergie (GWh) 551 772 Installierte Turbinen leistung (MW) 1 318 1 317 Zuflüsse (GWh) 1 848 1 714 Energiereserven Ende Jahr (GWh) 401 310 Finanzen (tsdCHF) 2018 2017 Umsatz 145 128 152 057 Gewinn 7 070 7 070 Cashflow 34 436 22 088 Investitionen 4 590 19 346 Bilanzsumme 856 730 893 801 Eigenkapital 200 890 193 820 Anteil an Bilanzsumme 23.4 % 21.7 % Produktionskosten (Rp./kWh) 5.34 5.41 Produktionskosten (TCHF/MW) 87 91 Mitarbeitende 2018 2017 Vollzeitäquivalenz 279 290 davon Anzahl Lernende 25 22 Inhalt Jahresbericht 4 Vorwort 6 Produktion 10 Kraftwerksanlagen 12 Verfügbarkeit Maschinen 2018 13 Tägliche Maximalleistungen 2018 14 Energieproduktion 1929–2018 15 Wassereinzugsgebiet 16 Ausbau- und Instandhaltungsvorhaben 19 Grimsel Hydro 20 Kommunikation und Tourismus 22 Organisatorisches und Mitarbeitende 23 Gesellschaftsorgane 24 Organigramm Nachhaltigkeit 26 Nachhaltigkeits-Cockpit Finanzbericht 30 Jahres- und Lagebericht 32 Erfolgsrechnung 33 Bilanz 34 Geldflussrechnung 35 Eigenkapitalnachweis 36 Anhang – Grundsätze zur Rechnungslegung 39 Anhang – Erläuterungen zur Jahresrechnung 50 Anhang – Weitere Angaben 52 Verwendung des Bilanzgewinns 53 Revisionsbericht 4 Vorwort Die Marktsituation für die Wasserkraft hat sich 2018 Die Baubewilligungen der beiden Projekte Ersatz Stau- etwas entspannt. Die Elektrizitätspreise haben angezogen mauer Spital lamm und Kraftwerk Handeckfluh sind und die Preisprognosen für die kommenden Jahre zeigen rechtsgültig. Das Projekt Kraftwerk Handeckfluh ist des- einen Aufwärtstrend. Ein Beleg dafür, dass dieser Trend halb in der KEV-Warteliste nach vorne gerückt. -

Kraftwerke Oberhasli AG 2 Die KWO in Stichworten Wasserschloss Schweiz
Kraftwerke Oberhasli AG 2 Die KWO in Stichworten Wasserschloss Schweiz • gegründet 1925 Die Alpen mit ihren Höhenunterschieden und ihrem Nie- derschlagsreichtum ermöglichen die Gewinnung grosser • Aktionäre Mengen elektrischer Energie aus Wasserkraft. 60 Prozent 50 % BKW FMB der Schweizer Stromproduktion entstammen dieser heimi- Beteiligungen AG, Bern schen Energiequelle. 2 16 /3 % Kanton Basel-Stadt Aus Wasser wird Strom 2 16 /3 % Wolken spenden Wasser. Wir borgen es uns für den Um- Energie Wasser Bern weg durch Druckleitungen und Turbinen aus und geben es im Tal unverändert der Natur zurück. Die Sonne trägt das 2 16 /3 % Wasser wieder empor und damit schliesst sich der ewige Stadt Zürich Kreislauf: Wasserkraft ist erneuerbare Energie – langlebig und umweltfreundlich. Wasser arbeitet seit Jahrtausenden • Aktienkapital: 120 Millionen Franken für die Menschen. • Mitarbeitende: 370 Personen Grimselstrom • Stromproduktion: durchschnittlich 2350 Gigawatt-Stunden (GWh) pro Jahr Die KWO ist eines der führenden Wasserkraftunternehmen der Schweiz. Sie produziert Strom in reichlichen Mengen. • Dienstleistungsbetriebe: Dank der grossen Stauseen, die auch im Winter eine Grimsel Hydro Menge «Treibstoff» zur Verfügung stellen, kann die KWO Besucherdienst das ganze Jahr über augenblicklich auf die ständigen Meiringen-Innertkirchen-Bahn Schwankungen des Strombedarfs reagieren und ihre Pro- Gelmerbahn duktion jederzeit auf den Bedarf ausrichten. Grimselstrom Triftbahn ist deshalb ein hochwertiges Produkt. Tällibahn Luftseilbahn Handeck-Gerstenegg Das Gebiet der KWO an Grimsel und Susten bietet ideale Kinder- und Familienhotel Handeck Voraussetzungen für die Stromproduktion aus Wasser- Berg- und Erlebnishotel Grimsel Hospiz kraft: Grosse Höhenunterschiede, viel Wasser, grosse Ge- Restaurant und Berghaus Oberaar ländekammern für Seen und festen Fels als idealen Bau- Alpinhütte Bäregg grund. Grimselstrom leistet einen wichtigen und naturverträgli- chen Beitrag zur Stromversorgung der Schweiz. -
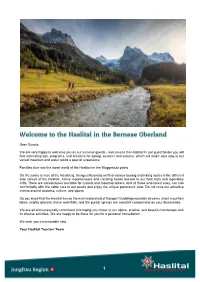
The Haslital!
Dear Guests We are very happy to welcome you as our summer guests - welcome to the Haslital! In our guest binder you will find interesting tips, programs, and activities for spring, summer and autumn, which will make your stay in our varied mountain and water world a special experience. Families dive into the dwarf world of the Haslital on the Muggestutz paths. On the sunny terrace of the Hasliberg, hiking enthusiasts will find various touring and hiking routes in the different side valleys of the Haslital. Active mountaineers and climbing freaks ascend to our SAC huts and legendary cliffs. There are varied routes available for cyclists and mountain bikers. And all those who take it easy, can ride comfortably with the cable cars to our peaks and enjoy the unique panoramic view. Do not miss the attractive events around customs, culture, and sports. Do you know that the Haslital lies on the main watershed of Europe? Bubbling mountain streams, silent mountain lakes, mighty glaciers, fierce waterfalls, and the purest springs are constant companions on your discoveries. We are all enthusiastically committed to bringing you closer to our alpine, pristine, and beautiful landscape with its diverse activities. We are happy to be there for you for a personal consultation. We wish you a memorable stay Your Haslital Tourism Team 1 General information ............................................................................................................................................ 5 Opening hours ..................................................................................................................................................... -

Kanton Bern Auszug Aus Dem Protokoll Canton De Berne J,Es Reglerungsrates Extrait Du Procès-Verbal Du Conseil-Exécutif
Kanton Bern Auszug aus dem Protokoll Canton de Berne j,es Reglerungsrates Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif 6. Juni 2012 BVE Amt für Wasser und Abfall (AWA); Gemeinde Innertkirchen, Wasserkraftrecht Nr. 16101, Aare und Zuflüsse 0 8 17 Projekt 2010 - KWOplus - Vergrösserung Grimselsee Anpassung und Ergänzung der Gesamtkonzession vom 12. Januar 1962 A SACHVERHALT 1 Gesuchstellerin / Konzessionärin ^>s>CM Kraftwerke Oberhasli AG (KWO), Grimselstrasse 19, 3862 Innertkirchen 2 Ausgangslage und Projektbeschrieb 2.1 Konzession Gesamtkonzession vom 12. Januar 1962 der Kraftwerke Oberhasli AG für die Ausnüt zung der Wasserkräfte der Aare von ihrem Ursprung bis Innertkirchen, samt aller ihrer Zuflüsse im Oberhasli bis und mit dem Gadmerwasser, in den Gemeinden Guttannen, Innertkirchen, Gadmen und Hasliberg (im Folgenden Gesamtkonzession genannt). 2.2 Gesuch Anpassung und Ergänzung der Gesamtkonzession für die Vergrösserung des Stau volumens des Grimselsees um 75 Mio. m^ auf insgesamt 170 Mio. m^ mit Anheben des Stauspiegels um 23 m auf 1931.74 m ü.M. 2.3 Bauliche Vorkehrungen (Bauvorhaben) Sanierung und Erhöhung der beiden Talsperren Spitallamm und Seeuferegg, kleinere Anpassungen an den Triebwassersystemen der Kraftwerke Grimsel 1 und 2 sowie Massnahmen gegen die Veriandung des Sees. 3 Publikation und Auflage 3.1 Publikation: - Amtsblatt des Kantons Bern vom 9. März 2011 - Anzeiger Oberhasli vom 11. März 2011 3.2 Auflage: Gemeindeverwaltungen Innertkirchen, Guttannen und Gadmen sowie Amt für Wasser und Abfall, vom 9. März bis und -

Grimsel Hospiz Over Lake Grimsel V 2.5H Triftbahn T Y 1.5H Innertkirchen E N Parking Subject to Charges and Across Beautiful Moorland to Oberaar
Grimsel Experience Grimsel english Welcome to Lucerne/Zurich/Basel Grimsel hotels Excursion tips Tourist centre For detailed information on the walking possibilities in Grimselwelt, #Grimselwelt take a look at www.grimselwelt.ch/en/experience Visitor centre / Tour of the rimselwelt – a world of mountains and glaciers, with bizarre Engstlenalp Spitallamm construction site Ggranite rocks, gorges, alpine meadows and deep valleys. And 1835 m Lake Titlis a world of water, waterfalls and lakes. In 1925, KWO, Kraftwerke Engstlen 3259 m Camping site Oberhasli AG, started to use this abundance of water for electricity. The Lake Gelmer first dam was built on the Grimsel. At the time, it was the largest in the Take the Gelmer funicular railway up to 1,860 metres above sea level to e y BBQ site the crystal blue Lake Gelmer. Two-hour mountain hike around the lake world. Over the decades, a gigantic system of power plant caverns and l l Brünigpass a or walk on the dam wall near the summit station. Round it all off with a tunnels has been created under the granite rocks – a marvel of technol- V 6-8h l PostBus/Engstlenalp Bus culinary treat in the Hotel and Nature Resort Handeck – can be reached ogy in the midst of powerful nature. Immerse yourself in this exciting H a a t Via ferrata on foot using the Handeck suspension bridge. world of contrasts. s n 3h l e Mountain railway In addition, a really lovely walk leads from Lake Gelmer into the Diechter- G Berghaus Tälli i 1726 m bach valley, where the steep ascent leads to the SAC Gelmerhütte. -

Didaktische Analyse „Stromlandschaft Grimsel“ Autorin: Michelle Walz Einordnung BAFU-Typologie: Hochgebirgslandschaft Der Alpen/Steile Berglandschaft Der Nordalpen
Didaktische Analyse „Stromlandschaft Grimsel“ Autorin: Michelle Walz Einordnung BAFU-Typologie: Hochgebirgslandschaft der Alpen/Steile Berglandschaft der Nordalpen. Der Titel „Stromlandschaft Grimsel“ bezieht sich sowohl auf die dort betriebenen Wasserkraftanlagen und die Stromproduktion als auch auf die Verkehrs- und Touristenströme sowie die Gletscher (Eisströme). Alle „Stromarten“ prägen die Grimsellandschaft. Mit der Typlandschaft Grimsel können die SuS eine Berg- und Hochgebirgslandschaft untersuchen und kennen lernen, die trotz ihrer eigentlich unwirtlichen Lage stark ge- nutzt wird. U.a. werden in dieser Unterrichtseinheit die Themen Gletscher und Wasserkraft behandelt und ein Fokus auf Raumnutzung, Landschaftswandel, Landschaftswahrnehmung sowie Landschafts- und Naturschutz ge- legt. Die „Stromlandschaft Grimsel“ verläuft in dieser Unterrichtseinheit entlang der Strecke von Innertkirchen über Guttannen bis auf den Grimselpass sowie weiter Richtung Westen über die Aaregletscher bis zum Finster- aarhorn (Abb.1). Abb. 1 Begrenzung Stromlandschaft Grimsel (swisstopo.public.geo.admin, 2017) In dieser Unterrichtseinheit liegt der Methodenschwerpunkt auf der Arbeit mit Bildern (speziell Luft- und Satel- litenbildern). Das Medium „Bild“ ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit dem Raum „Stromland- schaft Grimsel“ sowie der Raumnutzung, der Landschaftswahrnehmung, dem Landschaftswandel und dem Landschafts- und Naturschutz. → vgl. 6. 6. Didaktisches Konzept „Stromlandschaft Grimsel“ Didaktische Analyse in Form der „didaktischen Rekonstruktion“