Helmut Eder Komponist Und Dirigent
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

DMAA Portfolio DMID Presskit.Pdf
DELUGAN MEISSL ASSOCIATED ARCHITECTS DMID 5/2020 Projects Office profile DELUGAN MEISSL ASSOCIATED ARCHITECTS DMID DELUGAN MEISSL INDEX DMID p. 5/56 ASSOCIATED ARCHITECTS PROJECTS INDUSTRIAL IYON 06 DESIGN TENDO 10 TEELA 12 HEWI RANGE 120 16 SERPENTE 22 PEACOCK 26 OPETZ FRUIT BOWL 28 OLIVIO FLORACION 32 4608 FRUIT BOWL 36 SOLO 40 BODYBED 42 OFFICE PROFILE OFFICE PROFILE 48 PROJECT SELECTION 50 AWARDS 52 PUBLICATIONS 54 DELUGAN MEISSL IYON DMID p. 7/56 ASSOCIATED ARCHITECTS IYON Category Industrial design Title ‘LED spot light series’ Available since 2011 Product line IYON S - Compact LED spotlights IYON M - High-power LED spotlights IYON-SL S - Compact recessed LED spotlights for ceiling installation IYON-SL M - High-power recessed LED spotlights for ceiling installation Materials housing made of high pressure die-cast aluminium Awards German Design Award 2013 design plus Award 2012 IF Product Design Award 2012 Reddot Design Award 2012 Good Design Award 2012 Manufacturer Zumtobel Lighting GmbH Project manager Christian Schrepfer Project team Claudia Schiedt Project Description „The symbiosis of precisely focussed lighting and proportion as parameters of design affects the sensual perception and determines at the same time the physiological feeling of space quality.“ The interpretation of an infinitely adjustable light source with a slender form describes the IYON light. The flowing interaction of object and medium unfolds sensuality and high functionality in one quality lighting solution. Changeable lighting effects, flexible spatial positioning, and LED optical performance gives IYON the choice of numerous internal spaces. The matt finish of the recessed luminary integrates the lighting unit to blend into its chosen location. -

Mass in C Minor Performances of Two Academy of St Martin Fine Choral Works from in the Fields Two Masters of the Baroque Era
CORO CORO Vivaldi: Gloria in D Fauré: Requiem Bach: Magnificat in D Mozart: Vespers Harry Christophers Elin Manahan Thomas MOZART The Sixteen Roderick Williams Harry Christophers Resounding The Sixteen Mass in C minor performances of two Academy of St Martin fine choral works from in the Fields two masters of the Baroque era. “…the sense of an ecstatic movement towards cor16057 cor16042 cor16057 Paradise is tangible.” the times Handel: Messiah Barber: Agnus Dei 3 CDs (Special Edition) An American Collection Carolyn Sampson Barber, Bernstein, Catherine Wyn-Rogers Copland, Fine, Reich, Mark Padmore del Tredici Christopher Purves “The Sixteen are, as “…this inspiriting new usual, in excellent form performance becomes here. Recording and a first choice.” remastering are top- notch.” Gillian Keith the daily telegraph notch.” cor16062 cor16031 american record guide Tove Dahlberg Harry Christophers Thomas Cooley To find out more about CORO and to buy CDs visit Handel and Haydn Society Nathan Berg www.thesixteen.com cor16084 ne of the many delights of being of your seat” suspense that one feels in the exquisite ‘Et incarnatus est’ and it OArtistic Director of America’s is well worth that risk. One can never achieve this degree of concentration and oldest continuously performing arts total immersion in the music whilst in the recording studio; whatever mood is organization, the Handel and Haydn set, subconsciously we always know we can have another go at it. Society, is that I am given the opportunity to present most of our concert season at I feel very privileged to take this august Society towards its Bicentennial; yes, the Handel and Haydn Society was founded in 1815. -

Juillet 2012 Nouveautés – New Arrivals July 2012
Juillet 2012 Nouveautés – New Arrivals July 2012 ISBN: 9780521837491 (hbk.) ISBN: 9780521145916 (pbk.) ISBN: 0521145910 (pbk.) Personal Author: Isidore, of Seville, Saint, d. 636. Title: The Etymologies of Isidore of Seville / Stephen A. Barney ... [et al.] ; with the collaboration of Muriel Hall. Publication info: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. Physical description: xii, 476 p. ; 24 cm. Bibliography note: Includes bibliographical references and index. Language: Translated from the Latin. AE 2 I833I75 2010 ISBN: 9782130580560 (br) ISBN: 2130580564 (br) Title: Voyages inédits dans la pensée contemporaine / sous la direction de Yves Charles Zarka ; coordination Isabelle Eon et Cristina Ion. Publication info: Paris : Presses Universitaires de France, 2010. Physical description: 497 p. ; 24 cm. Series: (Cités : philosophie, politique, histoire ; Hors Série) Bibliography note: Comprend des références bibliographiques. B 2 C581 2010 ISBN: 9781889680866 ISBN: 1889680869 Title: Philosophy and language / edited by R. Edward Houser, Thomas Osborne. Publication info: Houston, TX : Issued by the National Office of the American Catholic Philosophical Association, University of Saint Thomas ; Charlottesville, VA : Published by the Philosophy Documentation Center, c2011. Physical description: 312 p. ; 23 cm. Series Title: (Proceedings of the American Catholic Philosophical Association ; v. 84) General Note: Annual supplement to the American Catholic philosophical quarterly. Bibliography note: Includes bibliographical references. Contents: Al-Fârâbî: an Arabic account of the origin of language and of philosophical vocabulary / Thérèse-Anne Druart -- Presentation of the Aquinas Medal / Mark C. Murphy -- Aquinas Medalist's Address. On being a theistic philosopher in a secularized culture / Alasdair MacIntyre -- Towards an explanation of language / Daniel O. Dahlstrom -- Language and philosophy in the Essays of Montaigne / Ann Hartle -- William of Ockham and St. -
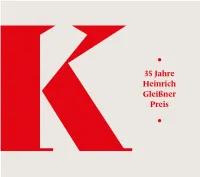
HG-Preis 240X210 WEB Kl
35 Jahre Heinrich Gleißner Preis Herausgegeben von Elisabeth Manhal und Josef Pühringer 35 Jahre Heinrich Gleißner Preis Lobreden 1985–2019 35 Jahre Heinrich-Gleißner-Preis Vorworte .......................................................... 5 2000 Fritz Fröhlich, Maler .................................... 105 2019 Hans Eichhorn, Schriftsteller ............................. 9 1999 Käthe Recheis, Autorin ................................. 112 1998 Erwin Reiter, Bildhauer . 123 Herausgeber: Elisabeth Manhal und Josef Pühringer 2018 Therese Eisenmann, Malerin und Grafikerin .......... 14 Medieninhaber: Kulturverein Heinrich-Gleißner-Haus, Obere Donaulände 7, 4010 Linz 2017 Maximilian Rudolf Luger & Franz Josef Maul, 1997 Fridolin Dallinger, Komponist ......................... 130 Gestaltung, Satz und Projektbegleitung: FORMDENKER, Linz Architekten ................................................ 18 1996 Roland Ertl, Architekt .................................. 137 Lektorat: Alfred Pittertschatscher, Doris Staudinger 2016 Michi Gaigg, Dirigentin .................................. 23 1995 Peter Kubovsky, Maler .................................. 142 Hersteller: Kontext Druck, Linz 2 2015 Margit Schreiner, Schriftstellerin . 27 1994 Alois Brandstetter, Autor ............................... 148 3 Verlags- und Herstellungsort Linz 2014 Maria Moser, bildende Künstlerin ....................... 31 1993 Balduin Sulzer, Komponist ............................. 154 Erste Auflage: 2020 2013 Andreas Gruber, Drehbuchautor und Regisseur ....... 34 1992 Rudolf -

Tradition Meets the Future
400Jubilee magazine commemorating years the 400th anniversary of Stanglwirt Tradition meets the future 1609-2009 The Family The Guests 400 years of hospitality Hosts with hearts: Behind the Those who come to Stanglwirt and at Stanglwirt scenes of the Stanglwirt family who come back time and time again Juwelier Rüschenbeck and A. Lange & Söhne congratulate Stanglwirt on its 400 year anniversary This Lange watch was made in the traditional way. With lots of ingenuity. The DATOGRAPH PERPETUAL represents the state of the art in long-standing Lange tradition to enrich horology with useful refinements. micromechanical engineering. It features a proprietary escapement and So is the painstaking manual decoration of every single part. The outcome a newly designed perpetual calendar. Lange’s masters invested many is a masterpiece “Made in Germany” that is available only from the world’s months researching, testing, rethinking and improving it. After all, it is a finest watch and jewellery dealers. For instance from Rüschenbeck. The DATOGRAPH PERPETUAL. Available at: Westenhellweg 45, Dortmund, Tel. 0231/915300 • Börsenstrasse 2–4, Frankfurt, Tel. 069/1338740 Schildergasse 105, Köln, Tel. 0221/2578391 • CentrO.-Allee 199, Oberhausen, Tel. 0208/807000 • www.rueschenbeck.de We fi nance leading-edge technologies! Innovative companies from Austria and Germany are set- Today, MIG Fonds fi nances these leading-edge tech- ting new standards around the world in many leading- nologies from Austria and Germany for tomorrow’s glo- edge technologies. Growing markets -

Helmut Eder Werke Bei / Music Published by D Doblinger Inhalt / Contents
Helmut Eder Werke bei / Music published by d Doblinger Inhalt / Contents Biographie ................................................ 3 Ensemble ............................................. 14 Biography ................................................. 4 Streichinstrument(e) und Orchester / String instrument(s) and orchestra .... 15 Blasinstrument(e) und Orchester / Werke bei / Music published by Doblinger Wind instrument(s) and orchestra ...... 16 INSTRUMENTALWERKE / Tasteninstrument und Orchester / INSTRUMENTAL WORKS Key instrument and orchestra ............ 16 Klavier / Piano .................................... 7 Streichorchester / String orchestra ..... 18 Cembalo / Harpsichord ...................... 7 Kammerorchester / Chamber orchestra 18 Orgel / Organ ..................................... 7 Orchester / Orchestra ........................ 19 Flöte / Flute ........................................ 8 Streichinstrument und Klavier / VOKALWERKE / VOCAL WORKS String instrument and piano ............... 8 Gesang und Klavier / Blasinstrument(e) und Klavier / Singing voice and piano ..................... 22 Wind instrument(s) and piano ........... 9 Gesang und Orchester / Kammermusik für Streichinstrumente (mit Klavier) / Chamber music for string Singing voice and orchestra .............. 22 instruments (with piano) .................... 9 Gemischter Chor a cappella / Kammermusik für Streichinstrumente Choral works a cappella .................... 23 (ohne Klavier) / Chamber music for Chor und Orchester / string instruments (without piano) -

Helmut Rogl Keine Sorgen Fantasie
Helmut Rogl Additionally, Rogl is open towards electronic music: Especially his collaboration with Manfred Pilsz resulted in Born in Enns (Upper Austria) in 1960, Helmut Rogl a multi-award winning series of music videos. In 2005, had piano lessons from an early age. Following frst he was responsible for the sound design of the project compositions as an autodidact, he then started studying “Heartbeat” at the Ars Electronica festival. Dr Ertlbauer- composition at what was at the time the Bruckner Camerer concludes in her laudation: “With new genres like Conservatory in Linz, learning from Helmut Schif and music videos, electronic music and sound installations, Rogl Gunter Waldek. Later, he studied at the “Mozarteum” in conquers a new type of audience outside the traditionally Salzburg with Helmut Eder. Parallel to his music studies, narrow circle of classical music lovers. In order to broaden he studied business at the Johannes Kepler University in the acceptance of classical music, he treats ‘his’ audience Linz and received his PhD, thus now living a dual view of with respect and attentive interest. For him, it is more the world between arts and business or avocation and important to impress and to enchant them rather than to profession. provoke or shock.” He was awarded the “Talentförderungspreis” of the federal state of Upper Austria in 1984, the cultural prize of the city of Linz in 1989 and the same city’s cultural medal in 1999 Keine Sorgen Fantasie as well as the “Landeskulturpreis” of Upper Austria in 2001. This work happily combines Helmut Rogl’s two worlds: Dr Alice Ertlbauer-Camerer wrote in her laudation for that: business and music. -

Kunst-Und Kulturbericht Frauenkulturbericht Der Stadt Wien
KUNST- UND KULTURBERICHT DER STADT WIEN 2000 HERAUSGEGEBEN VON DER GESCHÄFTSGRUPPE KULTUR UND WISSENSCHAFT DES MAGISTRATS DER STADT WIEN AMTSFÜHRENDER STADTRAT FÜR KULTUR DR. ANDREAS MAILATH -POKORNY ª 2001 Magistrat der Stadt Wien Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Bernhard Denscher (MA 7) Dr. Ferdinand Opll (MA 8) Dr. Walter Obermaier (MA 9) Dr. Günter Düriegl (MA 10) Wolfgang Wais (Wiener Festwochen) Dr. Gerald Matt (Kunsthalle Wien) Dr. Peter Zawrel (Wiener Filmfonds) Dr. Karl Albrecht -Weinberger (Jüdisches Museum der Stadt Wien) Cover: Mahnmal - Museum Judenplatz Grafik: Mag. Anna-Maria Friedl Druck: A. Holzhausens Nachf., A-1140 Wien Bezugsadresse: MA 7 - Kulturabteilung Friedrich Schmidt -Platz 5 A - 1082 Wien e-mail: [email protected] http://www.wien.gv.at/ma07/ INHALT VORWORT KULTURABTEILUNG DER STADT WIEN (MA 7) Musik Theater Literatur Bildende Kunst Kunsthalle Wien Alltagskultur Altstadterhaltung und Denkmalpflege Bezirksmuseen Ehrungen Interkulturelle Aktivitäten Stipendien Film und Video Wiener Filmfinanzierungsfonds Wiener Festwochen Beratungsstelle für Kulturarbeit WIENER STADT- UND LANDESARCHIV (MA 8) WIENER STADT- UND LANDESBIBLIOTHEK (MA 9) MUSEEN DER STADT WIEN (MA 10) Jüdisches Museum der Stadt Wien VORWORT Der Kunst- und Kulturbericht für das Jahr 2000 gilt einem Zeitraum, der noch die vergangene Legislaturperiode umfasst. Das Wiener Kulturleben hat in dieser Zeit eine gute Entwicklung genommen, zu der sicherlich auch eine gute Zusammenarbeit in der Stadtregierung wesentlich beigetragen hat. Meinem Vorgänger -

GERMAN & AUSTRIAN SYMPHONIES from the 19Th
GERMAN & AUSTRIAN SYMPHONIES From The 19th Century To The Present Composers other than Beethoven, Brahms, Bruckner, Mahler, Mendelssohn, Schubert & Schumann A Discography of CDs and LPs Prepared by Michael Herman Composers A-L JOHANN JOSEPH ABERT (1832-1915) A Sudeten German, he was born in Kochowitz, Bohemia (now Kochovice, Czech Republic). He studied double bass at the Prague Conservatory with Josef Hrabe and also received lessons in theory from Johann Friedrich Kittl and August Wilhelm Ambros. He became a double bassist for the Court Orchestra at Stuttgart and later was appointed Kapellmeister. He composed orchestral and chamber works as well as lieder and several successful operas. His unrecorded Symphonies are: Nos. 1 in B minor (1852), 2 in C minor (1854), 3 in A major (1856), 5 in C minor (1870), 6 in D minor "Lyric Symphony" (1890) and 7 in C major "Spring Symphony" (1894). Symphony No. 4 in D major, Op. 31 "Columbus, A Musical Portrait of the Sea in the Form of a Symphony" (1863) Werner Stiefel/Bohuslav Martinu Philharmonic Orchestra ( + Concerto for Double Bass and Variations for Double Bass and Orchestra) BAYER RECORDS 100160 (1996) AUGUST RITTER VON ADELBURG (1830-1873) Born in Pera, Turkey. The son of a diplomat, he spent his early years in Istanbul before going to Vienna to study music with Joseph Mayseder for violin and with Hoffmann for composition. He then toured Europe as a violinist. He later returned to Istanbul where he played the violin before the Sultan to whom he dedicated this Symphony. He mostly composed operas, chamber, instrumental and vocal works. -

Ernst Kovacic Biography Violin / Conductor
Ernst Kovacic Biography Violin / Conductor Ikon Arts Management Ltd Suite 114, Business Design Centre “‘One of the most creative and accomplished 52 Upper Street, London N1 0QH violinists worldwide” The Sunday Times t: +44 (0)20 7354 9199 f: +44 (0)870 130 9646 Website www.ernstkovacic.com [email protected] Contact Costa Peristianis www.ikonarts.com Email [email protected] Vienna, with its fruitful tension between tradition and innovation, inspires the Austrian violinist and conductor Ernst Kovacic. Ernst Kovacic is a leading performer throughout Europe and the USA. His recent guest engagements include appearances with the Vienna Philharmonic and Vienna Symphony, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Czech Philharmonic, Prague Symphony, Detroit Symphony, Budapest Symphony, Netherlands Radio Philharmonic, Tivoli Symphony and the Radio Symphony Orchestras of Berlin, Bayerischer Rundfunk, Sudwestfunk, Hessischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk and the Konzerthausorchester Berlin among many others. Ernst makes frequent international festival appearances. He gave a critically-acclaimed performance of the Schoenberg Violin Concerto at the BBC Proms and has appeared at the Edinburgh Festival, the major festivals of Berlin, Vienna and Salzburg, as well as the Ultima Oslo and Prague Autumn Festivals. Increasingly busy as a conductor, Ernst has been the artistic director of the Leopoldinum Chamber Orchesta in Wroclaw, Poland since 2007. He has directed the Scottish Chamber Orchestra, Ulster Orchestra, Northern Sinfonia, Camerata Salzburg, Deutsche Kammerphilharmonie, Klangforum, Ensemble Modern, Stuttgart Chamber Orchestra, Camerata Bern, Camerata Nordica, Zagreb Philharmonic and the Taipei Symphony Orchestra. He has also toured Japan conducting the Vienna Chamber Orchestra, of which he was Artistic Director from 1996 to 1998. Ernst’s repertory is prodigious and includes all the major works for violin of the baroque, classical and romantic periods. -

Doblinger Information
F Doblinger Information Helmut Eder QUINTETT für Klavier und Streichquartett op. 97 (1992-94) Aufführungsdauer: 16 Min. Kaufausgabe in Vorbereitung (Best.Nr. 07 265 - Partitur und Stimmen) Uraufführung: 20. August 1994, Salzburg, Großer Saal des Mozarteums - Salzburger Festspiele Paul Gulda (Klavier), Hagen-Quartett ZUM WERK: Die konzeptionelle Idee besteht im Erwirken höchstmöglicher Gegensätzlichkeiten innerhalb von vier Satzteilen, wobei eine Intervallkonstruktion in freier Handhabung die „innere“ Verklammerung herzu- stellen hat. Das Notenbild liefert diesbezüglich „rein optisch“ erste Auskunft, das Klangergebnis soll akustisch dieses formbildende Wollen weitergeben. Hörzwänge, wie sie heute gerne durch mehr oder weniger geglückte „poetische Ausdrucksbezeichnungen“ oder gar „Programme“ beliebt sind, fehlen. Auch Richtlinien, Direktiven oder emotionale Bedrängung durch Satztitel gibt es nicht; die Empfindun- gen und geistig- bzw. musikalisch-bildlichen Vorstellungen soll der Zuhörer und Interpret selbst durch nachschöpferisches Wollen erleben. Einige „Randbemerkungen“ zu Form und Inhalt: Anfang und dritter Teil sind in lyrisch-ruhig-sanftmüti- gem Duktus erdacht, trotzdem sehr konträr, eigenwillig in den flexiblen Schichten und Linienzügen, und es soll bei der Reflexion ein gewisser imaginärer Schwebezustand ausgelöst werden, als Indiz für bewegende Seelenbekenntnisse. Die Sätze 2 und 4 wiederum setzen sich gewaltig ab. Durch eine stürmisch-variable Metrik-Motorik wird merkbar das thematisch lineare Material bloßgelegt, wobei teilweise schlagzeugartige Attacken des Klaviers die Metrikgliederung vorwärtstreibt. Im Schlußsatz ist das Repetitionsprinzip in den Streichern vorrangig, das Klavier kontrapunktiert fast ausschließlich durch zerlegte Klangpassagen. Immer mehr wird das Tonrepetitionsprinzip der Streicher „gebrochen“, wobei in der Schlußstretta durch die „accell. ad libitum“-Anweisung ein „Chaos“ heraufbeschworen wird, das schlußendlich plötzlich abbricht. Helmut Eder HELMUT EDER: Geboren am 26. -

Ganzseitiger Faxausdruck
hänssler CLASSIC Hänssler Verlag GmbH & Co. KG Max-Eyth-Str.41 71088 Holzgerlingen Germany Order/Bestellung: Tel: +49 7031 7414-177 Fax: +49 7031 7414-119 E-Mail: [email protected] Contents Inhalt Introduction hänssler CLASSIC 2 Einführung hänssler CLASSIC Highlights Highlights aus unserem of Our Classical Program 4 Klassikprogramm Introduction Einführung Internationale Bachakademie 6 Internationale Bachakademie Introduction SWRmusic 10 Einführung SWRmusic CD-Catalog CD-Katalog Composers A–Z 14 Komponisten A–Z Compilations 136 Anthologien DVD 177 DVD Editions 180 Editionen More Information Weitere Informationen Artist Portraits 186 Künstler-Porträts J. S. Bach – BWV-Index 200 J. S. Bach – BWV-Index Index of Composers 216 Komponistenverzeichnis Index of Artists 222 Künstlerverzeichnis Index of Order Numbers 234 Bestellnummernverzeichnis Our Distributors Worldwide 238 Vertriebsverzeichnis www.haenssler-classic.de [email protected] 1 hänssler CLASSIC Dear Music-Lover! Lieber Musikfreund, I am happy to be able to present to you ich freue mich sehr, Ihnen das aktuelle Ge- hänssler CLASSIC’s current complete samtprogramm von hänssler CLASSIC zu program. With its more than 700 recor- präsentieren. Mit mehr als 700 Aufnahmen dings, hänssler CLASSIC counts as one of gehört hänssler CLASSIC zu den renom- the renowned major independent recor- mierten und großen unabhängigen Ton- ding companies. We do business interna- träger-Firmen. Von Deutschland aus sind tionally from our headquarters in Germany wir international tätig und einem großen and serve a large audience. To achieve the Publikum verpflichtet. Höchste Qualität zu highest quality, both in terms of artists as erreichen, sowohl in Hinblick auf die well as recording and production, is at Künstler als auch bei Aufnahme und Ferti- once a motivation and a challenge for us.