Dongo, Gravedona Und Sorico Am Comer-See
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
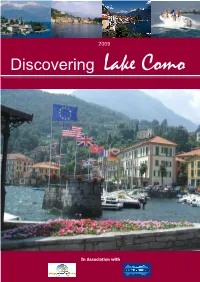
Discovering Lake Como
2009 Discovering Lake Como In Association with Welcome to Lake Como Homes About our Company Lake Como Homes in and can provide helpful Lake Como FREE conjunction with our partners assistance whatever your Advantage Card with every Happy Holiday Homes are now needs. rental booking! established as the leading property management and The Happy Holiday Homes letting company covering Lake team is here to assist you in Como. having a memorable holiday Advantage Card 2009 experience in one of the most Lake Como We are proud to offer a fully beautiful Lakes in the world. comprehensive service to our www.happyholidayhomes.net +39 0344 31723 customers and are equally Try our Happy Service which delighted in being able to offer specialises in sourcing our clients a wide and diverse exceptional good value deals on selection of holiday homes local events and activities and from contemporary studio passing the savings directly apartments to Luxurious onto you. This represents a discount to modern and period style Villas. many of the attractions and We thank you in selecting Lake Eateries about the lake. Happy Holiday Homes, based Como Homes and Happy in Menaggio have an Holiday Homes for your holiday enthusiastic multi-lingual team in the Italian Lakes. providing a personal service Happy Holiday Homes©, Via IV Novembre 39, 22017, Menaggio, Lake Como – www.happyholidayhomes.net - Tel: +39 034431723 Beauty in every sense of the word The Lake is shaped rather like an inverted 'Y', with two 'legs' starting at Como in the South- West and Lecco in the South-East, which join together half way up and the lake continues up to Colico in the North. -

From Brunate to Monte Piatto Easy Trail Along the Mountain Side , East from Como
1 From Brunate to Monte Piatto Easy trail along the mountain side , east from Como. From Torno it is possible to get back to Como by boat all year round. ITINERARY: Brunate - Monte Piatto - Torno WALKING TIME: 2hrs 30min ASCENT: almost none DESCENT: 400m DIFFICULTY: Easy. The path is mainly flat. The last section is a stepped mule track downhill, but the first section of the path is rather rugged. Not recommended in bad weather. TRAIL SIGNS: Signs to “Montepiatto” all along the trail CONNECTIONS: To Brunate Funicular from Como, Piazza De Gasperi every 30 minutes From Torno to Como boats and buses no. C30/31/32 ROUTE: From the lakeside road Lungo Lario Trieste in Como you can reach Brunate by funicular. The tram-like vehicle shuffles between the lake and the mountain village in 8 minutes. At the top station walk down the steps to turn right along via Roma. Here you can see lots of charming buildings dating back to the early 20th century, the golden era for Brunate’s tourism, like Villa Pirotta (Federico Frigerio, 1902) or the fountain called “Tre Fontane” with a Campari advertising bas-relief of the 30es. Turn left to follow via Nidrino, and pass by the Chalet Sonzogno (1902). Do not follow via Monte Rosa but instead walk down to the sportscentre. At the end of the football pitch follow the track on the right marked as “Strada Regia.” The trail slowly works its way down to the Monti di Blevio . Ignore the “Strada Regia” which leads to Capovico but continue straight along the flat path until you reach Monti di Sorto . -

Dicembre 2015 - Registr
ilPERIODICO DI INFORMAZIONEPioverna DELLA VALSASSINA, del LAGO, delle VALLI, Esino e il Varrone new COPIA OMAGGIO SCEGLI CHI HA GRANDI CAPACITÀ. DA 2,8 m3 a 17 m3 DA 2,49 m a 4,07 m DA 1,04 m a 1,42 m DA 660 Kg a 1,9 t DI VOLUME UTILE DI LUNGHEZZA UTILE DI LARGHEZZA UTILE DI CARICO UTILE TRA I PASSARUOTA NUOVO CITROËN NEMO CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER I VEICOLI COMMERCIALI CITROËN SODDISFANO QUALSIASI ESIGENZA DI LAVORO, CARICO E MOTORIZZAZIONE. UN’AMPIA GAMMA DALLA QUALE PUOI SCEGLIERE IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE NECESSITÀ. TI ASPETTIAMO XXXXXXXXXXXXXXX. A PROVARLI! citroen.it Le foto sono inserite a titolo informativo. VIA ROMA 110 PESCATE TEL. 0341.282889 IGINIO NEGRIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.R.L. PONTE A. VISCONTI 30 LECCO - TEL. 0341.364141 [email protected] 1 14/07/15 12:25 SOMMARIO SOMMARIO SOMMARIO ilPERIODICO DI INFORMAZIONEPioverna DELLA VALSASSINA, del LAGO, delle VALLI, Esino e il Varrone SOMMARIO new ✓SPECIALE NATALE 3 ✓VALSASSIINA IIN NATURA Fiumelatte, il più corto d'Italia. E il più misterioso! 14 ✓ITIINERARI - OUTDOOR Ice climbing - Cascate da scalare 18 Alla scoperta della Valsassina sulle pelli di foca 22 Gigi Alippi 26 La Valsassina nel pro-fondo 28 ✓PERSONAGGI DA RICORDARE Carlo Beri, quei suoi valori e un incondizionato amore per la sua terra 30 ✓LAVORO TRA VALLE E LAGO Dall'Antica Fonte di Tartavalle sgorga birra 32 Da Premana "La Mia Birra" per tutti! 35 "L'Oro" verde del lago 38 Biosio il frantoio più a Nord d'Europa 41 ✓ ARTE / CULTURA Museo di Premana: uno scrigno di storia e tradizione 44 ✓ VALSASSIINA CON GUSTO Agriturismo Cascina Trote Blu: sapori e natura, fanno tappa a Primaluna 48 Lo Chef consiglia 50 ✓ACCADEVA NELL’’ANNO Cremeno: il ponte della Vittoria compie 90 anni 53 ✓LA VALLE IERIIERI E OGGI 54 ✓PROVERBI 56 ✓SOMMARIOEVENTII 59 SOMMARIO SOMMARIO SOMMARIO ✓EDITORIALE Numero zero, un successo! ilPERIODICO DI INFORMAZIONEPioverna DELLA VALSASSINA, DEL LAGO, DELLE VALLI, ESINO E IL VARRONE new Nuovo Pioverna seconda uscita. -

Assegnazione Sede ADMM Da GPS Incrociate
Assegnazione sedi Nomine a Tempo Determinato ADMM da GPS Posizion Puntegg Fascia Cognome Nome Sede Assegnata e io 3 1 273 VANOSSI DANIELA Rinuncia 3 2 258 MUSUMECI BENEDETTA Rinuncia 3 3 243 COLLINA ILARIA Rinuncia 3 4 198 CHICCO RICCARDO Rinuncia 3 5 192,5 MAURI CRISTINA Rinuncia 3 6 191 PERSICO DANIELA Rinuncia 3 7 153 GUZZETTI MONICA Rinuncia 3 8 152 BIANCHI MARIA Rinuncia 3 9 151 CRISTALDI ANGELA Rinuncia 3 10 143 FRIGERIO ALESSANDRA Rinuncia 3 11 136 COLOMBO LAURA Rinuncia 3 12 131 FARINA ALESSANDRA Rinuncia 3 13 125 MARIATTI CAMILLA Rinuncia 3 14 122 VIRGILLITO CINZIA MARIA CONCETTA Rinuncia 3 15 121 BUMBACA LEONARDO Rinuncia 3 16 120,5 TAGLIABUE NICOLA Rinuncia 3 17 116,5 GIANNETTO GIUSEPPE Rinuncia 3 18 114 GIORGIO ANTONIO Rinuncia 3 19 104 IAPICHINO LUIGI Rinuncia 3 20 102 CONCAS SILVIA Rinuncia 3 21 97 GRILLI GIULIA Rinuncia 3 22 95 IZZO KATIA Rinuncia 3 23 93 CHIARILLO ALESSANDRA Rinuncia 3 24 93 DE PASCALIS FEDERICA Rinuncia 3 25 88 MOLINO GIULIANO Rinuncia 3 26 86 ZUBANI FRANCESCA Rinuncia 3 27 86 JUHASZ ORSOLYA Rinuncia 3 28 85 SCIBELLI MARTINA Rinuncia 3 29 82,5 ROSIGNOLI LUANA Rinuncia 3 30 81,5 GIANNONI LUCA Rinuncia 3 31 75,5 SHVETS VITALINA Rinuncia 3 32 75 MARIC KATARINA Rinuncia COMM845016 S.M.S. "FOSCOLO" COMO 3 33 74 MANAI MARIA BEATRICE BORGOVICO - Temporanea 30/06 cattedra 3 34 69 ZANGHI DANIELE LUCA Rinuncia 3 35 69 MANNINO ROBERTO Rinuncia 3 36 64,5 FIGINI MARIAGIULIA Rinuncia 3 37 63,5 VILLA MATTEO Rinuncia 3 38 63 COLACCI MANUELE Rinuncia 3 39 59 MALINVERNO BRUNELLA Rinuncia 3 40 51 MOLES FLORANNA Rinuncia 3 41 48,5 FILIPPUCCI PIETRO Rinuncia 3 42 35 BISANTI AURORA MARIA MISTICA Rinuncia 3 43 34 BATTINO ROBERTO Rinuncia COMM83501G S.M.S. -

TREKKING PROVINCIA DI COMO Settore Turismo
TREKKING PROVINCIA DI COMO Settore Turismo In futuro, il turismo attivo sarà la formula vincente per lo sviluppo turistico di qualsiasi territorio; il Lago di Como, da sempre meta di un turismo legato al lago e alla sua rilassante bellezza, intende rafforzare e ampliare la propria offerta, già interessante, in questo segmento di mercato ormai strategico. Oggigiorno numerose sono le attività sportive praticabili sul nostro territorio, dai più classici sport nautici: vela, surf, canotaggio e kitesurf, al ciclismo e al più sofisticato golf, per non parlare delle passeggiate a cavallo, ma è il Trekking che da sempre ha esercitato un particolare fascino, permettendo di scoprire antichi sentieri, vecchi cam - minamenti e, nel contempo, di ammirare paesaggi unici per bellezza del nostro territorio. Con questo intento si è realizzata la nuova edizione della guida Lago di Como - Trekking , proponendo una ver - sione aggiornata dei testi e dei punti di appoggio dei tre più collaudati itinerari a piedi della nostra zona. La Via dei Monti Lariani , che rimane lo storico percorso di trekking, di 125 km, e si snoda lungo i “monti” della sponda occidentale del Lago e da dove si godono panorami mozzafiato. La Dorsale Como Bellagio , un bellissimo percorso di 2 giorni che attraversa in verticale il “Triangolo Lariano”, cioè quel territorio compreso tra i due rami del Lago di Como. Il Sentiero delle 4 Valli , forse il meno noto dei tre ma altrettanto affascinante, soprattutto per i luoghi sorpren - dentemente incontaminati che ci propongono queste bellissime vallate. La pubblicazione della guida dei Trekking del Lago di Como ha l’intento di offrire al turista uno strumento utile per la scoperta di angoli paesaggistici della nostra zona altrimenti poco noti e una motivazione forte per prolun - garne il soggiorno in questo angolo di paradiso che è il lago di Como. -

Sentiero Del Viandante Varenna-Bellano ENG
THE FUNICULAR OF REGOLEDO Suddenly the path gets past a deep A LITHOLOGICAL The path, and large man-made wall: it is what BOUNDARY always duly remains of the funicular which, at Looking closely at the walls along marked with the beginning of the century, linked the track, you will notice that at modest mo- up the railway station to the imposing hydrotherapic place, a certain point the stones numents to the founded at Regoledo by Francesco become different from those seen popular faith, Maglia in 1858. The Grand Hotel before. At first they are greyish calcareous stones or purple red lowers toward Regoledo, as was called in those the railway times, had renowned guests among porphyries then there are very which Arturo Toscanini, Ippolito clear granitic stones (gneiss and station, gets Nievo, Amilcare Ponchielli, padre schist). The fact is that you have over a small Agostino Gemelli, Massimo D’Azeglio, got past the partition line bridge on the Antonio Stoppani, Cesare Cantù. between the sedimentary cover, typical of the foothills of the Alps dell of Biosio The strange building, very long and and goes down narrow, is now a branch of the and which was formed in the Istituto Sacra Famiglia of Cesano Triassic period (250 - 210 millions in sight now of Boscone and can be seen high up, of years ago), and that of the the Pioverna crystalline base that here dominating a wide green clearing. delta where emerges. Bellano lies. The quiet Cappella della Madonna Addolo- rata (Chapel of Our Lady of Sor- rows) comes before the junction with the provincial road 62. -

Milan and the Lakes Travel Guide
MILAN AND THE LAKES TRAVEL GUIDE Made by dk. 04. November 2009 PERSONAL GUIDES POWERED BY traveldk.com 1 Top 10 Attractions Milan and the Lakes Travel Guide Leonardo’s Last Supper The Last Supper , Leonardo da Vinci’s 1495–7 masterpiece, is a touchstone of Renaissance painting. Since the day it was finished, art students have journeyed to Milan to view the work, which takes up a refectory wall in a Dominican convent next to the church of Santa Maria delle Grazie. The 20th-century writer Aldous Huxley called it “the saddest work of art in the world”: he was referring not to the impact of the scene – the moment when Christ tells his disciples “one of you will betray me” – but to the fresco’s state of deterioration. More on Leonardo da Vinci (1452–1519) Crucifixion on Opposite Wall Top 10 Features 9 Most people spend so much time gazing at the Last Groupings Supper that they never notice the 1495 fresco by Donato 1 Leonardo was at the time studying the effects of Montorfano on the opposite wall, still rich with colour sound and physical waves. The groups of figures reflect and vivid detail. the triangular Trinity concept (with Jesus at the centre) as well as the effect of a metaphysical shock wave, Example of Ageing emanating out from Jesus and reflecting back from the 10 Montorfano’s Crucifixion was painted in true buon walls as he reveals there is a traitor in their midst. fresco , but the now barely visible kneeling figures to the sides were added later on dry plaster – the same method “Halo” of Jesus Leonardo used. -

(Siba) Decreto Ministeriale 16 Agosto 1955
Sistema informativo Beni e Ambiti Paesaggistici (S.I.B.A.) DECRETO MINISTERIALE 16 AGOSTO 1955. DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA FASCIA COSTIERA DEL LAGO DI COMO, SITA NELL'AMBITO DEI COMUNI DI COMO, CERNOBBIO, MOLTRASIO, CARATE URIO, LAGLIO, BRIENNO, ARGEGNO, COLONNO, SALA COMACINA, OSSUCCIO, LENNO, TREMEZZO, GRIANTE, MENAGGIO, SANTA MARIA REZZONICO, CREMIA, PIANELLO LARIO, MUSSO, DONGO, GRAVEDONA, DAMASO E GERA. IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI; VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA; CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COMO PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 29 MAGGIO 1953, INCLUDEVA NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA, LA FASCIA COSTIERA DEL LAGO DI COMO, SITA NELL'AMBITO DEI COMUNI DI COMO, CERNOBBIO, MOLTRASIO, CARATE URIO, LAGLIO, BRIENNO, ARGEGNO, COLONNO, SALA COMACINA, OSSUCCIO, LENNO, TREMEZZO, GRIANTE, MENAGGIO, SANTA MARIA REZZONICO, CREMIA, PIANELLO LARIO, MUSSO, DONGO, GRAVEDONA, DAMASO E GERA; CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDDETTA COMMISSIONE E' STATO PUBBLICATO AI SENSI DEL CITATO ART. 2 DELLA LEGGE SULLE BELLEZZE NATURALI, PER UN PERIODO DI TRE MESI ALL'ALBO DEI COMUNI DI COMO, CERNOBBIO, MOLTRASIO, CARATE URIO, LAGLIO, BRIENNO, ARGEGNO, COLONNO, SALA COMACINA, OSSUCCIO, LENNO, TREMEZZO, GRIANTE, MENAGGIO, SANTA MARIA REZZONICO, CREMIA, PIANELLO LARIO, MUSSO, DONGO, GRAVEDONA, DAMASO E GERA; VISTE LE OPPOSIZIONI PRODOTTE DALLA SOCIETA' ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK, DAL SIG. SORMANI AMOS, DA UN GRUPPO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BRIENNO, DAL COMUNE DI COLONNO, DAL SIG. -

Allegato 1: ELENCO PRINCIPALI LAVORI SVOLTI
Allegato 1 : ELENCO PRINCIPALI LAVORI SVOLTI GMG INGEGNERI ASSOCIATI Lavori pubblici: progettazione / direzione lavori opere edili 2013/2014 - Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio - Gravedona ed Uniti (CO): progettazione esecutiva per il Completamento, recupero e valorizzazione Giardino del Merlo - riordino, messa in sicurezza e realizzazione percorsi di avvicinamento - 1° lotto 2013 - Unione dei comuni della Valvarrone: progettazione preliminare e definitiva per la Ristrutturazione e riqualificazione energetica del Centro Scolastico Valvarrone 2011/2012 - Comune di Dongo: progettazione e direzione lavori delle opere di collettamento fognatura al depuratore di Gravedona: opere in comune di Dongo, località Ponaga e Palazzetta - ing. Virgilio Matteri 2010 - Comune di Stazzona: progettazione e direzione lavori della costruzione di autorimesse interrate in località Cassia - ing. Virgilio Matteri 2010 - Comune di Dongo: progettazione e direzione lavori delle opere di adattamento edilizia scolastica per l’istituto comprensivo statale di Dongo - ing. Virgilio Matteri 2010 - Consorzio di Depurazione Comuni di Cremia e Pianello del Lario: progettazione e direzione lavori per la realizzazione collettori fognari sul territorio dei comuni consorziati: 6° lotto - opere di completamento impianti elettromeccanici - ing. Virgilio Matteri 2009/2011 - Comune di Tremezzo: progettazione e direzione lavori dell’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio adibito a scuole elementari e medie, sito in via Ugo Ricci 2 - ing. Virgilio Matteri 2009/2013 - Comune di Consiglio di Rumo / Comune di Gravedona ed Uniti: progettazione 1° e 2° lotto, direzione lavori 1° lotto per le opere di miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile - nuovi marciapiedi in fregio alla strada statale regina 340 DIR - ing. -

Cartelli Fine Della Guerra
La ne della guerra Le vie della salvezza verso la Svizzera I percorsi partigiani tra i due laghi A Paths to freedom towards Switzerland B Partisan routes between the two lakes San Siro, località Santa Maria Rezzonico Claino con Osteno. Il capitano Ricci e la prima Resistenza San Siro, Santa Maria Rezzonico Hamlet Claino con Osteno. Captain Ricci and the early Resistance Cremia Porlezza. Il controllo fascista e la guerriglia partigiana Cremia Porlezza. Fascist control and partisan guerrilla Dosso del Liro Carlazzo, S. Pietro Sovera. Le prime bande fra Porlezza e Galbiga Dosso del Liro Carlazzo, S. Pietro Sovera. The first armed bands between Porlezza and Galbiga San Bartolomeo Val Cavargna Tremezzo. Gli sfollamenti sul Lario San Bartolomeo Val Cavargna Tremezzo. Lake Como evacuations San Nazzaro Val Cavargna Griante, Cadenabbia. Le residenze di ministri e gerarchi della RSI San Nazzaro Val Cavargna Griante, Cadenabbia. The Residences of ministers and fascist leaders of the RSI Cavargna Lenno, Monte Galbiga. La prima azione partigiana in centro lago Cavargna Lenno, Monte Galbiga. The first partisan action in the Center Lake region Cavargna, Bocchetta di Stabiello Lenno, Abbazia dell'Acquafredda. La Resistenza civile del clero Cavargna, Bocchetta di Stabiello Lenno, Acquafredda Abbey. Civil Resistance of the clergy Cavargna, Passo di San Lucio e Monte Garzirola Lenno. L'attività del Comitato di Liberazione Nazionale Cavargna, San Lucio Pass and Mount Garzirola Lenno. The activities of the National Liberation Committee Gravedona ed Uniti, Passo di San Iorio Ossuccio, località Boffalora. Crocevia e base partigiana Gravedona ed Uniti, San Iorio Pass Ossuccio, Boffalora Hamlet. Crossroads and partisan headquarters Mezzegra, confine con Lenno. -

C 10 Como - Menaggio - Colico VETTORE ASF ORARIO INVERNALE
C_10 Como - Menaggio - Colico VETTORE ASF ORARIO INVERNALE o Si effettua solo il sabato/Only on Saturday 2 Si effettua solo nei giorni di vacanza Scolastica invernali/Only in school holidays 15 Si effettua solo il sabato Scolastico/Only in school Saturday 18 Circola nei giorni di Vacanze Scolastiche Invernali, da Lunedì a Venerdì/Only in school holidays, from Monday to Friday 20 A Cernobbio coincidenza con corsa 60001 della Linea 6 proveniente da Como/In Cernobbio connection with Line 6 - service number 60001 79 Circola nei giorni Scolastici da Lunedì a Venerdì/Only in school days from Monday to friday 96 Circola nei Lunedì, Mercoledì e Venerdì Scolastici/Only in school days on monday, wednesady and friday A7 Transita da Viale Varese, Viale Cattaneo, Piazza Vittoria, Via Battisti, Viale Lecco ed omette la fermata di Lungo Lario Trento/The service goes through Viale Varese, Viale Cattaneo, Piazza Vittoria, Via Battisti, Viale Lecco. It does not stop in Lungo Lario Trento C3 Per e da Lazzago Magistri C. è richiesta l'integrazione tariffa urbana/To and from Lazzago Magistri C. urban fare extracharge is required C9 Transita da Centro Commerciale "Fuentes"/Through shopping mall "Fuentes" E3 In arrivo da Porlezza non transita da Menaggio ma dalla galleria Crocetta fino a Cadenabbia/The service comes from Porlezza and does not stop in Menaggio downtown L4 Dalla Magistri transita dalla via Varesina e termina a Como-Stazione Autolinee / From the Magistri it passes from Via Varesina and ends at Como-Autolinee Station. K7 Prosegue per S. Fedele come C 20 M9 Proviene da S. -

Limousine Tours of Lake Como
Limousine tours of Lake Como RUY is Grand Hotel Tremezzo very own period Venetian motor launch, at Guests’ disposal to discover the Lake’s magic in the most exclusive style. Our Concierge suggests: Lake Como Highlights Tour: 1 hour Villa Balbianello and Isola Comacina or Bellagio and the surroundings. At Client’s choice before departure. Euro 220.00 + 10% vat The Pearls of Lake Como Tour: 2 hours Explore the very heart of the Lake and all its beauties: Villa Balbianello, Isola Comacina, Bellagio and Villa Melzi, Villa Carlotta. Euro 375.00 + 10% vat Hollywood Tour: 3 hours Discover where “Lariowood” legend began: Villa Balbianello chosen as background for many movies, Villa Versace, Laglio the favourite hideaway of George Clooney, up to Villa Erba. Euro 500.00 + 10% vat Secret Tour: 4 hours (morning only) Find out the hidden gems of the northern part of Lake Como: Gravedona and Piona with their Romanesque churches and the abbey. This offers a unique experience of the less touristic but most beautiful places of our Lake. Euro 650.00 + 10% vat Half day (4 hours – morning or afternoon): Euro 650.00 +10% vat Full day (8 hours – from 8am to 8pm): Euro 1,100.00 + 10% vat Transfers: Tremezzo – Bellagio (one way): Euro 60.00 + 10% vat Tremezzo – Villa Balbianello (one way): Euro 100.00 + 10% vat Tremezzo – Comacina Island (one way): Euro 150.00 + 10% vat Tremezzo– Cernobbio (round trip with stop over for lunch): Euro 1,000.00 + 10% vat Photo Shooting (60 minutes): Euro 300.00up+ 10% vat (photographer not included) How to enhance your RUY Experience: