Geschichte Der Deutschen in Ungarn
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gould's History of Freemasonry
GOULD'S HISTORY OF FREEMASONRY THROUGHOUT THE WORLD VOLUME III From a photograph by Underwood and Underwood . King Gustav of Sweden . From the painting by Bernhard Osterman . .o .o.o.o.o .o .o .o .o .o .o .o .o .o.o 0 0 0 Eas 0 xxo~ m~N o En o SNOS S,2i3[~I8I2iDS S3ZU 0 ,XHJ o ~y<~~ v o +5 0 0 0 a 0 0 0 0 III 3I~1Ifl 0 ZOn o Eys, 0 0 v v v 4 o~ 0 a ////~I1\`\ •O E 7S, 0 6 0 0 0 0 0 0 0 Ey; 0 v Gl"HOm 9H~L .Lf10HO110UH,L o E-r, v0 0 0 v 0 v IN A 0 s vw a 4 N 0 0 0 40 v E-1 0 A S vs 0 I( I H S~QZ~109 a $ u eee.e.e.e.eee .e.e.ae.a.e.e.e.e.e.e .ese.e.e.e.e.eeeeee <~ .eee0 .e.e.e.eee.e.e.e.e.oee.e .e. v Z/~~Z/~~S?/~~SZ/~~SZ/n~SZ/ti~5?/~~SZh~SZ/~15Z/~~S?h\SZ/,~5?h~S~/n~S?/\5?/~\SZ/n~S?h~S~/n~SZ/n~SZln~?!~~ W` ,~` W~ W~ W~ W` W` W` W` ~W w.! W~ W` i~W rW W` W~ W` wy y uy J1 COPYRIGHT, 1936, BY CHARLES SCRIBNER ' S SONS PRINTED IN THE UNITED STATES OP AMERICA ww •o •o •o ww •oww•o•ow•wo•o w•o •aoww •o•o •o•o•o•o•o •wo •o •owwwww•ow•o www•o• 0 I ° GOULD'S HISTORY OF FREEMASONRY THROUGHOUT THE WORLD REVISED BY DUDLEY WRIGHT EDITOR OF THE MASONIC NEWS THIS EDITION IN SIX VOLUMES EMBRACES NOT ONLY AN Q Q INVESTIGATION OF RECORDS OF THE ORGANIZATIONS OF THE FRATERNITY IN ENGLAND, SCOTLAND, IRELAND, THE BRITISH COLONIES, EUROPE, ASIA, AFRICA AND SOUTH AMERICA, BUT INCLUDES ADDITIONAL MATERIAL ESPE- CIALLY PREPARED ON EUROPE, ASIA, AND AFRICA, ALSO o b CONTRIBUTIONS BY DISTINGUISHED MEMBERS OF THE FRATERNITY COVERING EACH OF THE o FORTY-EIGHT STATES, DISTRICT OF COLUMBIA AND THE POSSESSIONS OF THE b o UNITED STATES 4 4 THE PROVINCES OF CANADA AND THE 4 COUNTRIES OF LATIN AMERICA b UNDER THE SUPERVISION OF 0 MELVIN M. -

Act Cciii of 2011 on the Elections of Members Of
Strasbourg, 15 March 2012 CDL-REF(2012)003 Opinion No. 662 / 2012 Engl. only EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) ACT CCIII OF 2011 ON THE ELECTIONS OF MEMBERS OF PARLIAMENT OF HUNGARY This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. www.venice.coe.int CDL-REF(2012)003 - 2 - The Parliament - relying on Hungary’s legislative traditions based on popular representation; - guaranteeing that in Hungary the source of public power shall be the people, which shall pri- marily exercise its power through its elected representatives in elections which shall ensure the free expression of the will of voters; - ensuring the right of voters to universal and equal suffrage as well as to direct and secret bal- lot; - considering that political parties shall contribute to creating and expressing the will of the peo- ple; - recognising that the nationalities living in Hungary shall be constituent parts of the State and shall have the right ensured by the Fundamental Law to take part in the work of Parliament; - guaranteeing furthermore that Hungarian citizens living beyond the borders of Hungary shall be a part of the political community; in order to enforce the Fundamental Law, pursuant to Article XXIII, Subsections (1), (4) and (6), and to Article 2, Subsections (1) and (2) of the Fundamental Law, hereby passes the following Act on the substantive rules for the elections of Hungary’s Members of Parliament: 1. Interpretive provisions Section 1 For the purposes of this Act: Residence: the residence defined by the Act on the Registration of the Personal Data and Resi- dence of Citizens; in the case of citizens without residence, their current addresses. -

Sources for Genealogical Research at the Austrian War Archives in Vienna (Kriegsarchiv Wien)
SOURCES FOR GENEALOGICAL RESEARCH AT THE AUSTRIAN WAR ARCHIVES IN VIENNA (KRIEGSARCHIV WIEN) by Christoph Tepperberg Director of the Kriegsarchiv 1 Table of contents 1. The Vienna War Archives and its relevance for genealogical research 1.1. A short history of the War Archives 1.2. Conditions for doing genealogical research at the Kriegsarchiv 2. Sources for genealogical research at the Kriegsarchiv 2. 1. Documents of the military administration and commands 2. 2. Personnel records, and records pertaining to personnel 2.2.1. Sources for research on military personnel of all ranks 2.2.2. Sources for research on commissioned officers and military officials 3. Using the Archives 3.1. Regulations for using personnel records 3.2. Visiting the Archives 3.3. Written inquiries 3.4. Professional researchers 4. Relevant publications 5. Sources for genealogical research in other archives and institutions 5.1. Sources for genealogical research in other departments of the Austrian State Archives 5.2. Sources for genealogical research in other Austrian archives 5.3. Sources for genealogical research in archives outside of Austria 5.3.1. The provinces of the Austro-Hungarian Monarchy and its “successor states” 5.3.2. Sources for genealogical research in the “successor states” 5.4. Additional points of contact and practical hints for genealogical research 2 1. The Vienna War Archives and its relevance for genealogical research 1.1. A short history of the War Archives Today’s Austrian Republic is a small country, but from 1526 to 1918 Austria was a great power, we can say: the United States of Middle and Southeastern Europe. -

The Masonic Collection of the University Library in Poznan
THE MASONIC COLLECTION OF THE UNIVERSITY LIBRARY IN POZNAN Andrzej Karpowicz [email protected] CRFF Working Paper Series No. 6 Mag. Andrzej Karpowicz is Director of the masonic collections of the Uni- versity library of Poznan in Poland. He is founding member of AMMLA, the Association of Masonic Museums, Libraries and Archives in Europe. For contacts with the university library, see http://lib.amu.edu.pl/specjalne/masonbr.htm The catalogue is available under http://lib.amu.edu.pl/ or write to Mgr A. Karpowicz Samodzielna Sekcja Zbiorow Masonskich Biblioteka Glowna UAM ul. Ratajczaka 38/40 PL-61.816 Poznan Poland CENTRE FOR RESEARCH INTO FREEMASONRY AND FRATERNALISM University of Sheffield, United Kingdom 34, Gell Street Sheffield S3 7QY Phone: +44-(0)114- 222 98 90 Fax: +44-(0)114- 222 98 94 Email: [email protected] URL: www.freemasonry.dept.shef.ac.uk CRFF Working Paper Series is published by Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism (CRFF) at the University of Sheffield. ! 2009 Andrzej Karpowicz, and CRFF Editor: Andreas Önnerfors Layout: Andreas Önnerfors ISSN: 1756-7645 CRFF Working Paper Series No. 6 Andrzej Karpowicz THE MASONIC COLLECTION OF THE UNIVERSITY LI- BRARY IN POZNAN The activity of Freemasonry was appropriately matched and accom- panied by a significant development of Masonic writings. The grow- ing number of publications was recorded by and reflected in basic bibliographies of Freemasonry1. This literature constituted the core of the collections in libraries of Masonic lodges. According to the esti- mates given by the German Museum of Freemasonry in Bayreuth, round about the year 1930, all Masonic collection in Germany put together amounted to 200,000 library units2. -

University of Alberta
University of Alberta Making Magyars, Creating Hungary: András Fáy, István Bezerédj and Ödön Beöthy’s Reform-Era Contributions to the Development of Hungarian Civil Society by Eva Margaret Bodnar A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History Department of History and Classics © Eva Margaret Bodnar Spring 2011 Edmonton, Alberta Permission is hereby granted to the University of Alberta Libraries to reproduce single copies of this thesis and to lend or sell such copies for private, scholarly or scientific research purposes only. Where the thesis is converted to, or otherwise made available in digital form, the University of Alberta will advise potential users of the thesis of these terms. The author reserves all other publication and other rights in association with the copyright in the thesis and, except as herein before provided, neither the thesis nor any substantial portion thereof may be printed or otherwise reproduced in any material form whatsoever without the author's prior written permission. Abstract The relationship between magyarization and Hungarian civil society during the reform era of Hungarian history (1790-1848) is the subject of this dissertation. This thesis examines the cultural and political activities of three liberal oppositional nobles: András Fáy (1786-1864), István Bezerédj (1796-1856) and Ödön Beöthy (1796-1854). These three men were chosen as the basis of this study because of their commitment to a two- pronged approach to politics: they advocated greater cultural magyarization in the multiethnic Hungarian Kingdom and campaigned to extend the protection of the Hungarian constitution to segments of the non-aristocratic portion of the Hungarian population. -
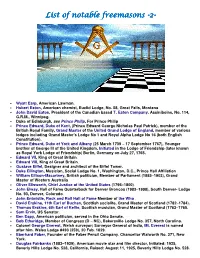
List of Notable Freemasons List of Notable Freemasons
List of notable freemasons ---2-222---- • Wyatt Earp , American Lawman. • Hubert Eaton , American chemist, Euclid Lodge, No. 58, Great Falls, Montana . • John David Eaton , President of the Canadian based T. Eaton Company . Assiniboine, No. 114, G.R.M., Winnipeg. • Duke of Edinburgh, see Prince Philip , For Prince Philip • Prince Edward, Duke of Kent , (Prince Edward George Nicholas Paul Patrick), member of the British Royal Family, Grand Master of the United Grand Lodge of England , member of various lodges including Grand Master's Lodge No 1 and Royal Alpha Lodge No 16 (both English Constitution). • Prince Edward, Duke of York and Albany (25 March 1739 – 17 September 1767), Younger brother of George III of the United Kingdom. Initiated in the Lodge of Friendship (later known as Royal York Lodge of Friendship) Berlin, Germany on July 27, 1765. • Edward VII , King of Great Britain . • Edward VIII , King of Great Britain . • Gustave Eiffel , Designer and architect of the Eiffel Tower. • Duke Ellington , Musician, Social Lodge No. 1, Washington, D.C., Prince Hall Affiliation • William Ellison-Macartney , British politician, Member of Parliament (1885–1903), Grand Master of Western Australia . • Oliver Ellsworth , Chief Justice of the United States (1796–1800) . • John Elway , Hall of Fame Quarterback for Denver Broncos (1983–1998), South Denver- Lodge No. 93, Denver, Colorado . • John Entwistle , Rock and Roll Hall of Fame Member of the Who . • David Erskine, 11th Earl of Buchan , Scottish socialite, Grand Master of Scotland (1782–1784). • Thomas Erskine, 6th Earl of Kellie , Scottish musician, Grand Master of Scotland (1763–1765. • Sam Ervin , US Senator. • Ben Espy , American politician, served in the Ohio Senate. -

Adatok a Baranyai-Dombság Flórájához -..:::: Kitaibelia
17 KITAIBELIA XIII. évf. 1. szám pp.: 17-28. Debrecen 2008 Adatok a Baranyai-dombság flórájához PURGER Dragica Pécsi Tudományegyetem, TTK, Biológiai Intézet, Állatökológia Tanszék, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. [email protected] Bevezetés A Mecseken és környékén végzett botanikai kutatások több mint kétszáz éves történetét HORVÁT Adolf Olivér munkái foglalják össze (HORVÁT 1942, 1958, 1975, 1976, 1977). Az elmúlt évtizedekben végzett florisztikai felmérések eredményei számos adattal gazdagították ismereteinket a Baranyai-dombság növényvilágáról (KEVEY 1986, 1988, 1995, 2001, KEVEY & HORVÁT 2000, DÉNES 1997, TÓTH 1998, 1999, 2000). Az utóbbi öt évben országszerte intenzív terepbotanikai kutatások folytak, és a legújabb eredmények (K EVEY 2004, PÁL 2002 a, b, 2003, PURGER 2002 a, 2002 b, CSIKY et al. 2005) arról tanúskodnak, hogy a vizsgált terület még sok feltáratlan botanikai értéket rejt. A vizsgált terület és módszerek A Baranyai-dombság a Mecsekt ől délre-délkeletre terül el. Négy részre tagolódik. Délen a Pécsi-síkság, attól északkeletre, pedig a Geresdi-dombság helyezkedik el. Legnagyobb részét a Dél-Baranyai dombság kistáj teszi ki. A Baranyai-dombság negyedik részét, mint egy sziget a Villányi hegység képezi (MAROSI & SOMOGYI 1990). Ez utóbbi tájegységet azonban e munkában mell őzzük, tekintettel arra, hogy a növényföldrajzi dolgozatokban a Villányi-hegységet általában külön (pl. MOLNÁR 1999), vagy a Mecsekkel együtt tárgyalják (pl. BORHIDI 2006). A félreértések elkerülése végett itt jegyzem meg, hogy az el őző cikkemben (PURGER 2002 a) a „Baranyai-dombság” név alatt a Dél-Baranyai dombságot értettem. Mindazonáltal, az egész térséget, és ezt a területet is, a geográfusok és a botanikusok több néven tárgyalyák: pl.: Mecsekalja (HORVÁT 1942), Tolna-Baranyai dombvidék (BORHIDI 2006, PÁL 2003). -

Zselici Körzet Erdőterve
Zselicségi körzet erdőterve 2009-2018 ______________________________________________________________________________________________ Az I. kötet tartalomjegyzéke Bevezető. A körzeti erdőtervezés 1. Hatósági eljárások 1.1. Előzetes jegyzőkönyv 1.2. Zárójegyzőkönyv 1.3. Határozatok 2. Táblázatok, statisztikák a körzet teljes területére 2.1. Területi adatok 2.1.2. Helységhatáros területkimutatás 2.1.3. Rendeltetések kimutatása – elsődleges és további rendeltetések együtt (Halmozott terület) 2.1.4.A. Elsődleges rendeltetések területkimutatása 2.1.4.B. További rendeltetések területkimutatása I. 2.1.4.C. További rendeltetések területkimutatása II. 2.1.5. Egyéb részletek területkimutatása 2.1.6. Területváltozás a körzetben 2.2. Termőhelyi adatok 2.2.1. Termőhelytípus-változatok megoszlása 2.2.2. Faállománytípusok klímák szerint 2.3. Állapot adatok 2.3.1. Korosztály táblázatok 2.3.2.A. Vágásos erdők - korosztály táblázat fafajonként 2.3.2.B. Átalakítás alatt álló erdők - korosztály táblázat fafajonként 2.3.2.D. Faanyagtermelést nem szolgáló erdők - korosztály táblázat fafajonként 2.3.3. Faállománytípusok megoszlása fatermőképességi csoportok szerint 2.3.4. Vágásérettségi korokhoz tartozó terület fafajok szerint 2.3.5. Vágásérettségi csoportok területe fafajok szerint 100 évre 2.3.6. Vágásérettségi csoportok terület és fakészlet adatai fafajok szerint 30 évre 2.3.7. Záródás minősítése faállomány-típusonként 2.3.8. Erdőterület megoszlása károsítók szerint 2.3.9. Egészségi állapot fafajcsoportonként 2.3.10. Állapotadatok változásának áttekintő táblázata 2.3.11. Fafajok terület- és fakészlet adatainak változása 2.3.12. Fafajok átlagos vágásérettségi korának változása 2.4. Tervadatok Hosszú távú tervadatok 2.4.1.A. Távlati célállománytípusok - jelenlegi faállománytípusok mátrix 2.4.1.B. Távlati célállománytípusok - erdősítési célállománytípusok (középtávú) mátrix 2.4.1.C. Távlati célállománytípusok és a jelenlegi faállománytípusok részletező táblázata 2.4.2. -

Felvételi Körzetek Baranya Német 2019-2020
1 PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában – német nemzetiségi oktatás – kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák jegyzéke Baranya megyében a 2019/20-as tanévben. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a mohácsi tankerületben: Köznevelési intézmény neve, címe: Felvételi körzete: Szederkényi Általános Iskola (Grundschule von Surgetin) Szederkény, Bóly, Máriakéménd, Monyoród, Töttös és Versend községek közigazgatási (OM: 027312, 7751 Szederkény, Pécsi utca. 19.) területe 5-8. évfolyamok Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér, Pócsa, Babarc, Liptód és Szajk községek közigazgatási területe Telephelye: 7756 Borjád, Kossuth Lajos utca 11. 1.-4. évfolyamok Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér és Pócsa községek közigazgatási területe Szederkényi Általános Iskola Babarci Tagiskolája 1.-4. évfolyamok Babarc és Liptód községek közigazgatási területe (OM: 027312,7757 Babarc, Dózsa György utca 17.) Szederkényi Általános Iskola Szajki Tagiskolája 1.-4. évfolyamok Szajk község közigazgatási területe (OM: 027312, 7753 Szajk, Petőfi Sándor utca 150.) 2 Olaszi Általános Iskola (Grundschule Ahlass) Olasz, Belvárdgyula, Hásságy, Magyarsarlós és Birján községek közigazgatási (OM: 027307; 7745 Olasz, Ady Endre utca) területe Mohács Térségi Általános Iskola Mohács város jobb parti városrésze a Duna folyótól a város (Regionale Allgemeinbildende Schule közigazgatási területének nyugati határáig Kórház utca Mohacs, Područna Osnova Škola Korsós utca Mohacs) Bár, Kölked és Nagynyárád községek közigazgatási területe Kossuth Lajos utca (OM: 101247, 7700Mohács, Széchenyi Kölcsey utca tér 17.,) 1.-4. évfolyamok számára: Sátorhely község Kölkedi utca közigazgatási területe Körtvélyes utca Telephelye: 7700 Mohács, Brodarics tér Középmező dűlő 2. Mohács (Település rész) Lánc utca Liget utca Telephelye: 7785 Sátorhely, Várudvar Ady Endre utca Liliom utca utca 16. -

Napoleonic Scholarship
Napoleonic Scholarship The Journal of the International Napoleonic Society No.9 December 2018 J. David Markham Wayne Hanley President Editor-in-Chief Napoleonic Scholarship: The Journal of the International Napoleonic Society December 2018 Illustrations Front Cover: Bronze and Carara marble 2nd Empire clock showing Napoleon the night before the Battle of Wagram. From the J. David Markham Collection. Back Cover: Snuffbox (ca. 1809-1821) of horn, wood, ivory and brass. Painting on a hinged lid of Napoleon resting on a chair with an Imperial Eagle the evening before the Battle of Wagram. The reverse has a hand painted imperial 'N' and the inscription 'Wagram 1809." From the J. David Markham Collection. Article Illustrations: Print images are from the J. David Markham Collection. The other images and maps were provided by the authors. Images from Dr. Hochel’s article are provided with permission from Mgr. Marta Pavlíková, National Heritage Institute, Czech Republic. 2 Napoleonic Scholarship: The Journal of the International Napoleonic Society December 2018 Napoleonic Scholarship THE JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NAPOLEONIC SOCIETY J. DAVID MARKHAM, PRESIDENT WAYNE HANLEY, EDITOR-IN-CHIEF EDNA MARKHAM, PRODUCTION EDITOR Editorial Review Committee Rafe Blaufarb Director, Institute on Napoleon and the French Revolution at Florida State University John G. Gallaher Professor Emeritus, Southern Illinois University at Edwardsville, Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques Alex Grab Professor of History, University of Maine Romain Buclon Université Pierre Mendès-France Maureen C. MacLeod Assistant Professor of History, Mercy College Wayne Hanley Editor-in-Chief and Professor of History, West Chester University J. David Markham President, International Napoleonic Society, Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques Napoleonic Scholarship is a production of the International Napoleonic Society. -

(Mol Z), 1939-1945 Rg-39.039M
http://collections.ushmm.org Contact [email protected] for further information about this collection Selected Records of the National Land Mortgage Bank of Hungary (MOL Z), 1939‐1945 RG‐39.039M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024‐2126 Tel. (202) 479‐9717 Email: [email protected] Descriptive Summary Title: Selected Records of the National Land Mortgage Bank of Hungary (MOL Z) Dates: 1939‐1945 Creator: Országos Földhitelintézet Országos Központi Hitelszövetkezet Országos Lakásépítési Hitelszövetkezet Record Group Number: RG‐39.039M Accession Number: 2011.173. Extent: 24 microfilm reels (16 mm) Repository: United States Holocaust Memorial Museum Archive, 100 Raoul Wallenberg Place SW, Washington, DC 20024‐2126 Languages: Hungarian, German Administrative Information Access: No restrictions on access. Reproduction and Use: According to the terms of the United States‐Hungary Agreement, personal data of an individual mentioned in the records must not be published sooner than 30 years following the death of the person concerned, or if the year of death is unknown, for 90 years following the birth of the person concerned, or if both dates are unknown, for 60 years following the date of issue of the archival material concerned. "Personal data" is defined as any data that can be related to a certain natural person ("person concerned"), and any conclusion that can be drawn from such data about the person concerned. The full text of the Agreement is available at the United States Holocaust Memorial Museum Archives reference desk. 1 http://collections.ushmm.org http://collections.ushmm.org Contact [email protected] for further information about this collection Preferred Citation: RG‐39.039M, Selected Records of the National Land Mortgage Bank of Hungary (MOL Z), 1939‐1945. -

Közös Önkormányzati Hivatalok, Polgármesteri Hivatalok Címjegyzéke
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK, POLGÁRMESTERI HIVATALOK CÍMJEGYZÉKE 2013. március 1. Irányító Önkormányzat Polgármester Jegyz ő Közös Önkormányzati Közös Telefon Fax Sor- szám Hivatal / Polgármesteri önkormányzati szám Hivatal neve és hivatal – székhelye székhelyen túli – tagjai 1.* 7147 Alsónána Kis Istvánné Csele Julianna Skoda Ferenc Bátaszéki Közös Alsónána, 74/430-103 74/430-374 Kossuth u. 27. 430-374 Önkormányzati Hivatal Alsónyék /Bátaszék/ 2. 7148 Alsónyék Dózsa-Pál Tibor Skoda Ferenc Bátaszéki Közös Alsónána, 74/491-146 74/491-146 T/F Fő u. 1. Önkormányzati Hivatal Alsónyék /Bátaszék/ 3.* 7186 Aparhant Szücs György Visnyei Gabriella Aparhanti Közös Györe, Kakasd, 74/483-792 74/483-792 Kossuth u. 34. Önkormányzati Hivatal Mucsfa, /Aparhant/ Nagyvejke 4.* 7252 Attala Gelencsér István Dr. Bittó Ágnes Kapospulai Közös Attala, Nak 74/565-507 74/565-507 Kossuth u. 15. Önkormányzati Hivatal T/F /Kapospula/ 5.* 7149 Báta Huszárné Lukács Rozália Dr. Bálint József Bátai Közös Önkormányzati Sárpilis 74/490-558 74/590-018 Fő u. 147. Anna Címzetes f őjegyz ő Hivatal /Báta/ 6. 7164 Bátaapáti Darabos Józsefné Bakó Józsefné Bátaapáti Közös Cikó, Mórágy 74/409-295 74/409-255 Pet őfi u. 4. 523-011 Önkormányzati Hivatal 74/506-001 /Bátaapáti/ 7. 7061 Belecska Szemeti Sándor Takács Erzsébet Tolnanémedi Közös Belecska, 74/526-001 74/526-000 Fő u. 20. 74/526-001 Önkormányzati Hivatal Kisszékely, 74/526-000 /Tolnanémedi/ Nagyszékely 8. 7043 Bikács Varga János Dr. Sátor Vera Nagydorogi Közös Bikács, Kajdacs, 75/333-153 75/332-153 Szabadság tér 1. jegyz ő Önkormányzati Hivatal Pálfa 75/532-116 /Orova Dániel /Nagydorog/ Sárszentl őrinc aljegyz ő/ 9.* 7132 Bogyiszló Tóth István Dr.