Cad/Cafm Pflichtenheft Version 3.1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ein Internetbasiertes Gebäudedatenrepositorium Als Lebenszyklusorientierte Integrationsplattform
Der Raum dient während der Nutzung als entscheidende Refere nzgröße zur Handha bung der Gebäudeinformationen. Ein raum bezogener Gebäudebeschrieb und die Ver waltung eines dynamischen Raumbuches als DatenRepositorium stellt daher eine ent scheidende Grundlage für eine effiziente Nutzung, Wartung und Moder nisierung wie auch für eine fortschreibende Gebäudehisto rie dar. Der Prototyp beinhaltet ein Modell, welches alphanumerische Daten von Gebäu den als Raumbuch effizient erfasst, spei chert sowie verschiedenen Nutzerrollen on line bereitstellt und Veränderungen im Sinne einer Gebäudehistorie durch ein Konfigura tionsmanagement dynamisch abbildet. Als digitale Schnittstelle wird über einen ifcba Robin Gessmann sierten Import aus CADDateien die Gebäu dehierarchie eingelesen aber auch externe Ein internetbasiertes Werkzeuge integriert oder angesteuert. Die Interaktion von verschiedensten Benutzer Gebäudedatenrepositorium gruppen mit dem Gebäudekomplex wird über eine Weboberfläche unterstützt. als lebenszyklusorientierte Integrationsplattform Robin Gessmann Ein internetbasiertes Gebäudedatenrepositorium Robin ISBN: 978-3-86644-299-3 www.uvka.de Robin Gessmann Ein internetbasiertes Gebäudedatenrepositorium als lebenszyklusorientierte Integrationsplattform Ein internetbasiertes Gebäudedaten- repositorium als lebenszyklusorientierte Integrationsplattform von Robin Gessmann Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) Fakultät für Architektur Tag der mündlichen Prüfung: 19.05.2008 Impressum Universitätsverlag Karlsruhe c/o Universitätsbibliothek -
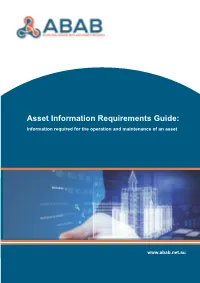
Asset Information Requirements Guide
Asset Information Requirements Guide: Information required for the operation and maintenance of an asset www.abab.net.au Australasian BIM Advisory Board (ABAB) In May 2017, the Australasian BIM Advisory Board (ABAB) was established by the Australasian Procurement and Construction Council (APCC) and the Australian Construction Industry Forum (ACIF), together with NATSPEC, buildingSMART Australasia and Standards Australia. This partnership of national policy and key standard-setting bodies represents a common-sense approach that captures the synergies existing in, and between, each organisation’s areas of responsibility in the built environment. It also supports a more consistent approach to the adoption of Building Information Modelling (BIM) across jurisdictional boundaries. The establishment of the ABAB is a first for the Australasian building sector with government, industry and academia partnering to provide leadership to improve productivity and project outcomes through BIM adoption. The ABAB is committed to optimal delivery of outcomes that eliminate waste, maximise end-user benefits and increase the productivity of the Australasian economies. The ABAB has evolved from a previous APCC–ACIF collaboration established in 2015 at a BIM Summit. This summit produced resource documentation to support BIM adoption (refer to www.apcc.gov.au for copies). Members of the ABAB have identified that, without central principal coordination, the fragmented development of protocols, guidelines and approaches form a significant risk that may lead to wasted effort and inefficiencies, including unnecessary costs and reduced competitiveness, across the built environment industry. www.abab.net.au What is Building Information Modelling (BIM)? For the context of the Asset Information Requirements Guide, the European Union (EU) BIM Task Group’s description has been adopted: BIM is a digital form of construction and asset operations. -

Table of Contents From
Standards, Publications & Software Table of Contents from 34 Construction 89 Medical 110 Petroleum Global Engineering Documents®, the retail arm of IHS, is your single source for individual standards, 136 Telecommunications publications, and integrated collections via hardcopy or electronic delivery. Accessing critical technical 1 Aerospace/Aviation information has never been easier! 7 Annual Book of ASTM Standards global.ihs.com 17 Automotive/Heavy Equipment 25 Boiler & Pressure Vessel Code Copyright © 2004 by Information Handling Services Inc. All rights reserved. 30 CE Marking No portion of this material may be reprinted in any form without the experssed written permission of the publisher, Information Handling Services. Global Engineering Documents and logo are trademarks of Information Handling Services Inc. Registered U.S. Patent and Trademark Office. 32 Color Charts & Standards All other trademarks, brands and product names are the property of their respective owners. 41 Drawing & Drafting 46 Electrical/Electronics 67 Electromagnetic Compatibility/Frequency 70 Environmental 76 Fire Protection 79 Gears 82 Hardware 86 Hydraulics 104 Metals 108 Occupational Health and Safety 120 Plastics 124 Public Health 126 Quality 133 Safety 151 Transportation Management Systems 154 U.S. Government & Military 165 Welding 171 Timesaving Services Free Catalogs Available from Global . 171 Reference Materials & Services . 172 Standards Developing Organization Index . 174 Catalog Index . 177 PRIORITY CODE G040 To order or for more information: 800-854-7179 (USA/Canada) • fax: 303-397-2740 • global.ihs.com Aerospace/Aviation AV DATA® Aerospace Industries Association With AV-DATA® you have access to critical aviation information Global is the worldwide distributor of AIA standards and to help ensure worldwide regulatory compliance, airworthiness, publications. -
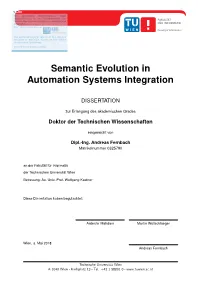
Semantic Evolution in Building Automation Systems Integration
Die approbierte Originalversion dieser Dissertation ist in der Hauptbibliothek der Technischen Universität Wien aufgestellt und zugänglich. http://www.ub.tuwien.ac.at The approved original version of this thesis is available at the main library of the Vienna University of Technology. http://www.ub.tuwien.ac.at/eng Semantic Evolution in Automation Systems Integration DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Technischen Wissenschaften eingereicht von Dipl.-Ing. Andreas Fernbach Matrikelnummer 0325790 an der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Wien Betreuung: Ao. Univ.-Prof. Wolfgang Kastner Diese Dissertation haben begutachtet: Ardeshir Mahdavi Martin Wollschlaeger Wien, 3. Mai 2018 Andreas Fernbach Technische Universität Wien A-1040 Wien Karlsplatz 13 Tel. +43-1-58801-0 www.tuwien.ac.at Semantic Evolution in Building Automation Systems Integration DISSERTATION submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doktor der Technischen Wissenschaften by Dipl.-Ing. Andreas Fernbach Registration Number 0325790 to the Faculty of Informatics at the TU Wien Advisor: Ao. Univ.-Prof. Wolfgang Kastner The dissertation has been reviewed by: Ardeshir Mahdavi Martin Wollschlaeger Vienna, 3rd May, 2018 Andreas Fernbach Technische Universität Wien A-1040 Wien Karlsplatz 13 Tel. +43-1-58801-0 www.tuwien.ac.at Erklärung zur Verfassung der Arbeit Dipl.-Ing. Andreas Fernbach Treitlstraße 1-3 1040 Wien Hiermit erkläre ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst habe, dass ich die verwen- deten Quellen und Hilfsmittel vollständig angegeben habe und dass ich die Stellen der Arbeit – einschließlich Tabellen, Karten und Abbildungen –, die anderen Werken oder dem Internet im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, auf jeden Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht habe. -

March 2021 International Standards in Process
ISO Update Supplement to ISOfocus March 2021 International Standards in process ISO/CD Agricultural machinery — Safety — Part 13: 4254-13 Large rotary mowers An International Standard is the result of an agreement between ISO/CD 5718-1 Harvesting equipment — Requirements for cut- the member bodies of ISO. A first important step towards an Interna- ting elements — Part 1: Blades used on rotary tional Standard takes the form of a committee draft (CD) - this is cir- disc mowers and rotary drum mowers culated for study within an ISO technical committee. When consensus ISO/CD 5718-2 Harvesting equipment — Requirements for cut- has been reached within the technical committee, the document is ting elements — Part 2: Blades used on large sent to the Central Secretariat for processing as a draft International rotary mowers Standard (DIS). The DIS requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. A confirmation vote is subsequently ISO/CD 5231 Extended Farm Management Information Sys- carried out on a final draft International Standard (FDIS), the approval tems Data Interface (EFDI) criteria remaining the same. TC 31 Tyres, rims and valves ISO/CD 4250-1 Earth-mover tyres and rims — Part 1: Tyre designation and dimensions ISO/CD 4250-2 Earth-mover tyres and rims — Part 2: Loads and inflation pressures TC 34 Food products ISO/CD 17715 Flour from wheat (Triticum aestivum L.) — Amperometric method for starch damage CD registered measurement ISO/CD 24557 Pulses — Determination of moisture content — Air-oven method Period from 01 February to 01 March 2021 TC 35 Paints and varnishes These documents are currently under consideration in the technical committee. -

Catálogo De Normas Bolivianas 2011
CATÁLOGO DE NORMAS BOLIVIANAS 2011 0 CATALOGO DE NORMAS BOLIVIANAS 2011 PRESENTACIÓN CATÁLOGO Presentamos el Catálogo Anual de Normas Bolivianas, que recopila la relación de documentos normativos vigentes y cuyo propósito, es el de brindar al usuario un sistema de consulta eficaz y oportuno de todas las normas técnicas bolivianas NB aprobadas. Este documento es considerado como una herramienta de información imprescindible para la localización de las normas NB; posibilitando de esta manera a nuestros usuarios, la disposición de un medio sencillo de acceso al extenso mundo de la normalización. Las normas técnicas bolivianas - NB, son el resultado de un gran esfuerzo de más de 4 000 técnicos, quienes, en representación del gobierno, de los sectores privados de la producción, la distribución y el consumo y del sector científico en sus diferentes ramas, en forma activa y decidida, participan a través de 19 sectores económicos que cubren prácticamente todos los campos de la ciencia y la tecnología de nuestro país, en la elaboración de normas a nivel nacional; todo esto, con el propósito de establecer un orden de una actividad específica para beneficio de los consumidores y productores. Es por todos sabido que disponer de una información actualizada, resulta básico para las empresas, por ello IBNORCA, ha dedicado un especial esfuerzo en este año, para mejorar y adaptar a las nuevas posibilidades tecnológicas, sus productos y servicios de información. Con la convicción de que la satisfacción de nuestros clientes es nuestro primer objetivo, estaremos encantados de atender cualquier sugerencia que nos transmitan los usuarios de nuestros servicios. Dirección Nacional de Normalización DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 1 CATALOGO DE NORMAS BOLIVIANAS 2011 ÍNDICE Pág. -
PDF Download
Published online: 2021-05-12 THIEME e20 Original Article Proposing an International Standard Accident Number for Interconnecting Information and Communication Technology Systems of the Rescue Chain Nicolai Spicher1 Ramon Barakat1 Ju Wang1 Mostafa Haghi1 Justin Jagieniak2 Gamze Söylev Öktem2 Siegfried Hackel2 Thomas Martin Deserno1 1 Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics of TU Address for correspondence Nicolai Spicher, PhD, Peter L. Reichertz Braunschweig and Hannover Medical School, Braunschweig, Institute for Medical Informatics of TU Braunschweig and Hannover Germany Medical School, Mühlenpfordtstraße 23, 38106 Braunschweig, 2 Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB, National Metrology Germany (e-mail: [email protected]). Institute of Germany, Braunschweig, Germany Methods Inf Med 2021;60:e20–e31. Abstract Background The rapid dissemination of smart devices within the internet of things (IoT) is developing toward automatic emergency alerts which are transmitted from machine to machine without human interaction. However, apart from individual projects concentrating on single types of accidents, there is no general methodology of connecting the standalone information and communication technology (ICT) systems involved in an accident: systems for alerting (e.g., smart home/car/wearable), systems in the responding stage (e.g., ambulance), and in the curing stage (e.g., hospital). Objectives We define the International Standard Accident Number (ISAN) as a unique tokenforinterconnectingtheseICTsystemsandtoprovideembeddeddatadescribing Keywords the circumstances of an accident (time, position, and identifier of the alerting system). ► accidents (D000059) Materials and Methods Based on the characteristics of processes and ICT systems in ► emergency medical emergency care, we derive technological, syntactic, and semantic requirements for the services (D004632) ISAN, and we analyze existing standards to be incorporated in the ISAN specification. -

Universidade Candido Mendes Instituto a Vez Do Mestre Pós-Graduação “Lato Sensu”
1 UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES Wi INSTITUTO A VEZ DO MESTRE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” O DESENVOLVIMENTO E A EVOLUÇÃO DO CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE E SUA APLICAÇÃO NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL E SERVIÇOS O PANORAMA BRASILEIRO Carlos Alberto Gonçalves Alfredo ORIENTADORA: Profª. Ana Paula Ribeiro Rio de Janeiro 2010 2 UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES INSTITUTO A VEZ DO MESTRE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” O DESENVOLVIMENTO E A EVOLUÇÃO DO CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE E A SUA APLICAÇÃO NAS DE PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL E SERVIÇOS O PANORAMA BRASILEIRO Carlos Alberto Gonçalves Alfredo Apresentação de monografia ao Conjunto Universitário Candido Mendes como condição prévia para a conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração da Qualidade. Rio de Janeiro 2010 3 AGRADECIMENTOS Agradeço aos meus pais que, com a sua dedicação, amor e carinho me conduziram na edificação da minha personalidade, permitindo-me chegar até aqui. A minha esposa Kylma e aos meus filhos, Daniel, Davi, Nathália e Mere, pelo amor e incentivos recebidos durante a minha caminhada. Aos meus amigos, Wagner, Dr. Luiz de Rose e Padre Marcos William pela sua presença sempre amiga e presente, incentivo e apoio. A todos muito obrigado. 4 DEDICATÓRIA Dedico este trabalho ao amor de Deus, sem o qual nada poderia ser realizado. “Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenézer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor” (I Samuel, 7:12). 5 RESUMO O Controle Estatístico de Qualidade – CEQ é formado por um conjunto de atividades semelhantes entre si, abrangendo: Estudos de capacitação de processos, Inspeção por amostragem e estudos experimentais. -

Bygning Og Tekniske Anlegg
ETAT FOR BYGG OG EIENDOM Retningslinjer og krav til: BYGNING OG TEKNISKE ANLEGG 3.utgave Revisjonsdato: 06.06.2019 Forord Dette dokumentet inngår i dokumentserien «Retningslinjer og krav» satt av Etat for bygg og eiendom (EBE), Bergen kommune. Formålet med dokumentserien er å sikre gode løsninger for energibruk, miljøkvaliteter, drift og vedlikehold i bygg som EBE skal forvalte. Dokumentserien inneholder retningslinjer og krav satt til: • Bygning og tekniske anlegg • Automatisering og SD-anlegg (bygningsdel 56) • DAK-manual • FDV-dokumentasjon • Merkemanual • Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav Dokumentet «Bygning og tekniske anlegg» legger føringer for og stiller krav til bygning og tekniske anlegg, utover forskriftskrav, og bygger på erfaringer fra drifts- og vedlikeholdsmiljøet i Etat for bygg og eiendom (EBE) og Oslo kommune sin «Standard kravspesifikasjon» (2015). Ved større byggeprosjekter må dokumentserien sees i sammenheng med rom- og funksjonskrav stilt fra den respektive fagbyrådsavdeling. Bergen kommune har satt seg overordnede mål for å redusere kommunens miljø- og klimapåvirkning hvor hensynet til en grønn og bærekraftig utvikling skal være et overordnet prinsipp i kommunens virksomhet og planlegging. Føringer i dokumentet "Klima- og Miljøplan" for Bergen kommune må derfor vektlegges i alle byggeprosjekter. Bergen kommune ønsker å være en pådriver for innovasjon og bærekraftig utvikling og oppfordrer til innovative tekniske løsninger og byggemåter som kan ha en utvidet samfunnsnyttig verdi. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger og innspill til forbedringer av dokumentserien. Tilbakemeldinger merkes "Merknader til retningslinjer og krav til bygning og tekniske anlegg" og kan sendes til: [email protected]. Bergen 02.10.17 Bjørn Ove Lid Direktør EBE 1 Revisjonsdato: 06.06.2019 3.utgave Innhold Forord ................................................................................................................. -
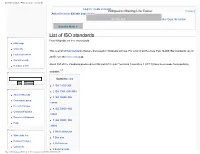
List of ISO Standards - Wikipedia, the Free Encyclopedia
List of ISO standards - Wikipedia, the free encyclopedia Log in / create account Wikipedia: Making Life Easier. [Collapse] Article Discussion Edit this page History $3,376,364 Our Goal: $6 million Donate Now » List of ISO standards Navigation From Wikipedia, the free encyclopedia ● Main page ● Contents This is a list of ISO standards that are discussed in Wikipedia articles. For a list of all the more than 16,000 ISO standards (as of ● Featured content 2007), see the ISO Catalogue. ● Current events About 300 of the standards produced by ISO and IEC's Joint Technical Committee 1 (JTC1) have been made freely/publicly ● Random article [ ] available. 1 Search Contents [hide] ● 1 ISO 1–ISO 999 Interaction ● 2 ISO 1000–ISO 9999 ● About Wikipedia ● 3 ISO 10000–ISO ● Community portal 19999 ● Recent changes ● 4 ISO 20000–ISO ● Contact Wikipedia 29999 ● Donate to Wikipedia ● 5 ISO 30000–ISO ● Help 39999 Toolbox ● 6 Other standards ● What links here ● 7 See also ● Related changes ● 8 References ● Upload file ● 9 External links http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_standards (1 of 20)05/12/2008 10:36:09 • List of ISO standards - Wikipedia, the free encyclopedia ● Special pages ● Printable version ISO 1–ISO 999 [edit] ● Permanent link ● ISO 1 Standard reference temperature for geometrical product specification and verification ● Cite this page ● ISO 3 Preferred numbers Languages ● ISO 4 Rules for the abbreviation of title words and titles of publications ● Deutsch ● ISO 7 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads ● Español ● ISO 9 Information and documentation — Transliteration of Cyrillic characters into Roman characters — Slavic and non-Slavic ● ••••• languages ● Français ● ● •••••• ISO 16:1975 Acoustics — Standard tuning frequency (Standard musical pitch) ● Íslenska ● ISO 31 Quantities and units ● Italiano ● ISO 68-1 Basic profile of metric screw threads ● Nederlands ● ISO 216 paper sizes, e.g. -

Download Options
123 Eur J Epidemiol (2016) 31:S1–S239 DOI 10.1007/s10654-016-0183-1 ABSTRACTS Health—exploring complexity: an interdisciplinary systems approach HEC2016 28 August–2 September 2016, Munich, Germany Eva Grill • Martin Mu¨ller • Ulrich Mansmann Ó Springer Science+Business Media Dordrecht 2016 Health is a complex process with potentially interacting components (EFMI, MIE 2016). HEC2016 took place in Mu¨nchen, Germany, in the from the molecular to the societal and environmental level. Adequate main building of the Ludwig-Maximilians-Universita¨t (LMU) from 28 research designs and data analysis methods are needed to improve our August to 2 September 2016 under the auspices of the Institute for understanding of this complexity, to ultimately derive high quality Medical Information Processing, Biometry and Epidemiology of LMU. evidence to inform patients, health professionals, and health policy The conference received 832 contributions for oral and poster decision makers. Also, effective patient-centred health care has to presentation (Table 1). Fourteen percent of them were from outside address the complexity of health, functioning, and disability, not only Europe with the largest group of 10 % from Asia (Table 2). Scientific by implementing interventions, but also by using information tech- program committees and reviewers selected 408 submissions as oral nology that represents the complexity of health care to inform all actors. contributions and 303 for poster presentations. The program was Given this background, we developed the concept of our confer- surrounded by twelve tutorials held by international renowned sci- ence HEC2016 as an interdisciplinary European event in beautiful entists and covered a broad spectrum from innovative biostatistical Bavaria, in the city of Mu¨nchen. -

Normas Iso Sobre Toleranciamento Dimensional
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DISCIPLINAS DE DESENHO I/II NORMAS NP, ISO e EN RELACIONADAS COM O DESENHO TÉCNICO João M. Pereira Dias (Versão 1.3) 2000/1/4 Janeiro de 2000 NORMAS Versão 1.3 2 ÍNDICE NORMAS PORTUGUESAS NP SOBRE DESENHO TÉCNICO.......................................................................... 3 NORMAS PORTUGUESAS NP SOBRE TOLERANCIAMENTO ....................................................................... 3 NORMAS PORTUGUESAS NP SOBRE SOLDADURA ...................................................................................... 4 NORMAS PORTUGUESAS NP SOBRE ACABAMENTOS SUPERFICIAIS E ESTADOS DE SUPERFÍCIE . 4 NORMAS PORTUGUESAS NP SOBRE PEÇAS ROSCADAS ............................................................................ 4 NORMAS PORTUGUESAS NP SOBRE REBITES .............................................................................................. 5 NORMAS EUROPEIAS EN SOBRE DESENHO TÉCNICO ................................................................................ 6 NORMAS EUROPEIAS EN SOBRE TOLERANCIAMENTO ............................................................................. 7 NORMAS EUROPEIAS EN SOBRE SOLDADURA ............................................................................................ 8 NORMAS EUROPEIAS EN RELACIONADAS COM PEÇAS ROSCADAS ..................................................... 8 NORMAS EUROPEIAS EN SOBRE ANILHAS ................................................................................................... 8 NORMAS