Dissertation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MELA Notes 80 (2007) Trips up to Marshall Street Put Us in Contact with the Yiddish Language and Mysterious Hebrew Letters on Synagogues and Stores
MELA NOTES Journal of Middle Eastern Librarianship Number 80 (2007) ISSN 0364-2410 Published by The Middle East Librarians Association Editor Review Editor Jonathan Rodgers Rachel Simon University of Michigan Princeton University Officers of the Middle East Librarians Association Ali Houissa, Cornell University President, 2005–2007 M. Lesley Wilkins, Harvard Law School Past-President, 2005–2007 Kristen Kern, Portland State University Vice-Pres./Program Chair, 2006–2007 William Kopycki, Univ. of Pennsylvania Secretary-Treasurer, 2004–2007 Jonathan Rodgers, University of Michigan Editor, 2004–2007 Basima Bezirgan, University of Chicago Member-at-large, 2005–2007 Joyce Bell, Princeton University Member-at-large, 2006–2008 John Eilts, Stanford University Melanet-L Listserve Manager, Interim John Eilts, Stanford University MELA Webmaster MELA Notes is published once a year, in spring and fall. It is distributed to members of the Association and subscribers. Membership dues of US $30.00 bring the Notes and other mailings. Subscriptions are US $30.00 per calendar year, or US $16.00 per issue for most back numbers. Address correspondence regarding subscriptions, dues, or membership information to: William Kopycki, Secretary-Treasurer MELA University of Pennsylvania Library 3420 Walnut Street Philadelphia PA 19104-6206 Address articles and other notices to: Address books for review to: Jonathan Rodgers Rachel Simon Editor, MELA Notes Review Editor, MELA Notes Near East Division, Hatcher Graduate Library Catalog Division Univ. of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1205 Princeton Univ. Library E-mail: [email protected] 1 Washington Road Phone: (734) 764-7555 Princeton, NJ 08544 Fax: (734) 763-6743 E-mail: [email protected] http://www.lib.umich.edu/area/Near.East/MELANotesIntro.html Articles and reviews must be submitted both in printed format by post and in electronic format by email attachment or disk. -
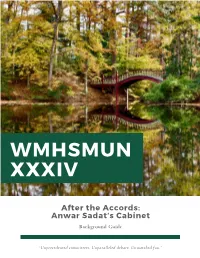
After the Accords Anwar Sadat
WMHSMUN XXXIV After the Accords: Anwar Sadat’s Cabinet Background Guide “Unprecedented committees. Unparalleled debate. Unmatched fun.” Letters From the Directors Dear Delegates, Welcome to WMHSMUN XXXIV! My name is Hank Hermens and I am excited to be the in-room Director for Anwar Sadat’s Cabinet. I’m a junior at the College double majoring in International Relations and History. I have done model UN since my sophomore year of high school, and since then I have become increasingly involved. I compete as part of W&M’s travel team, staff our conferences, and have served as the Director of Media for our college level conference, &MUN. Right now, I’m a member of our Conference Team, planning travel and training delegates. Outside of MUN, I play trumpet in the Wind Ensemble, do research with AidData and for a professor, looking at the influence of Islamic institutions on electoral outcomes in Tunisia. In my admittedly limited free time, I enjoy reading, running, and hanging out with my friends around campus. As members of Anwar Sadat’s cabinet, you’ll have to deal with the fallout of Egypt’s recent peace with Israel, in Egypt, the greater Middle East and North Africa, and the world. You’ll also meet economic challenges, rising national political tensions, and more. Some of the problems you come up against will be easily solved, with only short-term solutions necessary. Others will require complex, long term solutions, or risk the possibility of further crises arising. No matter what, we will favor creative, outside-the-box ideas as well as collaboration and diplomacy. -

CONGRESSIONAL RECORD— Extensions of Remarks E274 HON. TOM LANTOS HON. PETER DEUTSCH HON. BENJAMIN L. CARDIN
E274 CONGRESSIONAL RECORD — Extensions of Remarks March 6, 2002 Policy and Legislative, and Conference Com- rector of Nutrition Services. She works hard to Suzanne Mubarak’s commitment to edu- mittees. combine nutritional integrity with sound busi- cation is consistent with these worthy goals. Marty’s theme for her Presidency, ‘‘Nutrition ness practices, and has earned a USDA Rec- This was acknowledged in the citation of rec- and Learning, Hand in Hand,’’ depicts her ognition Award each time her program has ognizing her contributions: commitment to children’s nutrition education, been audited. She is committed to the children ‘‘For seven millennia, the world has learned and the positive effect good nutrition has on a and is known for running her program with the from Egypt. And, even today, we are learning child’s learning ability. This has been a timely highest of ethics and standards. much for your work about the impact that early theme because of current interest amongst Marty is a member of Candle Lighters, a education has on a child’s ability to cope with California families, schools, and Legislators in Fremont organization that builds and operates his or her environment. You have taught us children’s nutrition issues. Marty testified nu- a ghost house each year and donates the pro- that education must encompass all of life’s merous times during the 2001–2002 session ceeds to local charities. She has chaired the issues and should enhance the ability of peo- in both Senate and Assembly Committee Caramel Apple booth and the scheduling of ple to interact in society. -

Interview with Farida Al-Naqqash
Interview with Farida al-Naqqash, literary critic, writer and member of the National Progressive Unionist Party (Tagammu party), born in 1940 in the governorate of Daqhaliyya. At her home, Sahafayeen, Cairo, 28 March 2013 Interviewer (Nicola Pratt, NP): We don’t have to start off by creating a timeline. We can just talk about some of you memories and have… Interviewee (Farida Naqqash, FN): Sort of a conversation. NP. Yes, a conversation. Personally, I would like to know, not only about the political atmosphere, but also about the social atmosphere and the civilian movements… FN. Uh-huh. NP. I would like to know what changes occurred… FN. After the revolution? NP. Well, no, starting with way back… FN. You mean since 1967? NP. Yes and up until today. From the days of Abdel Nasser through Sadat and Mubarak, and now the Muslim Brotherhood, I would like to know about how the social mood and civil movements changed throughout these times. Also, if there’s a difference on the international level… FN. Uh-huh. After the collapse of the Soviet Union, you mean? NP. Correct. FN. Well, during Abdel Nasser’s reign things were better on the social and economic levels. People were, to certain extent, living a secure life. People had government health insurance, free schools, pensions, public transport. So, the essential needs of the people were available and accessible. It all started to change when Sadat rose to power in 1970 and ushered in the Infitah or the ‘openness’ policy. The Egyptian society was quickly split into [a poor class and] a very wealthy class, which included many nouveau riche, or what is referred to in economic circles as fat cats, who made their money through corrupt practices and with the help of the new Infitah policy. -
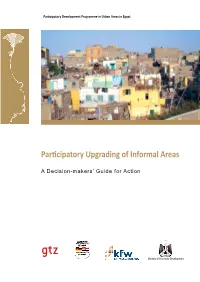
Participatory Upgrading of Informal Areas
Participatory Development Programme in Urban Areas in Egypt Participatory Upgrading of Informal Areas A Decision-makers’ Guide for Action Ministry of Economic Development Published by Participatory Development Programme in Urban Areas (PDP) in Egypt PDP is an Egyptian-German development project implemented by the Ministry of Economic Development (MoED) as the lead executing agency, the German Technical Cooperation (GTZ) and the KfW Entwicklungsbank (German Development Bank), with financial assistance by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). Other Cooperation Partners Ministry of Local Development Ministry of Social Solidarity Governorate of Cairo Governorate of Giza Governorate of Qalyoubia Integrated Care Society Responsible Marion Fischer Author Khaled Abdelhalim Assisted by Mohammad Abou Samra Reviewed by Gundula Löffler, Regina Kipper Design by Khaled Abdelhalim, Mohammad Abou Samra Cover photo General view of an informal area, Boulaq el Dakrour, Cairo, by GTZ PDP Acknowledgement Many PDP members and consultants contributed to the development of the participatory tools presented in these guidelines over years of practice and methodology development. Dina Shehayeb reviewed early versions of the structure of the guidelines and her work on maximising use value in informal areas was referred to in part one. Edition Cairo, May 2010 Commissioned by © Participatory Development Programme in Urban Areas (PDP) in Egypt Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH German Technical Cooperation GTZ Office Cairo 4d, El Gezira Street, 3rd Floor 11211 Zamalek Cairo, Egypt T +20 2 2735-9750 F +20 2 2738-2981 E [email protected] I www.gtz.de/egypt www.egypt-urban.de Participatory Upgrading of Informal Areas A Decision-makers’ Guide for Action Preface Dealing with informal areas is one of the big national challenges in Egypt. -

Are Egyptian Women Empowered?
Are Egyptian Women Empowered? The Achievements and Challenges Ahead for Egyptian Women to Gain More Political and Social Power By Laila El Baradei he year 2011—the year of the Egyptian uprising—was a turning point in the history of Egypt, for both men and women. At the time, aspirations for a Tsocietal gender transformation were high. Seven years on, Egyptians con- tinue to discuss the challenges, hurdles, opportunities, and occasional progress made toward increasing the rights and the role of women in Egypt. What have Egyptian women achieved? What challenges have they faced? And what can be done to further empower them in governing Egypt? Ever since 2011, the government has been celebrating Egyptian women’s achieve- ments and pointing out the prominent examples of empowered women in ministerial positions, in parliament, and as judges. Although this may be true for a handful of women who have managed to make it work, achieve an optimum life–work balance, and get their names mentioned in the newsreel often enough, it is not the case for the majority of women in Egypt. Women were active in the 2011 uprising—both out on the street, and later on as voters eager to have their voices heard—but have their aspi- rations been fully realized? Rating the Indexes Several international indexes and rankings exist that look into the degree of gender equality and inequality worldwide. In the Global Gender Gap Index (GGI) for 2017, an index prepared by the World Economic Forum to mea- w Women parlia- sure gender inequality gaps, we find that Egypt ranks 134 mentarians attend an out of 144 countries worldwide. -

The Recommendations of the International Conference on Population and Development: the Possibility of the Empowerment of Women in Egypt Jennifer Jewett
Cornell International Law Journal Volume 29 Article 5 Issue 1 1996 The Recommendations of the International Conference on Population and Development: The Possibility of the Empowerment of Women in Egypt Jennifer Jewett Follow this and additional works at: http://scholarship.law.cornell.edu/cilj Part of the Law Commons Recommended Citation Jewett, Jennifer (1996) "The Recommendations of the International Conference on Population and Development: The osP sibility of the Empowerment of Women in Egypt," Cornell International Law Journal: Vol. 29: Iss. 1, Article 5. Available at: http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol29/iss1/5 This Note is brought to you for free and open access by Scholarship@Cornell Law: A Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Cornell International Law Journal by an authorized administrator of Scholarship@Cornell Law: A Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. The Recommendations of the International Conference on Population and Development: The Possibility of the Empowerment of Women in Egypt Jennifer Jewett* Introduction The United Nations sponsored the International Conference on Population and Development (ICPD) from September 5 to September 15, 1994 in Cairo, Egypt.' The Conference resulted in the creation of a plan designed 2 to control the growth of the global population over the next twenty years. The document adopted by the nations participating in the Conference rec- ognizes that women play an essential role in the program of population development, but must gain complete control over their reproduction in order to do so.3 Consequently, the ICPD Program of Action emphasizes that for the program to succeed, nations worldwide must strive to empower their female citizens and to provide them with adequate family planning 4 services and information. -

Wahba.Marcelle.Pdf
The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project AMBASSADOR MARCELLE M. WAHBA Interviewed by: Charles Stuart Kennedy Initial interview date: April 8, 2015 Copyright 2020 ADST TABLE OF CONTENTS Background Childhood in Egypt The 1967 Arab Israeli War & Immigration to USA Seattle, Washington—City of Seattle Department of 1972–1979 Human Resources, Vocational Counselor Returning to Explore Egypt—Development Office, 1979–1985 American University in Cairo, Director of Grants and Projects Joined the Foreign Service 1986 Washington, D.C.—USIA’s NEA Area Office, Deputy 1986–1988 Media Coordinator Cairo, Egypt—U.S. Embassy Spokesperson 1988–1991 Egypt’s Media Environment The USAID Program Egypt’s Role in the Region Iraq’s invasion of Kuwait Nicosia, Cyprus—USIS Public Affairs Officer 1991–1995 The Madrid Middle East Peace Conference A Divided Island/Bicommunal Work in Cyprus Brushstrokes Across Cultures Role of the Fulbright Commission Turkish & Greek Cypriot politics Amman, Jordan—PAO & Acting Deputy Chief of Mission 1995–1999 Jordan’s Tribal Politics & Regional Challenges Transition from King Hussein to King Abdullah Cairo, Egypt—Counselor for Press and Cultural Affairs 1999–2001 Promoting Democracy Muslim Brotherhood & Mubarak Regime Religious Tensions Egypt & its Neighbors USIA Merger with the State Department Egypt’s Domestic Challenges Abu Dhabi, UAE—Ambassador 2001–2004 Appointment & Confirmation Process Aftermath of 9/11 & Domestic Reforms Preparing for War in Afghanistan: Role of MbZ First Woman Ambassador & Role of UAE Women UAE’s Federal Tribal System Human Trafficking The War in Iraq UAE & Iran Washington D.C.—National Defense University, 2004–2006 National War College, State Department Advisor and Deputy Commandant Washington D.C.—U.S. -

Voices for Change Hopes and Costs for Empowerment – a Study on Women’S Claims in the Egyptian Revolution
! "#$ %#"& "'(## )*+ ,- ./0- / +%#( * 1 (2 1 3 1 4 1( 1 (* 5 (! 6 / 5 (* ( / / , . 5 (* / 7 , /"888. (* (9 6 1 / : (7 / (* : 1 /2 ( 1,"888. 1,"88;. / 3 / 1 (* 5 / (* (/ / (* (2 / / : / / (*// ( %#"& <33 ( (3= > < <<< "'?;?# 2908&?8"&@A8"'8' 2908&?8"&@A8@@A# /"#@8" DOKTORSAVHANDLINGAR FRÅN INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK 48 Voices for Change Hopes and costs for empowerment – a study on women’s claims in the Egyptian revolution Christine Bendixen ©Christine Bendixen, Stockholm University 2017 Front cover: ©IBL Bildbyrå ISBN 978-91-7649-139-3 ISBN 978-91-7649-664-0 Printed in Sweden by US-AB, Stockholm 2017 Distributor: Department of Education Previous series of Doctoral Thesis: “Avhandlingar från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete no 1-10 and ” Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen no 1-171”. “Neither the life of an individual nor the history of a -

A Case Study of Women and Graffiti in Egypt
Re-Defining Revolution: A Case Study of Women and Graffiti in Egypt by Stephanie Perrin B.A., Ryerson University, 2012 Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in the School of International Studies Faculty of Arts and Sciences Stephanie Perrin 2015 SIMON FRASER UNIVERSITY Fall 2015 Approval Name: Stephanie Jane Perrin Degree: Master of Arts (International Studies) Title: Re-Defining Revolution: A Case Study of Women and Graffiti in Egypt Examining Committee: Chair: Dr. Christopher Gibson Assistant Professor Dr. Tamir Moustafa Senior Supervisor Associate Professor Dr. Alexander Dawson Supervisor Professor Department of History Dr. Judith Marcuse External Examiner Adjunct Professor Faculty of Education Date Defended/Approved: 2 December, 2015 ii Abstract Like any social phenomenon, revolutions are gendered. The male tilt of revolutionary processes and their histories has produced a definition of revolution that consistently fails women. This thesis aims to redefine revolution to incorporate women’s visions of societal transformation and the full achievement of their rights and freedoms. I argue that approaches to women’s revolutionary experiences are enriched by focusing on the roles of culture, consciousness, and unconventional revolutionary texts. Egypt is examined as a case study with a focus on the nation’s long history of women’s activism that took on new forms in the wave of socio-political upheaval since 2011. Using interdisciplinary, visual analysis, I examine graffiti created by women, or that depict women between 2011 and 2015 to reveal how gender was publicly re-imagined during a period of flux for Egyptian society. The historical and visual analysis contribute to a new definition of revolution, one that strives to achieve the total transformation of society by disrupting gendered consciousness to finally secure rights and freedoms for all. -

Ancient and Modern Egypt and Israel,- June 20-22, 1991
DOCUMENT RESUME ED 350 210 SO 022 346 TITLE Compendium of Curriculum Projects for 1991 Fulbright-Hays Seminars Abroad Program: Ancient and Modern Egypt and Israel,- June 20-22, 1991. INSTITUTION Institute of International Education, New York, N.Y. SPONS AGENCY Center for International Education (ED), Washington, DC. PUB DATE 92 NOTE 318p.; Some materials may not reproduce clearly. PUB TYPE Guides Classroom Use Teaching Guides (For Teacher)(052) EDRS PRICE MFO1 /PC13 Plus Postage. DESCRIPTORS *Area Studies; Elementary Secondary Education; Foreign Countries; *Global Approach; Instructional Materials; *Multicultural Education; Social Studies; Study Abroad; *Teacher Developed Materials; Travel IDENTIFIERS *Egypt; Fulbright Teacher Exchange Program; *Israel; Middle East ABSTRACT These curriculum projects were produced by teachers who traveled to Egypt and Israel as part of the Fulbright-Hays Seminars Abroad Program. The materials developed by the educators were: Activities and Bibliography of Resources to Promote Student Involvement in a Class Study of Egypt and Egyptian Culture (Edith Baxter); Egypt at the Crossroads of Civilization: The Old Ways Change (Charlotte Nasser Byrd); A Comprehensive Unit on Israel for Sixth Graders Using the Five Themes of Geography (Joy Campbell; Janet Rinehart); Jerusalem: City of Peace (Frances S. Dubner; Bella Frankel); Eight-Year Old Mohammed Travels the Nile--Primary Grades Curriculum on Egypt (Monty Hawks); Taking Many Steps through Ancient and Modern Israel and Egypt (Tonya Houser); Lesson Plan: The Rise of Nazism and World War II--Stereotyping and the Holocaust (Jim Kelly); Promote International Understanding (Cynthia Kinstler); The Israeli-Palestinian Resolution: Homeland or Occupied Territory? (Bruce E. MaClean; Kelly A. Smith); Curriculum Project--Egypt (Kristine K. -

H.E. Suzanne Mubarak First Lady of the Arab Republic of Egypt Founder and President of the Suzanne Mubarak Women's International Peace Movement (SMWIPM)
H.E. Suzanne Mubarak First Lady of the Arab Republic of Egypt Founder and President of the Suzanne Mubarak Women's International Peace Movement (SMWIPM) Personal Data: - A sociologist born in Menya, Egypt. - Married and has two sons and two grandsons. Education: - Master’s degree in Sociology of Education. Topic of Thesis: “Social Action Research in Urban Egypt”: “A case study of primary school upgrading in Bulaq” - American university in Cairo, 1982. - B.A in Political Science, American University in Cairo 1977 - High School Diploma, St. Claire School Heliopolis, Cairo. International and Regional Activities: Keynote Speaker and Head of the Egyptian delegation to: - The United Nation World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development, and Peace, held in Nairobi, Kenya, 1985. 1 - The International Symposium on Children’s Books, held in Cairo, November 1986, Honorary Chairperson of the Symposium. - The Arab Regional Meeting on the establishment of the Arab Council for Children and Development, Amman, Jordan, April 1987. - The Conference on the International Convention on the Rights of the Child, Lignano Sabbiadoro, Italy, September 1987. - The 23rd Congress of the International Publishers Association, London, June 1988. - The Conference on the Future United Nations Convention on the Rights of the Child, Alexandria, November 1988. - UNICEF Executive Board, 1989 session, New York, April 1989. - Symposium on Women and Social Development: Past, Present and Future, organized by the American National Council of Negro Women, Cairo, July 1989. - Fourth African Regional Conference on Women and Development, Nigeria, November 1989. - The World Conference on Preparing for Climate Change, Cairo, December 1989.