Lammert-Türk 29.1.2017 Friedrich Weißler
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

DECLASS IFLED and RELEASED by • CEN2RAL 1117E11 I6E�NCE AGENCY F011-RCESMETHODSEXEMPT I on 3021 ,NA? I- MAR CA IMES 01 SCLOSORE AC1 -11Alt
DECLASS IFLED AND RELEASED BY • CEN2RAL 1117E11 I6ENCE AGENCY f011-RCESMETHODSEXEMPT I ON 3021 ,NA? I- MAR CA IMES 01 SCLOSORE AC1 -11Alt. 2007 - Kampfgruche . gegen Uhmenschlichkeit Berlin, 21. 11. 52 Pressestelle ZU den in Nummer 47 der WochenzeitEuThrift Der Spiegel" und in anderen Presseorganen Uber die Kazpfgruepe gegen Unmensch- lichkeit ersehienenen AUslassunger, nimmt diese vorlftufig wie folgt Stellung: 1.) Die. Auslassungen stench. den Versu h dar, der KgU die Schuld Dirt den nolitiscb.en Terror, insbesondere fUr die politiechen Verhaftungen von Jugendlichen in der Sowjetzone suzuschieben. 2.) Die . Auslassungen beruhemeinerseits auf den, von dem zowjetzonalen T ervorregime in der SBZ erhobenen Ar- schuldigungen mid dan in SchaUrrozessan gemachten Selbst- besichtLgungen colitischer Gefangc,ne-g , andererseits auf • der Zusammenstellung willkardich sus ciem wahren Zusammen.- hang. gerissener und entstellter Tatspeen. ,.) Jedem Binsichtigen ist klar, d o ss TOOT Prager:. des ni.d.er- standes der Offentlicikeit nur beschrankt Auskunft teilt werden kann, und dass deslielb Uffentilche Vellaum- dungen gegen die Kgil diese in nnfaTirer- Weise benachteiliger 4 ) Beabsichtigt oder unbeab p ichtig,: unterititzen solohe Aus- lassungen die von sowjetieTher Seite e-Ineschlagen jeweils die starksten Klaftc; (Ths Wira alb der westlichen Welt zu d1.12a r, i n i, and ziu iJcliermn, Dip Kampfgruppe gegn Unmenf.01 ehkeit lad.t 1,m. Matz 1952 - hacn- . deasie die gleich , p erderung bereits Fi±hjahr 1951 an or weptlichen Offentnchkeit erhoben hat - in eer Sowjetz .;ne don dOtigen $taatssicherheitsdiens als emo 7c1.1,1c;r:H.:b- Olga n(satihn angeprangart: SeitThm habc.: der seine Hand- langer j "hide Benjamin. Genur _...staatsanwalL Melzheimer, Leine Gilegenheit voriibergehen , i g.sse-,, um ibTerseits Cie KgU als Vsr- brecherorganiSatior ZugleicTh -,.uten -2:- die Bev011ibrung der SbZ r.,.f.ol.BsrThrung mit der KgU abzu- schrecken, Die Bevbh,,thag in der SBZ hat sich jedoch an der wahren VC Recht . -

Honoring and Perpetuating the Legacy of Dietrich Bonhoeffer
Honoring and Perpetuating the Legacy of Dietrich Bonhoeffer The 2014 Charles H. Hackley Distinguished Lecture in the Humanities May 8, 2014 It is a great privilege to stand before you tonight and deliver the 2014 Charles H. Hackley Distinguished Lecture in the Humanities, and to receive this prestigious award in his name. As a child growing-up in Muskegon in the 1950s and 1960s, the name of Charles Hackley was certainly a respected name, if not an icon from Muskegon’s past, after which were named: the hospital in which I was born, the park in which I played, a Manual Training School and Gymnasium, a community college, an athletic field (Hackley Stadium) in which I danced as the Muskegon High School Indian mascot, and an Art Gallery and public library that I frequently visited. Often in going from my home in Lakeside through Glenside and then to Muskegon Heights, we would drive on Hackley Avenue. I have deep feelings about that Hackley name as well as many good memories of this town, Muskegon, where my life journey began. It is really a pleasure to return to Muskegon and accept this honor, after living away in the state of Minnesota for forty-six years. I also want to say thank you to the Friends of the Hackley Public Library, their Board President, Carolyn Madden, and the Director of the Library, Marty Ferriby. This building, in which we gather tonight, St. Paul’s Episcopal Church, also holds a very significant place in the life of my family. My great-grandfather, George Alfred Matthews, came from Bristol, England in 1878, and after living in Newaygo and Fremont, settled here in Muskegon and was a very active deacon in this congregation until his death in 1921. -

Editor's Introduction to the English Edition
Victoria J. Barnett Editor’s Introduction to the English Edition This volume documents the course of Dietrich Bonhoeffer’s life and work from November 1937 to March 1940—a brief but decisive span of history that included the March 1938 Anschluß of Austria; the Evian refugee conference in France, at which thirty-two nations decided against easing immigration restrictions on Jewish refugees; the Sudeten crisis and Munich agreement, which led to the ceding of the Sudetenland to Nazi Germany; the November 1938 pogrom in Nazi Germany (Kristallnacht); and finally the beginning of the Second World War with the German invasion of Poland on September 1, 1939. Although the death camps were yet not in operation, the mass killings of Jews in eastern Europe began immediately with the German invasion of the east, and the “euthanasia” program—the Nazi murders of institutionalized patients—began in late 1939. Through- out this period there was a steady intensification not only of Nazi anti-Jew- ish laws but of laws and open violence against Jews throughout Europe. For the Confessing Church, it was a bleak period that exposed both the church’s lack of internal unity and its utter failure to oppose National Socialism. The early unanimity against the extreme “Aryan” theology of the German Christians had dissolved by the October 1934 Dahlem synod. Even most of those who hewed to the “radical” Dahlem line were not necessarily opponents of National Socialism. Nonetheless, in the wake of Dahlem the more radical members of the Confessing Church found themselves in a precarious political position—particularly in the Prussian churches, where 1 2 Editor’s Introduction to the English Edition German Christians held governing positions and a state church commis- sioner (August Jäger) had been appointed to oversee the churches and was watching closely for any sign of potential political opposition that might emerge from Confessing Church circles.[1] In the immediate wake of the Dahlem synod, such opposition seemed possible. -

Rede Zu Friedrich Weissler: Das Recht – Das Kleid Der Freiheit Gedenkstunde Zur Reichspogromnacht 9./10
Rüdiger Weyer: Friedrich Weissler 1 Rede zu Friedrich Weissler: Das Recht – das Kleid der Freiheit Gedenkstunde zur Reichspogromnacht 9./10. November 1938 Bad Laasphe, den 9. November 2005 Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Frau Weissinger, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke für die Einladung, hier in dieser Gedenkstunde an Friedrich Weissler erinnern zu dürfen. Es ist für mich eine ehrenvolle Aufgabe, der ich mich gerne gestellt habe und stelle. 0 Vorbemerkung Mich treibt bei dieser Aufgabe ein persönliches Interesse, da ich schon in meiner Staatsarbeit vor einigen Jahren Fr. Weissler begegnet bin, ohne aber irgendwo eine zusammenhängende Darstellung über ihn gefunden zu haben. Die Beauftragung zu einem Lexikonartikel, den ich inzwischen abgeschlossen habe und der erschienen ist, hat mich zusätzlich neugierig gemacht. Obwohl Friedrich Weissler nichts mit Laasphe und der Region zu tun hat, will ich dennoch versuchen, ganz vorsichtig eine organische, in- haltliche Brücke zu schlagen. Lassen Sie mich aber zuvor mit einem aktuellen Jahrestag beginnen: 1 Vor genau 60 Jahren: Stuttgarter Schulderklärung Als in Deutschland nach Kriegsende der neu gegründete Rat der Evan- gelischen Kirche am 18./19. Oktober 1945 in Stuttgart tagt, tauchen recht unerwartet einige Vertreter des Ökumenischen Rates der Kir- chen (ÖRK) auf. Die Atmosphäre zwischen den ausländischen Kir- chenvertretern und den deutschen ist gut. Einer der Teilnehmer schreibt: „Abgesehen von der Tatsache, dass ihr Verhalten wirklich brü- derlich war, dass sie auch im äußeren Habitus weder als Phari- säer noch als Richter auftraten, war es doch ganz klar, dass sie mit großem Ernst darauf bestehen mussten, ein klärendes Wort von unserer Seite zu hören, das die Vergangenheit be- reinigte.“ 1 Schnell war einen Großteil der »Stuttgarter Schuld- erklärung« entworfen und verfasst, in die Martin Niemöller den entscheidenden Satz einfügt: „Mit großem Schmerz sagen wir: Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. -

Vergeßt Sie Nicht! Freiheit War Ihr Ziel – Die Kampfgruppe Gegen Unmenschlichkeit
60 ZdF 24/2008 Vergeßt sie nicht! Freiheit war ihr Ziel – Die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit Jochen Staadt Unter dem Titel Deckname Walter erschien 1953 im Berliner Kongreß-Verlag eine Bro- schüre mit dem Untertitel „Enthüllungen des ehemaligen Mitarbeiters der sogenann- ten ‚Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit‘, Hanfried Hiecke“. Der Kongreß-Verlag war das Sprachrohr der Nationalen Front des Demokratischen Deutschland. Die Bro- schüre selbst haben aber weder Hanfried Hiecke noch die Nationale Front verfaßt, sie entstand in den Schreibstuben des Ministeriums für Staatssicherheit. Eingangs der Bro- schüre stellt sich Hiecke (Jahrgang 1929) als Sprößling eines christlichen Elternhauses vor. Er habe vier Semester Theologie studiert und sich dann der „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit“ (KgU) in West-Berlin angeschlossen. Vom Sommer 1949 bis Früh- jahr 1951 habe er als „offizieller Mitarbeiter“ in der KgU gearbeitet, zunächst in der Registratur für verschleppte Personen, seit Herbst 1950 als Leiter des Referats Sach- sen. Vom Frühjahr bis Mitte August 1951 will Hiecke nach eigenen Angaben für das amerikanischen Military Intelligence Detachment (MID) und danach für den britischen Geheimdienst Military Intelligence (MI) tätig gewesen sein. Die Broschüre Deckna- me Walter sollte „dem deutschen Volk Aufschluß geben über das verbrecherische Sy- stem des amerikanischen Agentendienstes und seiner Trabanten“. Der jüngst vor dem Obersten Gericht der DDR geführte Prozeß gegen die „Buraniek-Bande“ habe bewie- sen, „daß vom Westen aus Sprengstoffanschläge und Sabotageakte gegen Leben und Er- rungenschaften der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik systematisch organisiert werden“. Eine Zentrale dieses „organisierten Verbrechens“ sei die KgU, die „niemals eine deutsche Organisation gewesen ist, sondern ausschließlich im amerikani- schen Interesse gegründet, ein Werkzeug der USA zur Vorbereitung eines neuen Krieges darstellt“. -

Inventory for Baures Collection
Inventory of Baures Collection 3: Documents 1. Foreign. Australia. Royal Commission on Espionage. Official transcripts of proceedings. 6 vols. 1. May-August 1954 2. September 1954 3. October-December 1954 4. January 1955 5. February-March 1955 6. Index to official transcript of proceedings. Paper. Australia. Royal Commission on Espionage. Report. 22 August 1955. Sydney, 1955. (2 copies, 1 storage). Canada. Royal Commission to investigate the facts relating to and the circumstances surrounding the communication, by public officials and other persons in positions of trust of secret and confidential information to agents of a foreign power. Report. June 27, 1946. Paper. U.S.S.R. People’s Commissariat of Justice. Report of court proceedings in the case of the Anti- Soviet “Bloc of Rights and Trotskyites” heard before the military collegium of the supreme court of the U.S.S.R., Moscow, March 2-13, 1938. Moscow: People’s Commissariat of Justice of the U.S.S.R., 1938. 2. State. California. Senate Investigating Committee on Education. 1. 1948 Regular Session. 3rd Report. Staple. (2 copies, 1 storage) 2. 1949 Regular Session. 1) 4th Report. Staple. (2 copies, 1 storage) 2) 5th Report. Staple. 3) 6th Report. Staple. (2 copies, 1 storage) 3. 1950 Regular Session. 7th Report. Staple. 4. 1951 Regular Session. 1) 8th Report. Staple. (3 copies, 2 storage) 2) 9th Report. Staple. (3 copies, 2 storage) 5. 1952 Second Extraordinary Session. 10th Report. Staple. (3 copies, 2 storage) 6. 1953 Regular Session. 11th Report. Staple. (2 copies, 1 storage) 7. 1955 Regular Session. 1) 12th Report. Staple. -

Die Behandlung Entfernter Möglichkeiten«
Dr. Alfred Groß · Dr. Günter Grosser · Dr. Max Grumach · Dr. Ernst Grünbaum · Friedrich (Fritz) Grünbaum · Josef Grüneberg · »Die Behandlung Dr. Eduard Guckenheimer · Dr. Adolf Guhrauer · Dr. Ernst Guradze · Dr. Walter Gutkind · Dr. Else Guttmann · Max Guttmann · Dr. Gerhard Haas · Dr. Arthur Haase · Hugo Haase · Dr. Albert Hahn · Dr. Fritz Hahn · Alexis Hallervorden · Dr. Georg Hamburger · entfernter Möglichkeiten« Dr. Hans Nathan Hamburger · Dr. Erna Haßlacher · Dr. Artur Hecht · Dr. Hans Heggemann · Werner Heilbronn · Otto Heilbrunn · Dr. Werner Heimann · Dr. rer. pol. Julius Heine · Dr. Franz Bruno Heinemann · Prof. Dr. Ernst Heinitz · Dr. Franz Heinsheimer · Lud- wig Heinsheimer · Max Heinsheimer · Saly Heldt · Dr. Fritz Herrmann · Fritz Herrmann · Dr. Herbert Herrmann · Otto Hermanns · Kurzkommentare Ignatz Herrnstadt · Berthold Herz · Carl Herz · Curt (Kurt) Herzfeld · Ernst Heß · Hugo Heß · Georg Heymann · Dr. Max Heymann · Dr. Rudolf Heymann · Max Hinrichsen · Bernhard Hirsch · Dr. Ernst Hirsch · Eduard Hirschberg · Dr. Erich Hirschberg · Dr. Georg Hirschberg · Hans-Walter Hirschberg · Siegbert Hirschbruch · Fritz Hirschfeld · Dr. Gotthard Hirschfeld · Dr. Harry Hirschfeld · Dr. Jean Hirschfeld · Dr. Leo Hirschfeld · Dr. Herbert Hirschwald · Dr. Viktor Hoeniger · Walter (Walther) Hoeniger · Max Bernhard Hoffmann · Richard Hoffmann · Dr. Günther Holberg · Dr. Ernst Holländer · Nathan Hölzer · Richard Horwitz · Konrad Hübner · Dr. Herman (German) Ihm · Siegfried Ikenberg · Dr. Kurt Imberg · Alfred Islar · Georg Jacob · Dr. Paul Jacobi · Dr. Reinhard Jacobi · Fritz Jacobsen · Dr. Otto Jacobsen · Dr. Alfred Jacobsohn · Karl Jacoby · Walter Jacoby · Dr. Samuel Jadesohn · Ludwig Jaffé · Richard Jaffé · Dr. Bernhard Jahl · Alexander Jastrow · Dr. Ernst Joel · Adalbert Jonas · Fritz Jonas · Dr. Georg Dr. Leonhard Adam · Dr. Arthur (Artur) Adler · Berthold Altmann · Ferdinand Altschüler · Alexander Ansbacher · Dr. Benno Arnade · Jonas · Dr. -

This Is an Open Access Document Downloaded from ORCA, Cardiff University's Institutional Repository
This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: http://orca.cf.ac.uk/118709/ This is the author’s version of a work that was submitted to / accepted for publication. Citation for final published version: Clarke, David 2018. Constructing victimhood in divided Germany. Memory Studies 11 (4) , pp. 422-436. 10.1177/1750698016688239 file Publishers page: http://dx.doi.org/10.1177/1750698016688239 <http://dx.doi.org/10.1177/1750698016688239> Please note: Changes made as a result of publishing processes such as copy-editing, formatting and page numbers may not be reflected in this version. For the definitive version of this publication, please refer to the published source. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite this paper. This version is being made available in accordance with publisher policies. See http://orca.cf.ac.uk/policies.html for usage policies. Copyright and moral rights for publications made available in ORCA are retained by the copyright holders. Constructing Victimhood in Divided Germany: The Case of the Association of the Victims of Stalinism (1950-1989) Introduction The second half of the twentieth century saw a shift in the meaning of victimhood in post-conflict situations and in the wake of democratic transitions. While the construction of victimhood in collective memory can be regarded as a ‘traumatic embodiment of collective identity’ (Giesen, 2004: 10), such ‘trauma’ is now less frequently understood in terms of a martyrdom in the service of the nation. Instead, victims of historical injustice are increasingly regarded as having suffered in the name of transnational principles of human rights (Levy and Sznaider: 2006), as ‘bearers of history’ (Wieviorka, 2006: 88) whose testimony plays a significant role in preventing future atrocity. -

GRANT, ALAN G., Jr.: PAPERS, 1927-2003
DWIGHT D. EISENHOWER LIBRARY ABILENE, KANSAS GRANT, ALAN G., Jr.: PAPERS, 1927-2003 Accession No.: A 03-7 Processed by: DJH/HP Date Completed: June 2011 The papers of Alan G. Grant, Jr., a Florida attorney who was the originator and promoter of the Freedom Academy concept, were donated to the Eisenhower Library in 2003 by Mr. Grant. Linear feet shelf space occupied: 13 Approximate number of pages: 30,000 Approximate number of items: 8,700 In January 2003 Mr. Alan G. Grant, Jr. executed an Instrument of Gift for his papers. The donor has assigned to the United States of America all copyrights which he has in the materials being donated or in any of the donor’s writings that may be among other collections of papers received by the U.S. and deposited in a facility administered by NARA. By agreement with the donor the following classes of documents will be withheld from research use: 1. Papers and other historical materials the disclosure of which would constitute a clearly unwarranted invasion of personal privacy of a living person. 2. Papers and other historical materials that are specifically authorized under criteria established by statute or executive order to be kept secret in the interest of national defense or foreign policy, and are in fact properly classified pursuant to such statute or executive order. SCOPE AND CONTENT NOTE The Alan G. Grant, Jr. Papers contain wealth of materials relating to the efforts of Grant and his associates on the Orlando Committee to create a Freedom Academy and a Freedom Commission as a way to train American citizens for psychological warfare with the Communists. -
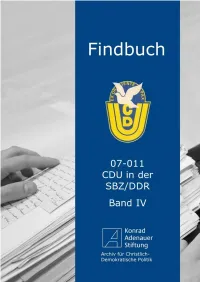
Findbuch Der CDU in Der SBZ/DDR Band IV
ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 07 – 011 CDU IN DER SBZ/DDR BAND IV SANKT AUGUSTIN 2018 I Inhaltsverzeichnis 1 Hauptgeschäftsstelle - Mitglieder Sekretariat mit Abteilungen und Referaten 1945 - 1990 1 1.1 Mitglieder Sekretariat bzw. Wissenschaftliche Mitarbeiter 1969 -1989 1 1.1.1 Zentrale Veranstaltungen 1987 - 1989 1 1.1.2 Fahl, Ulrich 1984 - 1989 1 1.1.3 Fischer, Gerhard 1981 - 1989 1 1.1.4 Niggemeier, Adolf 1989 - 1990 1 1.1.5 Ordnung, Karl 1959 - 1990 2 1.1.5.1 Abteilung "Frieden und Sicherheit" 1989 - 1990 2 1.1.5.2 Berichte und Vermerke 1960 - 1990 2 1.1.5.3 Korrespondenz 1964 - 1990 4 1.1.5.3.1 Allgemein 1964 - 1976 4 1.1.5.3.2 DDR 1975 - 1990 5 1.1.5.3.3 Westdeutschland 1968 - 1990 6 1.1.5.3.4 Ausland 1975 - 1990 7 1.1.5.4 Pressearbeit (Gutachten und Manuskripte) 1959 - 1989 7 1.1.5.5 Veröffentlichungen 1975 - 1989 9 1.1.5.6 Evangelisch-methodistische Kirche 1969 - 1989 9 1.1.6 Wirth, Günter 1951 - 1990 10 1.1.6.1 Chefredakteur STANDPUNKT 1969 - 1990 10 1.1.6.2 Parteileitung 1951 - 1989 10 1.1.6.3 Wissenschaftliche Arbeitsgruppe 1990 11 1.1.6.4 Bezirksverbände und Kreisverbände 1959 - 1990 11 1.1.6.5 Bezirksverband 15 Berlin 1966 - 1990 11 1.1.7 Wünschmann, Werner 1966 - 1989 11 1.1.8 Zillig, Johannes 1976 - 1989 13 1.2 Parteivorsitzender - Abteilung Finanzen, Gästehäuser, Ferienhäuser und Verwaltung 13 1945 - 1990 1.2.1 Abteilung Finanzen - Haushalt und Bilanzen CDU, Bezirksverbände, 13 Kreisverbände, VOB-Union 1945 - 1990 1.2.1.1 Richtlinien und Revision 1945 - 1990 13 1.2.1.1.1 -

The German Evangelical Church and the Nazi State
NO “SPOKE IN THE WHEEL”: THE GERMAN EVANGELICAL CHURCH AND THE NAZI STATE By HANNAH D’ANNE COMODECA Bachelor of Arts in History and Political Science Oklahoma Baptist University Shawnee, OK 2012 Submitted to the Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of MASTER OF ARTS May, 2014 NO “SPOKE IN THE WHEEL”: THE GERMAN EVANGELICAL CHURCH AND THE NAZI STATE Thesis Approved: Dr. Joseph F. Byrnes Thesis Adviser Dr. Ronald A. Petrin Dr. John te Velde ii Name: HANNAH D’ANNE COMODECA Date of Degree: MAY, 2014 Title of Study: NO “SPOKE IN THE WHEEL’: THE GERMAN EVANGELICAL CHURCH AND THE NAZI STATE Major Field: HISTORY Abstract: This study focuses on the relationship between the German Evangelical Church and the Nazi state from 1933-1945 and the reasons why the Church did not oppose state policies of persecution of the Jews. Through primary sources of sermons, synodal decisions, and memoirs, this study finds that during the years of the Third Reich, the German Evangelical Church retreated into itself. The internal conflicts that some historians have termed “the Church Struggle” distracted the Church from problems in the state. While some individuals within the Church did oppose state policies, the German Evangelical Church, as an institution, only protested when it felt directly threatened by the state. iii There are three possible ways in which the church can act towards the state: in the first place, as has been said, it can ask the state whether its actions are legitimate and in accordance with its character as state, i.e. -

Unknown Month 1939
Today’s Martyrs Resources for understanding current Christian witness and martyrdom Events – unknown month 1939 Russia: Loino, Kirov region Fr Karapet Diliurgian (aged 78, preached a homily in 1915 to the entire Armenian population of Artvin, Turkey that they give up their wealth to save their lives during the Genocide, collected their gold and bought their safe passage to the Caucasus; arrested in Krasnodar, Russia in June 1936; sentenced to 3 years' internal exile; UPDATE: released from internal exile on the condition he would no longer perform his ministry, settled in Ochamchira, Abkhazia, Georgia and continued his ministry until his death, baptized children while they slept so they would not disclose their baptism under interrogation) https://biographies.library.nd.edu/catalog/biography-0233 Egypt: Old Cairo Fr Mina el-Baramousy aka Azer Youssef Atta (aged 37, the future Pope Kyrillos VI, beaten in a murder attempt in his hermitage by bandits, hospitalized, one bandit later asked for forgiveness after the other two were arrested or killed) https://openlibrary.org/books/OL27765146M/A_Silent_Patriarch pg 140-141 Poland Fr Adolf Kucharski (arrested by the Soviets in the autumn, sent to a camp) Fr Boleslaw Chuczynski O.Carm (aged 35, military chaplain, arrested by the Soviets, sent to Kozelsk POW camp) Fr Jozef Bednarczyk (aged 37, Polish army chaplain, arrested by the Soviets in late 1939, sent to a camp) Fr Jozef Janczurewicz (arrested in the autumn of 1939 by the Soviets, sent to a camp) Fr Jozef Jaworski (aged 58, arrested by the Soviets, sent to a camp) Fr Nikolay Ilkov (aged 49, military chaplain, captured by the Soviets, sent to Kozelsk POW camp) Fr Otto Ewald (aged 26, arrested by the Soviets, charged with espionage, sentenced to 10 years' imprisonment in a labor camp, sent to Ukhtizhemlag) Fr Teodor Chucal (aged 44, U.S.