Fleckfieberforschung Im Deutschen Reich 1914 - 1945
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Alternate History – Alternate Memory: Counterfactual Literature in the Context of German Normalization
ALTERNATE HISTORY – ALTERNATE MEMORY: COUNTERFACTUAL LITERATURE IN THE CONTEXT OF GERMAN NORMALIZATION by GUIDO SCHENKEL M.A., Freie Universität Berlin, 2006 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (German Studies) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (Vancouver) April 2012 © Guido Schenkel, 2012 ABSTRACT This dissertation examines a variety of Alternate Histories of the Third Reich from the perspective of memory theory. The term ‘Alternate History’ describes a genre of literature that presents fictional accounts of historical developments which deviate from the known course of hi story. These allohistorical narratives are inherently presentist, meaning that their central question of “What If?” can harness the repertoire of collective memory in order to act as both a reflection of and a commentary on contemporary social and political conditions. Moreover, Alternate Histories can act as a form of counter-memory insofar as the counterfactual mode can be used to highlight marginalized historical events. This study investigates a specific manifestation of this process. Contrasted with American and British examples, the primary focus is the analysis of the discursive functions of German-language counterfactual literature in the context of German normalization. The category of normalization connects a variety of commemorative trends in postwar Germany aimed at overcoming the legacy of National Socialism and re-formulating a positive German national identity. The central hypothesis is that Alternate Histories can perform a unique task in this particular discursive setting. In the context of German normalization, counterfactual stories of the history of the Third Reich are capable of functioning as alternate memories, meaning that they effectively replace the memory of real events with fantasies that are better suited to serve as exculpatory narratives for the German collective. -

Animal Experimentation: Lessons from Human Experimentation
ANIMAL EXPERIMENTATION: LESSONS FROM HUMAN EXPERIMENTATION By Arthur Birmingham LaFrance* Conventionalwisdom tells us that animal experimentationis a relevant pre- cursor to human experimentation. The failings of human experimentation to protect human subjects, however, raise serious questions as to the safety and appropriateness of experimentation on animals. The federal government and medical community, since World War II, have used the Nuremberg Code and the federal "Common Rule" to determine how to conduct human experimentation ethically. Due to political or economic factors, government entities, hospitals, researchers,and pharmaceuticalcompanies have contin- ued to conduct human experimentation without the informed consent of their subjects. These human experiments have often achieved meaningless- or worse-devastatingresults. Because safeguards have failed with human experimentation, the federal and local governments, in conjunction with animal advocacy organizations, should take a series of concrete steps to eliminate an experimenter's ability to cause pain, suffering, and unneces- sary death to animals. I. INTRODUCTION: PRINCIPLE AND EXPERIENCE ........ 29 II. THE HUMAN FAILINGS ................................. 33 A. Institutions and Rules ................................. 33 B. Cases in Point ........................................ 38 III. IMPLICATIONS FOR ANIMAL EXPERIMENTATION ...... 43 A. The Natural Order of Things ........................... 43 B. Specific Steps for Protection ............................ 47 IV. CONCLUSION -

From Humiliation to Humanity Reconciling Helen Goldman’S Testimony with the Forensic Strictures of the Frankfurt Auschwitz Trial
S: I. M. O. N. Vol. 8|2021|No.1 SHOAH: INTERVENTION. METHODS. DOCUMENTATION. Andrew Clark Wisely From Humiliation to Humanity Reconciling Helen Goldman’s Testimony with the Forensic Strictures of the Frankfurt Auschwitz Trial Abstract On 3 September 1964, during the Frankfurt Auschwitz trial, Helen Goldman accused SS camp doctor Franz Lucas of selecting her mother and siblings for the gas chamber when the family arrived at Birkenau in May 1944. Although she could identify Lucas, the court con- sidered her information under cross-examination too inconsistent to build a case against Lucas. To appreciate Goldman’s authority, we must remove her from the humiliation of the West German legal gaze and inquire instead how she is seen through the lens of witness hospitality (directly by Emmi Bonhoeffer) and psychiatric assessment (indirectly by Dr Walter von Baeyer). The appearance of Auschwitz survivor Helen (Kaufman) Goldman in the court- room of the Frankfurt Auschwitz trial on 3 September 1964 was hard to forget for all onlookers. Goldman accused the former SS camp doctor Dr Franz Lucas of se- lecting her mother and younger siblings for the gas chamber on the day the family arrived at Birkenau in May 1944.1 Lucas, considered the best behaved of the twenty defendants during the twenty-month-long trial, claimed not to recognise his accus- er, who after identifying him from a line-up became increasingly distraught under cross-examination. Ultimately, the court rejected Goldman’s accusations, choosing instead to believe survivors of Ravensbrück who recounted that Lucas had helped them survive the final months of the war.2 Goldman’s breakdown of credibility echoed the experience of many prosecution witnesses in West German postwar tri- als after 1949. -
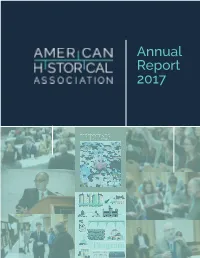
Annual Report 2017
Annual Report 2017 Program Cover.indd 1 05/10/17 7:26 PM Table of Contents Minutes of the 132nd Business Meeting ................................................................................. 2 Officers’ Reports .................................................................................................................... 7 Professional Division Report ...................................................................................................... 8 Research Division Report ......................................................................................................... 10 Teaching Division Report ......................................................................................................... 12 American Historical Review Report .......................................................................................... 15 AHR Editor’s Report ............................................................................................................. 15 AHR Publisher’s Report ....................................................................................................... 31 Pacific Coast Branch Report ................................................................................................. 48 Committee Reports .............................................................................................................. 50 Committee on Affiliated Societies Report ............................................................................... 51 Committee on Gender Equity Report ..................................................................................... -

Santa Fe New Mexican, 10-03-1913 New Mexican Printing Company
University of New Mexico UNM Digital Repository Santa Fe New Mexican, 1883-1913 New Mexico Historical Newspapers 10-3-1913 Santa Fe New Mexican, 10-03-1913 New Mexican Printing company Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/sfnm_news Recommended Citation New Mexican Printing company. "Santa Fe New Mexican, 10-03-1913." (1913). https://digitalrepository.unm.edu/sfnm_news/3918 This Newspaper is brought to you for free and open access by the New Mexico Historical Newspapers at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Santa Fe New Mexican, 1883-1913 by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. 0 VOL. 50. SANTA FE, NEW MEXICO, FRIDAY, OCTOBER 3, 191Z, NO. 199. III questions of procedure," said Speaker SULZER WRITING a'liiii'K lace each other, the iai St Clark. iug that the federals gradually up; ' SCHMIDT CAUSE MEXICAN ENVOY I hack. Tin-- PUBLICITY FOR presidenTt The measure mist be put in such STORV OF HIS pushing heir opponents re- that skilled lawyers cannot pick constitutionalists claim to have shape SIDE OF AFFAIR the forces of Maas (laws in it." pulsed (lein'ral but it is no This was endorsed by Rep- last night, believed import- position ::. the Republican OF DEATH OF Albany, X. Y Cel. Judge O. C. RETURNS ant engagement has taken place. ANTA FE IS bill at resentative Payne, chief counsel for Governor Numerous of 0 sign leader. Derrick, reports fiiibusiering who lias been silent regard- and attempts tit "gun running" Joseph W. Folk, solicitor of the jSulzcT, plans ing the of the defense, went a have redoubled the vigilance of Amer- Etnte department, in a letter to Sena- plans further by into re-It- HOME ican troops the border. -

12/Issue 1/February 2012
The Journal of Effective Teaching an online journal devoted to teaching excellence Volume 12/Issue 1/February 2012 The Journal of Effective Teaching an online journal devoted to teaching excellence Volume 12/Issue 1/February 2012 Online at http://www.uncw.edu/cte/et/ The Journal of Effective Teaching an online journal devoted to teaching excellence EDITORIAL BOARD Editor-in-Chief Dr. Russell Herman, University of North Carolina Wilmington Editorial Board Caroline Clements, Psychology John Fischetti, Education1 Pamela Evers, Business and Law Russell Herman, Mathematics and Physics Mahnaz Moallem, Education Associate Editor Caroline Clements, UNCW Center for Teaching Excellence, Psychology Consultants Librarians - Sue Ann Cody, Rebecca Kemp Reviewers Sharon Ballard, East Carolina University, NC Scott Imig, UNC Wilmington, NC Alison Burke, Southern Oregon University, OR Robert Kenny, University of Central Florida, FL Barbara Chesler Buckner, Coastal Carolina, SC Amanda Little, Wisconsin-Stout, WI Donald Bushman, UNC Wilmington, NC Gabriel Lugo, UNC Wilmington, NC Kathleen Cook, Seattle University, WA Colleen Reilly, UNC Wilmington, NC Michelle d’Abundo, UNC Wilmington, NC Jana Robertson, UNC Wilmington, NC Donald Furst, UNC Wilmington, NC Tamara Walser, UNC Wilmington, NC Sarah Ginsberg, Eastern Michigan University, MI Handoyo Widodo, Politeknik Negeri Jember, ID Sibylle Gruber, Northern Arizona University, AZ Jianjun Wang, California State University, CA Submissions The Journal of Effective Teaching is published online at http://www.uncw.edu/cte/et/. All submissions should be directed electronically to Dr. Russell Herman, Editor-in-Chief, at [email protected]. The address for other correspondence is The Journal of Effective Teaching c/o Center for Teaching Excellence University of North Carolina Wilmington 601 S. -

Titel Strafverfahren
HESSISCHES LANDESARCHIV – HESSISCHES HAUPTSTAATSARCHIV ________________________________________________________ Bestand 461: Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Frankfurt am Main Strafverfahren ./. Robert Mulka u.a. (1. Auschwitz-Prozess) Az. 4 Ks 2/63 HHStAW Abt. 461, Nr. 37638/1-456 bearbeitet von Susanne Straßburg Allgemeine Verfahrensangaben Delikt(e) Mord (NSG) Beihilfe zum Mord (NSG) Laufzeit 1958-1997 Justiz-Aktenzeichen 4 Ks 2/63 Sonstige Behördensignaturen 4 Js 444/59 ./. Beyer u.a. (Vorermittlungen) Verfahrensart Strafverfahren Verfahrensangaben Bd. 1-133: Hauptakten (in Bd. 95-127 Hauptverhandlungsprotokolle; in Bd. 128-133 Urteil) Bd. 134: Urteil, gebundene Ausgabe Bd. 135-153: Vollstreckungshefte Bd. 154: Sonderheft Strafvollstreckung Bd. 155-156: Bewährungshefte Bd. 157-165: Gnadenhefte Bd. 166-170: Haftsonderhefte Bd. 171-189: Pflichtverteidigergebühren Bd. 190-220: Kostenhefte Bd. 221-224: Sonderhefte Bd. 225-233: Entschädigungshefte Bd. 234-236: Ladungshefte Bd. 237: Anlage zum Protokoll vom 3.5.1965 Bd. 238-242: Gutachten Bd. 243-267: Handakten Bd. 268: Fahndungsheft Baer Bd. 269: Auslobung Baer Bd. 270: Sonderheft Anzeigen Bd. 271-272: Sonderhefte Nebenkläger Bd. 273-274: Ermittlungsakten betr. Robert Mulka, 4 Js 117/64 Bd. 275-276: Zuschriften Bd. 277-279: Berichtshefte Bd. 280-281: Beiakte betr. Josef Klehr, Gns 3/80, Handakten 1-2 Bd. 282: Sonderheft Höcker Bd. 283: Zustellungsurkunden Bd. 284: Übersetzung der polnischen Anklage vom 28.10.1947 Bd. 285: Fernschreiben Bd. 286; Handakte Auschwitz der OStA I Bd. 287-292: Pressehefte Bd. 293-358: Akten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg Bd. 359-360: Anlageband 12 Bd. 361: Protokolle ./. Dr. Lucas Bd. 362: Kostenheft i.S. Dr. Schatz Bd. 363: Akte der Zentralen Stelle des Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg Bd. -

Fritz Bauer – Jurist Im Dienste Der Humanität
MINISTERIUM UND GESCHICHTE Fritz Bauer Jurist im Dienste der Humanität Fritz Bauer Jurist im Dienste der Humanität 5 Vorwort einschneidendes Ereignis. Schonungs- aller Art mit Nachdruck entgegen zu los und unverstellt wurde sie mit ihrer stellen, um in Frieden leben zu können. eigenen nationalsozialistischen Ver- gangenheit und deren Ver brechen Die Broschüre, die Sie in den Händen konfrontiert. Bei vielen führte dieser halten, wirft Schlaglichter auf die großen Blick in die Vergangenheit zu Beschä- Themen, die dieses Leben geprägt haben– mung und Erschütterung. Für seinen Beitrag zur Verhaftung von Adolf die deutsche Erinnerungskultur hat Eichmann und zur Rehabilitierung des Fritz Bauer Herausragendes geleistet. Widerstands vom 20. Juli 1944, den Auschwitz- Prozess und die Reform des Als streitbarer Mahner war Fritz Bauer in Strafrechts. Die Broschüre ergänzt damit der Öffentlichkeit seinerseits umstritten. die Bestrebungen meines Hauses – dessen Auch in den eigenen Reihen der Justiz Repräsentationshof seit 2019 nach Fritz stieß er teilweise auf erheb liche Ableh- Bauer benannt ist und das alle zwei Jahre nung, die bis hin zu offener Anfeindung den Fritz Bauer Studienpreis für Men- Nur wenige Juristinnen und Juristen in des Geschehenen. Die im Namen des reichte. Davon unbeirrt setzte er sich un- schenrechte und juristische Zeitge- der jungen Bundesrepublik besaßen den natio nal sozialistischen Unrechtsregimes erschrocken und unter erheblichen per- schichte verleiht –, das Leben und Wir- Mut, die Ausdauer und die moralische begangenen -

1945 the Aftermath of the Holocaust Scenario
THE AFTERMatH subject OF THE HOLOCAUST Context9. Historians of the Second World War, par- The painful truth was nevertheless re- ticularly the Holocaust, have not to date vealed, despite German attempts to hide been able to determine the exact number the scale of their crimes and destruction of Jews murdered at that time. Shortly af- of their evidence. Still during the war, gov- ter the war, the number was generally es- ernments of Allied countries fighting the timated to be approximately six million. It was Germans announced a court trial for those re- recognised that approximately four million died sponsible for crimes committed in occupied ter- in camps and the remaining two million in oth- ritories. This includes a declaration of 13 January er locations, primarily ghettos, and as a result of 1942 signed in London at a meeting headed by mass executions by Einsatzgruppen in the East. the Prime Minister of the Polish government-in-ex- These numbers were cited by the International ile Władysław Sikorski. Representatives of nine al- Military Tribunal in Nuremberg and were based on lied countries issued a written document on the German statistics. These statistics are nevertheless post-war prosecution of crime perpetrators. The inexact, because not all documentation on all Ger- exposed extent of genocide that took place dur- man crimes against Jews has been found. Addi- ing the war meant that public opinion in the free tionally, the Germans documented the Holocaust world demanded that all those guilty be swiftly with varying precision. Some aspects were scru- punished immediately after the war. -

Hans Schmidt Nazi
Hans schmidt nazi Continue Das SS-Thema entspricht möglicherweise nicht den Empfehlungen von Wikipedia zur Biografie. Bitte helfen Sie, die Möglichkeit zu etablieren, indem Sie zuverlässige sekundäre Quellen zitieren, die nicht unabhängig von dem Thema sind und eine signifikante Abdeckung davon für eine einfache triviale Erwähnung bereitstellen. Wenn die Verkaufschance nicht eingerichtet werden kann, wird der Artikel wahrscheinlich zusammengeführt, umgeleitet oder gelöscht. Quelle: Hans Schmidt Waffen-SS - Zeitungsbuchwissenschaftler JSTOR (November 2010) (Erfahren Sie, wie und wann diese Vorlagenmeldung entfernt wird) Hans SchmidtBorn (1927-04-24)24 April 1927V'lklingen, DeutschlandDiedMay 30, 2010 (2010-05-30) (alter 83)Nationalitynatized AmericanOccupationbusinessman, Der politische AktivistInthean Waffen-Ssfunder German-American National Committee for Political Action (GANPAC) Hans Schmidt (24. April 1927-30. Mai 2010) war ein eingebürgerter deutsch-amerikanischer Staatsbürger, Mitglied der Waffen-SS während des Zweiten Weltkriegs und Gründer des Deutsch-Amerikanischen Nationalkomitees für politische Aktion (GANPAC). Er war vor allem für seine Propaganda des weißen Separatismus, des Nationalsozialismus, des Antisemitismus und der Leugnung des Holocaust bekannt. Schmidt wurde 1995 in Deutschland wegen Hassvorwürfen verhaftet, vermied aber einen Prozess, indem er gegen Kaution in die USA zurückkehrte. Schmidts frühes Leben wurde am 24. April 1927 in Wolklingen geboren. Während der NS-Herrschaft gehörte er zur Hitlerjugend und trat nach eigenen Worten 1943 im Alter von 16 Jahren der Waffen-SS bei und diente als Korporal in der SS-Division von Leibstandard. Schmidt wurde zweimal bei Feldzügen in Ungarn, Österreich und der Schlacht von Bulge verwundet. 1947 verließ er Deutschland, kam 1949 in die Vereinigten Staaten und wurde 1955 in Chicago eingebürgert. 1983 gründete Schmidt das Deutsch-Amerikanische National Political Action Committee (GANPAC), das die GanPAC-Kurzbotschaft in englischer Sprache und den US-Bericht (US Report) auf Deutsch veröffentlichte. -

Destruction and Human Remains
Destruction and human remains HUMAN REMAINS AND VIOLENCE Destruction and human remains Destruction and Destruction and human remains investigates a crucial question frequently neglected in academic debate in the fields of mass violence and human remains genocide studies: what is done to the bodies of the victims after they are killed? In the context of mass violence, death does not constitute Disposal and concealment in the end of the executors’ work. Their victims’ remains are often treated genocide and mass violence and manipulated in very specific ways, amounting in some cases to true social engineering with often remarkable ingenuity. To address these seldom-documented phenomena, this volume includes chapters based Edited by ÉLISABETH ANSTETT on extensive primary and archival research to explore why, how and by whom these acts have been committed through recent history. and JEAN-MARC DREYFUS The book opens this line of enquiry by investigating the ideological, technical and practical motivations for the varying practices pursued by the perpetrator, examining a diverse range of historical events from throughout the twentieth century and across the globe. These nine original chapters explore this demolition of the body through the use of often systemic, bureaucratic and industrial processes, whether by disposal, concealment, exhibition or complete bodily annihilation, to display the intentions and socio-political frameworks of governments, perpetrators and bystanders. A NST Never before has a single publication brought together the extensive amount of work devoted to the human body on the one hand and to E mass violence on the other, and until now the question of the body in TTand the context of mass violence has remained a largely unexplored area. -

Holocaust Revisionism
Holocaust Revisionism by Mark R. Elsis This article is dedicated to everyone before me who has been ostracized, vilified, reticulated, set up, threatened, lost their jobs, bankrupted, beaten up, fire bombed, imprisoned and killed for standing up and telling the truth on this historical subject. This is also dedicated to a true humanitarian for the people of Palestine who was savagely beaten and hung by the cowardly agents of the Mossad. Vittorio Arrigoni (February 4, 1975 - April 15, 2011) Holocaust Revisionism has two main parts. The first is an overview of information to help explain whom the Jews are and the death and carnage that they have inflicted on the Gentiles throughout history. The second part consists of 50 in-depth sections of evidence dealing with and repudiating every major facet of the Jewish "Holocaust " myth. History Of The Jews 50 Sections Of Evidence "You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies." Jesus Christ (assassinated after calling the Jews money changers) Speaking to the Jews in the Gospel of St. John, 8:44 I well know that this is the third rail of all third rail topics to discuss or write about, so before anyone takes this piece the wrong way, please fully hear me out. Thank you very much for reading this article and for keeping an open mind on this most taboo issue.