11. Philharmonisches-Konzert
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
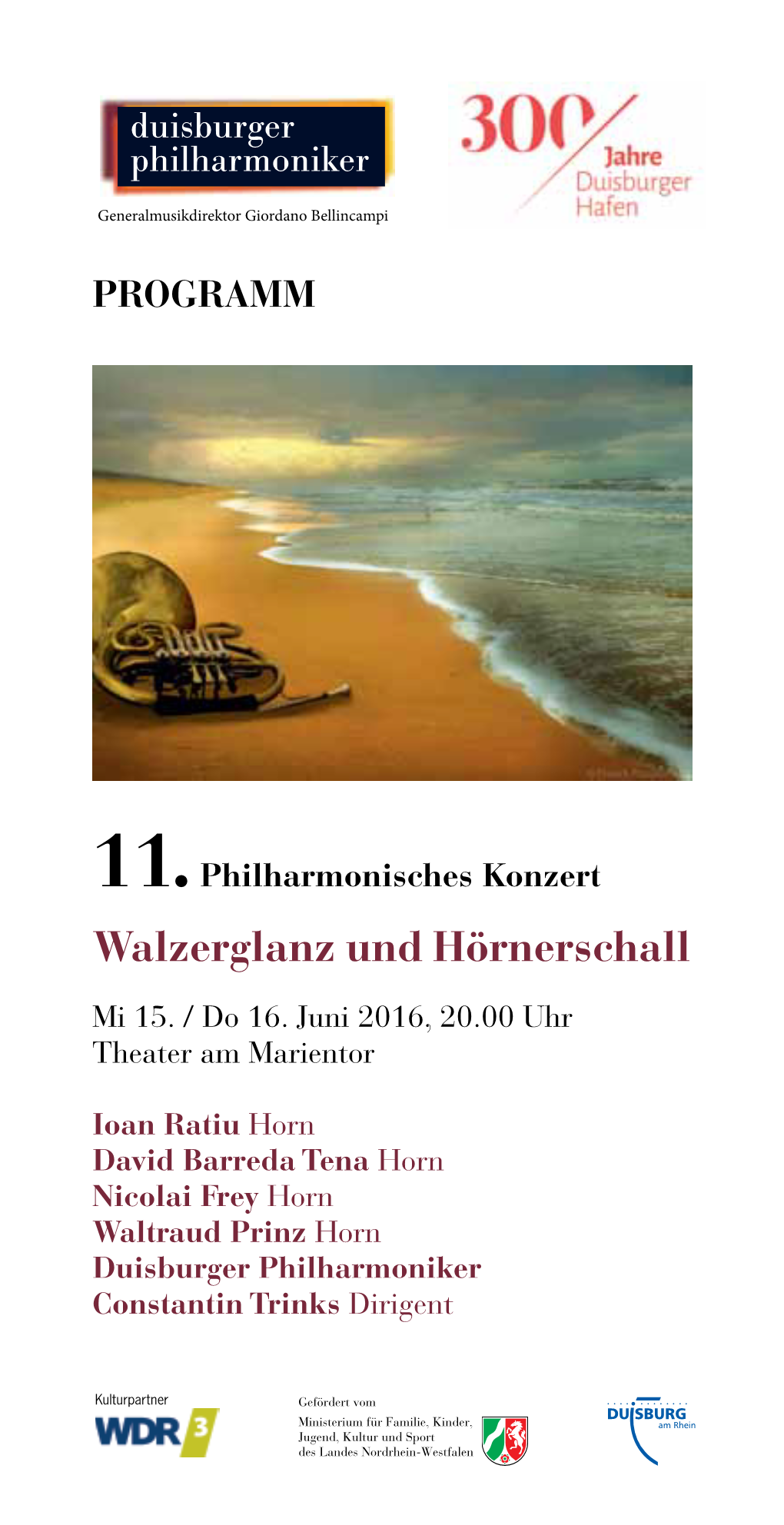
Load more
Recommended publications
-

Wo Wagner WAGNER Wurde. © F
ANZEIGE DRESden Wo Wagner WAGNER wurde. © F. Schrader SEMPEROPER DREsdEN FRAUENKIRCHE DREsdEN LaNDESBÜHNEN SAChsEN FILM & MUSIK Richard Wagner (1913), Premiere „Der fliegende Holländer“ Richard Wagner „Siegfried-Idyll“ „Das Liebesverbot“ Stummfilm von und mit Giuseppe Becce, Inszenierung von Florentine Klepper Franz Schubert: Streichquintett Große komische Oper von Richard Helmut Imig (Dirigent) mit Constantin Trinks, Tomáš Netopil C-Dur im Rahmen „20 Jahre Wagner 21.09. und 22.09.2013, 19:30 Uhr, (Dirigent) Moritzburg Festival“ 20.05.2013, 19:00 Uhr, Albertinum, Lichthof Premiere: 15.06.2013, 19:00 Uhr Es musizieren Künstler des Moritzburg Landesbühnen Sachsen in Radebeul Dresdner Philharmoniker weitere Termine: 19.06., 19:00 Uhr; Festivals und Teilnehmer der Moritzburg DREsdNER KaPELLKNABEN © Marco Borggreve 28.06., 17:00 Uhr; 01.07., 19:00 Uhr; Festival Akademie. Konzert „Opernchöre von Wagner 07.07., 19:00 Uhr; 28.08., 19:00 Uhr 17.08.2013, 20:00 Uhr und Verdi“ „Wagner & Schumann- TECHNisCHE UNivERsitÄT und 31.08.2013, 19:30 Uhr 02.06.2013, 17:00 Uhr, Versuch eines Dialogs“ DREsdEN (LEHRstUHL FÜR Giovanni Pierluigi da Palestrina Felsenbühne Rathen und Musikalische Landpartie zu Lebens- MUSIKwissENSChaft) Aufführung „Tannhäuser“ „Stabat mater“ 07.06.2013, 19:30 Uhr, und Wirkungsorten von Richard Inszenierung von Peter Konwitschny in einer Bearbeitung von Richard Albrechtsburg Meißen Wagner und Robert Schumann Ringvorlesung „Richard Wagner 31.10., 17:00 Uhr; 10.11., 16:00 Uhr Wagner, Dresdner Philharmonie/ 15.06.2013, ab 11:00 Uhr, in Dresden – eine Spurensuche“ und 17.11.2013, 16:00 Uhr Philharmonischer Chor Dresden StadtMUSEUM DREsdEN Coselpalais in Verbindung mit der SLUB und dem zu Gast in der Frauenkirche Stadtmuseum Dresden Aufführung „Tristan und Isolde“ 27.09.2013, 20:00 Uhr Sonderausstellung „Richard Wagner Festkonzert „Berührungen“ SLUB Dresden, Vortragssaal: Inszenierung von Marco Arturo Marelli in Dresden – Mythos und Geschichte“ Chorwerke von Richard Wagner 11.04., 25.04., 06.06. -

Programme 2016
71e CONCOURS DE GENÈVE INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION PROGRAMME 2016 CONCOURSGENEVE.CH Partenaire principal Croquis du sinistre Quoi qu’il arrive – nous vous aidons rapidement et simplement. mobiliere.ch Agence générale Genève Denis Hostettler Route du Grand-Lancy 6a 1227 Les Acacias T 022 819 05 55 [email protected] SOMMAIRE SUMMARY I. INTRODUCTION INTRODUCTION 3 Messages de bienvenue Official messages 3 Comment fonctionne le Jury How the Jury works 10 II. CONCOURS DE CHANT VOICE COMPETITION 11 Programme Programme 12 Prix et récompenses Prizes & awards 15 Candidats Candidates 17 Membres du Jury Jury members 28 Accompagnateurs Accompanists 40 Orchestre et chef Orchestra & conductor 42 III. CONCOURS DE QUATUOR STRING QUARTET À CORDES COMPETITION 45 Programme Programme 46 Prix et récompenses Prizes & awards 48 Candidats Candidates 51 Membres du Jury Jury members 60 Compositeur Composer 71 IV. AUTOUR DU CONCOURS AROUND THE COMPETITION 73 Concert d’ouverture Opening concert 75 Concert vernissage Concert inauguration 76 Pédagogie et médiation Education & mediation 77 V. LAURÉATS PRIZE-WINNERS 85 Programme de soutien Career development programme 86 Coup de Cœur Breguet Coup de Cœur Breguet Prize 89 Tournée des lauréats Laureates tour 91 Festival des lauréats Laureates festival 93 Interview du Quatuor Voce Interview of Quatuor Voce 95 Nouvelles des lauréats News of the laureates 100 VI. SOUTIENS SUPPORTS 107 Amis du concours Friends association 108 Partenaires et soutiens Partners & Supports 111 VII. PRATIQUE PRACTICAL 113 Billetterie, tarifs Tickets, prices 115 Lieux Places 118 Organisation Organization 119 Contacts Contacts 120 — 1 — ALTERNATIVE.CH | CI/UN/CH/F/121215 CI/UN/CH/F/121215 La discipline crée la stabilité. -

Christian Voight – Biography
Tenor Jack Price Managing Director 1 (310) 254-7149 Skype: pricerubin [email protected] Rebecca Petersen Executive Administrator 1 (916) 539-0266 Skype: rebeccajoylove [email protected] Olivia Stanford Marketing Operations Manager [email protected] Contents: Karrah O’Daniel-Cambry Biography Opera and Marketing Manager [email protected] Press Repertoire Mailing Address: YouTube Video Link 1000 South Denver Avenue Photo Gallery Suite 2104 Biography (German) Tulsa, OK 74119 Complete artist information including video, audio Website: http://www.pricerubin.com and interviews are available at www.pricerubin.com Christian Voight – Biography In March 2011 Christian Voigt gave his debut as Siegfried at the Opéra de Bastille in Paris under the baton of Philippe Jordan. For this part, he was also engaged to the Staatsoper Hannover and in October 2011 to the Staatstheater Darmstadt (the FAZ wrote Christian Voigt is splendid). Since 2008 he is a member of the Theater Freiburg, where he sang with a tremendous success Siegmund (Die Walküre) in 2009/10, 2010/11/12 and Siegfried in both parts (Siegfried and Götterdämmerung). In spring 2013 he sang Siegfried in Götterdämmerung with the Bamberger Symphoniker under the baton of Jonathan Nott. In 2009/10 he was nominated as upcoming Young Singer of the Year for his Siegfried (Götterdämmerung) by the journal Opernwelt. Christian Voigt gave his debut as Lohengrin in January 2013 and Parsifal in February 2013, both in Freiburg. As well, he sang Siegfried in Darmstadt. In October 2013 he hade a fantastic debut as Tristan in Oldenburg and in February/March 2014 great success as Tannhäuser in Freiburg. -

¶ Ariadne Auf Naxos RICHARD STRAUSS (1864-1949)
¶ Ariadne auf Naxos RICHARD STRAUSS (1864-1949) PYGMALION | L'AMOUR ET PSYCHÉ ¶ Ariadne auf Naxos RICHARD STRAUSS (1864-1949) 4 ¶ Ariadne auf Naxos ¶ Ariadne auf Naxos Richard Strauss (1864-1949) Oper in einem Aufzuge nebst einem Vorspiel Libretto von Hugo von Hofmannsthal Uraufführung am 4. Oktober 1916 an der Wiener Hofoper Zusätzliche Dialoge von Martin Crimp übersetzt von Ulrike Syah Mittwoch, den 28. & Freitag, den 30. April 2021 um 19.00 Uhr In Deutsch, mit deutscher & französischer Übertitelung Dauer: 2 St. 10 Min. & Pause Akt 1: 40 Min. Pause: 25 Min. Akt 2: 1 St. 25 Min. ¶ Koproduktion Festival d’Aix-en-Provence; Théâtre des Champs-Élysées; Nationale Oper Finnland; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Gran Teatre del Liceu; Royal Danish Opera Premiere dieser Produktion am 4. Juli 2018 in Aix-en-Provence Vorstellungen in Luxemburg in Zusammenarbeit mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg Einführung zur Oper von Herrn Jérôme Wigny der Amis de l’Opéra eine halbe Stunde vor jeder Vorstellung (in Französisch) 5 Ariadne auf Naxos Richard Strauss (1864-1949) Musikalische Leitung Lawrence Renes Regie Katie Mitchell Bühne Chloe Lamford Kostüme Sarah Blenkinsop Licht James Farncombe Dramaturgie Martin Crimp Choreographie Joseph W. Alford ¶ Co-Regie Lily McLeish Lichtregie Pierre Lafanachère Produktionsregie Nathalie Plotka Bühnenregie Elisabeth Lenoir Repetitor & Pianist Mathieu Pordoy Repetitor Gregory Moulin Regieassistenz Eloise Lally ¶ Primadonna / Ariadne Ann Petersen Der Tenor / Bacchus Roberto Saccà Zerbinetta Olga Pudova -

Oper, Ballett, Staatskapelle, Junge Szene 2011 / 12 Semper! Magazin
Semper! Magazin 2011 / 12 Oper, Ballett, Staatskapelle, Junge Szene 6 Semper! Editorial 3 Dr. Ulrike Hessler, Intendantin Editorial VERFÜHRUNG IN VIELEN VARIATIONEN Eine konzertante Aufführung von Jaromír Weinbergers »Švanda dudák / Schwanda, der Dudelsackpfeifer« unter der Leitung von Wolfgang Sawallisch Anfang der 1990er Jahre im Münchner Herkulessaal hinterließ bei mir einen nachhaltigen Eindruck: eine volkstümliche Oper im besten Sinn, voller Humor, glänzend instrumentiert. Als wir in Dresden über den Spielplan disku- tierten, zeigte sich Operndirektor Eytan Pessen genauso angetan von einer szenischen Aufführung des Werkes in Augsburg. Auch im Dresdner Spielplan hat »Schwanda, der Dudelsackpfeifer« Spuren hinterlassen: Nach ihrer Uraufführung in Prag 1927 ging die Oper förmlich um die Welt, sie wurde in 17 Sprachen übersetzt. 1930 fand die Dresdner Erstaufführung statt, 1931 Wir lassen Kinder erreichte sie die New Yorker Met. Nachdem die Nazis den jüdischen Komponisten ins amerikanische Exil vertrieben hatten, verschwand »Schwanda« allmählich von den internationalen Spielplänen, der Komponist geriet in Vergessenheit, vor allem auch in seiner tschechischen Heimat. In Dresden gab es was erleben! allerdings bereits 1950 eine Produktion mit Karl Paul in der Titel- partie. Schon unsere Ankündigung, das Werk in einer Neu- inszenierung zu präsentieren, stieß auf großes Interesse: Der MDR wird am 7. April einen Livemitschnitt der Premiere senden, Horizonte erweitern, Talente wecken, Kreativität fördern. über die Europäische Rundfunkunion werden -

50 Jahre Richard-Wagner-Verband Saarland 1956-2006 25
Inhalt Dank 2 Grußworte 3 Ehrenmitglieder und Vorstand 2006 10 Festkonzert 30. April 2006 11 Programm 12 Mitwirkende 14 Prof. Dipl.-Ing. Dieter Heinz Hermann Levi – Ein Start in Saarbrücken vom Ludwigsplatz Stengels zum Festspielhaus Wagners in Bayreuth 18 Marcus-Johannes Heinz 50 Jahre Richard-Wagner-Verband Saarland 1956-2006 25 Stipendiaten 91 Wagner-Inszenierungen in Saarbrücken 105 Quellen und Bildnachweise 108 1 Dank … an die Sponsoren, die das Festkonzert erst ermöglicht haben … an unsere Verbandsmitglieder für private Spenden … an die Kooperationspartner des Festkonzerts … an die Unionstiftung für die Unterstützung bei der Publikation dieser Festschrift 2 Grußwort des Leiters der Bayreuther Festspiele Sicherlich wird niemand behaupten, dass Saarbrücken eine ausgesprochene Wagnerstadt ist, aber seit einem Halbjahrhundert nun existiert und wirkt dort ein sympathischer Richard-Wagner-Verband, der sich in der großen, weltumspannenden Vereinigung aller Wagner-Verbände seit langem Achtung und Anerkennung erwerben konnte. Die zahlreichen und bleibenden Verdienste im einzelnen hervorzuheben und zu rühmen, ist hier nicht der Platz, doch ich möchte meine herzlichen Glückwünsche zum Jubiläum verbinden mit der Zuversicht, dass nicht allein Rückschau gehalten wird, sondern die vergangenen 50 Jahre als solides Fundament Anerkennung finden, auf dem die Zukunft mit Begeisterung und Ideenreichtum errichtet wird. Das Engagement innerhalb der Stipendienstiftung ist gewiss die wichtigste und schönste Aufgabe, der sich die Mitglieder des Verbands widmen. Denn gerade mit dem behutsamen Heranführen junger Menschen an Werk und Wirkung Richard Wagners erfüllt ein Verband ganz Wesentliches und leistet bedeutende Arbeit. Und darüber hinaus wäre es ja möglich, dass auf solche Art und Weise sogar Nachwuchs- Mitglieder gewonnen werden. Ein Jubiläum ist stets eine kleine Zäsur, ein kurzes Innehalten, ein Besinnen und Atemholen, natürlich auch ein Bilanzieren des Gewesenen. -

Pressemappe Die Ring-Trilogie
DIE RING-TRILOGIE Pressegespräch 8. November 2017 Ihre GesprächspartnerInnen sind: Intendant Roland Geyer Constantin Trinks Musikalische Leitung Tatjana Gürbaca Inszenierung Bettina Auer Dramaturgie Henrik Ahr Bühne Barbara Drosihn Kostüme Stefan Bolliger Licht DIE RING-TRILOGIE wird unterstützt vom Hauptsponsor Theater an der Wien DIE RING-TRILOGIE Musik und Text von Richard Wagner (1848-74) In einer Fassung von Tatjana Gürbaca, Bettina Auer und Constantin Trinks (2017) Neuproduktion des Theater an der Wien - Uraufführung Premiere HAGEN: 1. Dezember 2017 Premiere SIEGFRIED: 2. Dezember 2017 Premiere BRÜNNHILDE: 3. Dezember 2017 Sein Opus magnum, die Ring-Tetralogie, hat Richard Wagner ganze 26 Jahre seines Lebens beschäftigt, gemartert und enthusiasmiert: Vom ersten Entwurf eines Siegfried-Dramas mit dem Titel Siegfrieds Tod im Revolutionsjahr 1848 bis zur Vollendung der Götterdämmerung-Partitur 1874 verging – wenn auch mit beträchtlichen Unterbrechungen – ein Vierteljahrhundert. Wagner hat seine Nibelungen-Erzählung also kurioserweise vom Ende her begonnen, dem dann immer mehr notwendige Vorgeschichte bis hin zum Rheingold zugewachsen ist. Kein Wunder, dass bei dieser langwierigen, mäandernden Entstehung Sprünge, Brüche und Lücken im komplexen Handlungsgewebe auftauchen, die viel Raum für Interpretation lassen. Der Ring ist Weltendrama, Menschheitsgeschichte und Kapitalismuskritik; er erzählt von Machthunger und Machtmissbrauch, von Geldgier, Zerstörungslust und vom ewigen Kreislauf der Gewalt sowie nicht zuletzt von einer Familientragödie, -

The German Soprano Ricarda Merbeth Is One of the Leading Singers in Her Field and Is in Demand Worldwide As a Wagner and Strauss Interpreter
The German soprano Ricarda Merbeth is one of the leading singers in her field and is in demand worldwide as a Wagner and Strauss interpreter. After her studies at the Hochschule für Musik "Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig she began her career in Magdeburg and Weimar. In 1999 she made her debut as Marzelline in Fidelio at the Vienna State Opera and was a member of the ensemble until 2005. Since then she has sung Contessa, Donna Anna, Pamina, Fiordiligi, Chrysothemis, Elisabeth, Eva, Irene, Elsa, Marschallin and Sieglinde. A special highlight in 2004 was her Daphne in a new production at the Vienna State Opera. With this title role by Richard Strauss, Ricarda Merbeth achieved an international breakthrough. The artist is still associated with the Vienna State Opera today through regular guest engagements. In 2001 she was honoured with the Eberhard Waechter Medal and in 2010 was appointed Austrian Chamber Singer. Further milestones of her career were engagements at the Bayreuth Festival: 2000 at the Jürgen Flimm-Ring as Freia and Gutrune, 2002 to 2005 and 2007 as Elisabeth in TANNHÄUSER and from 2013 to 2018 she sang the role of Senta in the production DER FLIEGENDE HOLLÄNDER. Since 2006 she has appeared as a freelance artist at the world's leading opera houses, including the Bayreuth Festival, Hamburg State Opera, Bavarian State Opera, Vienna State Opera, Milan Scala, Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden Berlin, New National Theatre Tokyo, Opera Nationale de Paris, Teatro Real Madrid, Dutch National Opera, La Monnaie in Brussels, Royal Opera House in London. She sings all important roles in her field: Elektra, Helena, Ariadne, Marietta, Marschallin, Senta, Leonore, Emilia Marty, Elsa, Marie, Isolde, Goneril, Elisabeth and Venus, as well as the Brünnhilden in Wagner's Ring. -

Programme Calendar
PROGRAMME CALENDAR Dear Reader, First and foremost, let me allay any fears that the anniversary of Shakespeare’s dates that should be marked on the calendar in red letters. Our 120 Hungarian artists will also be joined in song by names birth in 2014 passed us by here at the Opera House. It’s just that we had other like Gruberova, D’Arcangelo, Herlitzius, Kampe, Kwangchul, Watson, Tómasson, Konieczny, Neil, Chacón-Cruz, Valenti, things to do: the festival of the Strauss repertoire that was many years in the Maestri, Ataneli and Demuro, while top domestic conductors and their world-renowned peers will be passing the baton making and the exploration of the theme of Faust, for instance. Now that the to star names like Plasson, Pido, Badea and Steinberg, and the 2nd Iván Nagy International Ballet Gala will once again 400th anniversary of the extraordinarily multi-faceted playwright is approaching, welcome the greats of the global ballet scene – this is because, ever since the times of Erkel and Mahler, the Hungarian State the opportunity has arisen for Hungary’s most prestigious cultural institution to Opera has proclaimed the joyful place among equals occupied by Hungarian culture. mobilise its enormous creative powers in service of exploring the remarkably broad literature of the Shakespearean universe. Broken down into figures, the 2015/2016 season of the Hungarian State Opera will see 500 full-scale performances with 33 new productions and 45 from the repertoire, a total of 100 concerts, chamber performances, gala and other events, some 200 This will not be a commemoration of a death; how could it be? We come to pay children’s programmes, 600 tours of the building and more than 1,100 ambassadorial presentations. -

The German Soprano Ricarda Merbeth Is One of the Leading Singers in Her Field and Is in Demand Worldwide As a Wagner and Strauss Interpreter
The German soprano Ricarda Merbeth is one of the leading singers in her field and is in demand worldwide as a Wagner and Strauss interpreter. After her studies at the Hochschule für Musik "Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig she began her career in Magdeburg and Weimar. In 1999 she made her debut as Marzelline in Fidelio at the Vienna State Opera and was a member of the ensemble until 2005. Since then she has sung Contessa, Donna Anna, Pamina, Fiordiligi, Chrysothemis, Elisabeth, Eva, Irene, Elsa, Marschallin and Sieglinde. A special highlight in 2004 was her Daphne in a new production at the Vienna State Opera. With this title role by Richard Strauss, Ricarda Merbeth achieved an international breakthrough. The artist is still associated with the Vienna State Opera today through regular guest engagements. In 2001 she was honoured with the Eberhard Waechter Medal and in 2010 was appointed Austrian Chamber Singer. Further milestones of her career were engagements at the Bayreuth Festival: 2000 at the Jürgen Flimm-Ring as Freia and Gutrune, 2002 to 2005 and 2007 as Elisabeth in TANNHÄUSER and from 2013 to 2018 she sang the role of Senta in the production DER FLIEGENDE HOLLÄNDER. Since 2006 she has appeared as a freelance artist at the world's leading opera houses, including the Bayreuth Festival, Hamburg State Opera, Bavarian State Opera, Vienna State Opera, Milan Scala, Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden Berlin, New National Theatre Tokyo, Opera Nationale de Paris, Teatro Real Madrid, Dutch National Opera, La Monnaie in Brussels, Royal Opera House in London. She sings all important roles in her field: Elektra, Helena, Ariadne, Marietta, Marschallin, Senta, Leonore, Emilia Marty, Elsa, Marie, Isolde, Goneril, Elisabeth and Venus, as well as the Brünnhilden in Wagner's Ring. -

THE MUNICH OPERA FESTIVAL Six Major Performances Tuesday, July 3Rd Through Thursday, July 12Th
THE MUNICH OPERA FESTIVAL Six Major Performances Tuesday, July 3rd through Thursday, July 12th Nationaltheater, home of Bavarian State Opera “Munich’s Opera Festival , a mix of brand-new productions, stag - s in most recent years, Munich’s traditional summer Opera ings from the past season and immaculately cast revivals, has become Festival in 2018 will offer an undeniable richness of six perhaps the most dependably, densely exciting presentation of opera major performances within a compact eight-night pe - in the world… Opera is hardly ever perfect. But in Munich these days riod . Instead of Munich’s new RING, we are excited by the su - it comes closer, consistently, than anywhere else I know. ” NY Times A perlative casts in a varied repertory of other operas, especially the combination of Nina Stemme and Jonas Kaufmann in Jonas Kaufmann: “Almost certainly the greatest tenor in Parsifal , this writer’s favorite soprano Anja Harteros the world right now, a dashingly handsome German with for two evenings, and Angela Gheorghiu as Tosca. an extraordinary voice, whose career is reaching new peaks with each year.” The Telegraph In chronological order, the operas on our program will be Donizetti’s L’Elisir d’Amore , Richard Wagner’s Par - Anja Harteros in Munich’s ‘Arabella’: “A complete em - sifal , Giacomo Puccini’s Tosca , and Richard’ Strauss’s bodiment of the title role… She glows as Arabella, able to Arabella . A fifth vocal performance will be the sold-out float a note as the greatest Strauss sopranos have done” Recital by Munich’s beloved ‘prima donna assoluta’, Anja NY Times Harteros . -

RWVI WAGNER NEWS – Nr
RWVI WAGNER NEWS – Nr. 5 – 06/2017 – deutsch – english – francais Member societies are kindly requested to send us information about news and events using the download forms on our website. · Link to send News: http://www.richard-wagner.org/send-news/ · Link to send Events: http://www.richard-wagner.org/send-event/ Please help us by using these forms. Contents: 1) RWVI-news 2) News from Bayreuth 3) News / events / successes of RWVI member societies 4) New books, CDs, DVDs 5) Perspectives on Wagner productions 6) Travel notes Foreword Dear Wagner community worldwide, A brief glance at the four previously published RWVI newsletters demonstrates that there are an incredible number of new, interesting and high-quality performances of Richard Wagner's masterpieces being performed in almost every part of the world. The Wagner Societies are also active and significant in very diverse ways. Similarly, the local relationships of Societies with both larger and smaller cultural organisations are generally productive and work well for both parties. At some special events in the year, such as the International Richard Wagner Congress, the Bayreuth Festival, or at anniversaries, vocal competitions or symposia held both by member societies and the RWVI, there are also interregional meetings and networking events taking place between local societies and individual members. Often, however, one finds oneself pressed for time at such events, and of course one would understandably not miss the first act of the "Valkyrie" or "Götterdämmerung". You end up saying “Ciao, we'll see each other later," after the obligatory courtesies are exchanged and that tends to happen too often in our opinion.