1.Einführung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sociologie Metalové Hudby: Metalový Posluchač V Kontextu Subkultury a Vkusu Sociology of Metal Music: Metal Fan in the Contex
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA MUZIKOLOGIE Magisterská diplomová práce Sociologie metalové hudby: Metalový posluchač v kontextu subkultury a vkusu Sociology of metal music: Metal fan in the context of subculture and taste Autor: Bc. Gabriela Stašová Vedoucí práce: Mgr. Jan Blüml, Ph.D. Olomouc 2017 Prohlašuji, že jsem magisterskou diplomovou práci Sociologie metalové hudby: Metalový posluchač v kontextu subkultury a vkusu vypracovala zcela samostatně, výhradně s použitím uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne 2. 5. 2017 ...................................... Děkuji vedoucímu práce Mgr. Janu Blümlovi, PhD. za podnětné rady a připomínky, členům Katedry muzikologie a Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie za ochotu mou práci konzultovat a všem respondentům za trpělivé odpovídání na všechny dotazy a náměty. Obsah Úvod .................................................................................................................................. 5 1. Stav bádání čili mezioborové nahlížení na metalovou hudbu ................................... 7 2. Terminologicko-pojmové vymezení ....................................................................... 26 2.1 Vkus jako termín na mezioborové hranici ............................................................ 26 2.2 Metal jako kultura a subkultura ............................................................................. 29 2.2.1 Vývoj tuzemské metalové subkultury ............................................................ 31 2.2.2 Vizuální -

THERION Release Date Pre-Order Start Beloved Antichrist Uu 02/02/2018 Uu 20/12/2017
New Release Information uu February THERION Release Date Pre-Order Start Beloved Antichrist uu 02/02/2018 uu 20/12/2017 uu 3CD-Digi incl. 48 pages booklet uu 6LP Box incl. clear Vinyl, 3 x 2LP in Gatefold uu advertising in many important music magazines DEC/JAN 2018 uu album reviews, interviews in all important Metal magazines in Europe’s DEC/JAN 2018 issues uu song placements in European magazine compilations Price Code: CD12 uu spotify playlists in all European territories NB 3833-0 Digi (incl. 48p booklet) uu retail marketing campaigns uu instore decoration: flyers, poster A1 uu Facebook, YouTube, Twitter, Google+ organic promotion uu Facebook ads and promoted posts + Google ads in both the search and display networks, bing ads and gmail ads (tbc) uu Banner advertising on more than 60 most important Metal & Rock Price Code: CD16 websites all over Europe NB 3833-1 BOX uu additional booked ads on Metal Hammer Germany and UK, and in the (6LP clear vinyl Box, one 2LP Gatefold per act) Fixion network (mainly Blabbermouth) uu video and pre-roll ads on You tube uu ad campaigns on iPhones for iTunes and Google Play for Androids uu banners, featured items at the shop, header images and a background on nuclearblast.de and nuclearblast.com Territory: World uu features and banners in newsletters, as well as special mailings to targeted audiences in support of the release Style: Symphonic uu European Tour 01.02.2018 – 07.04.2018 Metal uu Tracklists: CD3 (Act III) 2LP (Act II) – 33 RPM 01. Shoot Them Down! Side A DIGI: 02. -

Sandspur, Vol 117, No 11, November 12, 2010
University of Central Florida STARS The Rollins Sandspur Newspapers and Weeklies of Central Florida 11-12-2010 Sandspur, Vol 117, No 11, November 12, 2010 Rollins College Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/cfm-sandspur University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Newspaper is brought to you for free and open access by the Newspapers and Weeklies of Central Florida at STARS. It has been accepted for inclusion in The Rollins Sandspur by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Rollins College, "Sandspur, Vol 117, No 11, November 12, 2010" (2010). The Rollins Sandspur. 1922. https://stars.library.ucf.edu/cfm-sandspur/1922 SATURDAY FRIDAY SUNDAY MONDAY H,GH:7* SUNNY HIGH: 79 PARTLY HK3H:77PARTIY HIGH: 82 PARTLY this week's TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY CLOUDY LOW: 54 LOW: 55 CLOUDY LOW: 58 LOW: 59 CLOUDY HIGH: 84 PARTLY HIGH: 82 SCATTERED WEATHER LOW: 63 CLOUDY LOW: 56 T-STORMS NEWS ......page 1-2 : & TIMES page 3-6 ARTS Pa§e7 PORTS Pa8e8 Volume 117 I Issue 11 Friday I November 12, 2010 Florida's Oldest College Newspaper, Est. 1894 predicting polities How will the results of recent elections impact our tomorrow? Annamarie Carlson Forty-eight percent of stu The Sandspur dents at Rollins are from the state of Florida. What does this The Florida midterm elec mean for Florida residents and tions appear to have been a Rollins students? resounding sweep for Republi Governor-elect Rick Scott cans. Not only did Republican campaigned as "tie jobs gov ASSOCIATED PRESS Rick Scott manage to narrowly ernor" on a platform of putting Supreme Court examines win the race for governor, but people back to work and fixing California's attempted Republican candidates now the economy. -

Db:Scanner (Band)"Stephan O'mallie"@En"Maurycy "Mauser" Stefanowicz"@En "Wildeþrýð"@En Db:Nihilist (Band) "Dave Edwards"@En "Ashish Kumar"@Endb:Krieg (Band) "W.D
db:Amalie_Bruun "Dominik Immler"@en "Frater D."@en * Gunnar* Egill Þór* Birkir* Hafþór* Næturfrost "Simon O'Laoghaire"@en db:Kimmo_Heikkinen "Uri Zelcha"@en db:1349_(band) db:Dan-Ola_Persson "Itzik Levy"@en db:The_Kovenant "Zorugelion"@en "Derek MacAmhlaigh"@en db:Lord_Morbivod db:Zonata "Goran Paleka"@en "Johan Elving"@en "Damir Adžić"@en "Ines Tančeva"@en db:Alan_Averill "Elvorn"@en "Enrique Zúñiga Gomez"@en "Nick Oakes"@en db:Marcela_Bovio "Frank Calleja"@en "Miroslav Branković"@en "Maxime Aneca - Guitar"@en "*Lex Icon*Pzy-Clone*Hellhammer*Angel*Sverd"@en db:Alejandro_Mill%C3%A1n Ines Tan?eva "Cremator , Fermentor"@en Alejandro Díaz "MasterMike"@en "Maria "Tristessa" Kolokouri"@en "Martijn Peters"@en "Ivan Vasić"@en "Filip Letinić"@en "Eduardo Falaschi"@en A. db:Viathyn Bart Teetaert - Vocals "Lior Mizrachi"@en "Nikola Mijić"@en "Loke Svarteld"@en "Koen De Croo - Bass"@en "Chris Brincat"@en "Duke"@en db:The_Kovenant "Demian Tiguez"@en "*Tomislav Crnkovic*Dave Crnkovic*Jacob Wright*Alex Kot"@en "Fermentor Cremator , Fermentor"@en db:Lori_Linstruth Ivan Kutija "César Talarico"@en "Eden Rabin"@en db:Alex_Losbäck "Artyom"@en "Sami Bachar"@en "Marchozelos"@en "Morten"@en "* Wagner Lamounier* Roberto Raffan* Jairo Guedz* Max Cavalera* Igor Cavalera* Jean Dolabella"@en Lazar Zec - Guitar "Dave Hampton"@en "Wellu Koskinen"@en "VnoM"@en db:Sabbat_(Japanese_band) "* Christofer Johnsson* Thomas Vikström* Johan Koleberg* Nalle "Grizzly" Påhlsson* Christian Vidal* Lori Lewis"@en db:Arjen_Anthony_Lucassen "Mića Kovačević"@en "Roberto Raffan"@en db:Memnock db:Henrik_Carlsson db:Throllmas "Lazar Zec - Guitar"@en "Chris Calavrias"@enEric Hazebroek "Mathias"* PauloSchlegl"@en Jr.* Andreas Kisser* Derrick Green* Eloy Casagrande"@en"Yatziv Caspi"@en "Erkki Silvennoinen"@en "Gaahnt, Nattulv, Bahznar, Dermorh"@en "Marco Cecconi"@en Antti Kilpi "Gezol"@en Koen De Croo - Bass Elizabeth Toriser "Ze'ev Tananboim"@en db:Jukka_Kolehmainen J. -

SATANISMO E SETTE SATANICHE: Ordo Draconis Et Atri Adamantis – Dragon Rouge
Istituto MEME associato a Université Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L. Bruxelles SATANISMO E SETTE SATANICHE: Ordo Draconis et Atri Adamantis – Dragon Rouge Scuola di Specializzazione: SST in SCIENZE CRIMINOLOGICHE Relatore: Dott. ssa Cristina Caparesi Collaboratori: Dott. ssa Roberta Frison, Dott. ssa Silvana Radoani Contesto di Project Work: Satanismo Tesista Specializzando: Dott. ssa Clio Pizzigati Anno di corso: Primo Modena: 14/06/2009 Anno Accademico: 2008 - 2009 ISTITUTO MEME S.R.L.- MODENA ASSOCIATO UIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES CLIO PIZZIGATI - SST in SCIENZE CRIMINOLOGICHE (Primo anno) A.A. 2008/2009 INDICE 1. Introduzione …………………………………………………………………………. 4 Capitolo I Il Satanismo ………………………………………………………………… 7 1. Definizione di satanismo ………………………………………………...………….. 7 2. Origine del satanismo ……………………………..………………………………….8 3. Classificazioni del satanismo ………………………………………………………. 11 3.1 Classificazione di Aleister Crowley …………………….………………………… 11 3.2 Classificazione di Massimo Introvigne ………………………………………..….12 3.3 Classificazione di Francesco Barresi ……………………………..………………. 13 3.4 Classificazione di Vincenzo Mastronardi …………………….…..………………. 13 4. Struttura del satanismo……………………………………………………...…….... 14 5. Definizione di setta e setta satanica …………………………………………………15 5.1 Formazione della setta satanica …………………………………………………... 16 6. Satanismo e musica …………………………………………………………..……. 18 6.1 I messaggi subliminali (Backward masking)……………………...………………. 19 6.1.1 Esempi di messaggi subliminali ………………………………………….......… 20 7. Il satanismo -

Deutsche Nationalbibliografie 2018 T 07
Deutsche Nationalbibliografie Reihe T Musiktonträgerverzeichnis Monatliches Verzeichnis Jahrgang: 2018 T 07 Stand: 04. Juni 2018 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2018 ISSN 1613-8945 urn:nbn:de:101-201711171876 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Die Titelanzeigen der Musiktonträger in Reihe T sind, wie sche Katalogisierung von Ausgaben musikalischer Wer- auf der Sachgruppenübersicht angegeben, entsprechend ke (RAK-Musik)“ unter Einbeziehung der „International der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gegliedert, wo- Standard Bibliographic Description for Printed Music – bei tiefere Ebenen mit bis zu sechs Stellen berücksichtigt ISBD (PM)“ zugrunde. -
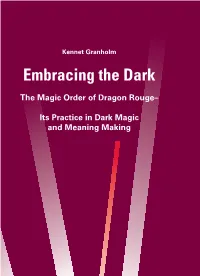
Embracing the Dark ÅA
Embracing The Dark ÅA The study of Western Esotericism is an the Dark Embracing Granholm: Kennet emerging academic fi eld with research mainly Kennet Granholm being carried out on historic currents ranging from the renaissance to early modern Europe, and on ”The New Age Movement”. The mode of spirituality called the Left Hand Path has, Embracing the Dark however, not yet attracted the attention of academia. The present study of the dark The Magic Order of Dragon Rouge– magic order DRAGON ROUGE constitutes an attempt to contribute thoroughly and Its Practice in Dark Magic creatively to this line of research. Objects of study are the organization, philosophy and Meaning Making and practices of the order, as well as the complex discursive conventions involved in the adherents’ construction of coherent world views. In an attempt to shed light on the particularities of this contemporary, late modern esoteric phenomenon, a historical perspective on Western Esotericism has here been combined with a discussion on the impact of recent societal change. Åbo Akademi University Press ISBN 951-765-251-8 2005 Kennet Granholm born 1977 M.A. Åbo Akademi University 2001 Researcher Department of Comparative Religion, Åbo Akademi University Cover: Tove Ahlbäck Åbo Akademi University Press Tavastg. 30 C, FIN-20700 ÅBO, Finland Tel. int. +358-2-215 3292 Fax int. +358-2-215 4490 E-mail: forlaget@abo.fi http://www.abo.fi /stiftelsen/forlag/ Distribution: Oy Tibo-Trading Ab P.O.Box 33, FIN-21601 PARGAS, Finland Tel. int. +358-2-454 9200 Fax int. +358-2-454 9220 E-mail: [email protected] http://www.tibo.net Kennet Granholm born 1977 M.A. -

THERION Sitra Ahra Gerne: Symphonic Metal Digi Pak 27361 2313-0, CD-2, 2LP-1 VÖ: 17.09.2010
THERION Sitra Ahra Gerne: Symphonic Metal Digi Pak 27361 2313-0, CD-2, 2LP-1 VÖ: 17.09.2010 Facts Versprechen andere Künstler im Vorfeld ihres nächsten Releases, dass man Spektakuläres zu erwarten habe, kann der Schuss schnell nach hinten losgehen und sich als gnadenlose Selbstüberschätzung entpuppen. Bei THERION hingegen können solche Ankündigungen bedenkenlos für bare Münze genommen werden, denn im Vergleich zum vor drei Jahren erschienenen »Gothic Kabbalah« ist es dem Ensemble um Wagner-Fan Christofer Johnsson gelungen, nochmals eine ordentliche Schippe drauf zu legen. Vor Ideen scheinbar übersprudelnd, wirkt doch keine der elf Kompositionen überladen, obwohl von metallischer Härte zu operngleicher CD im Digi Pak + Download Card 2313-0 BV Opulenz, von majestätischen Chören zu filigranem Flötenspiel so ziemlich alles aufgeboten wird – Ausflüge in andere ethnische Dimensionen wie gewohnt inbegriffen. 'Land Of Canaan' bedient sich beispielsweise gleich mehrerer Folkloren und ist damit vertonte Multi-Kulti. Klassik meets Metal CD 2313-2 YX 2LP (clear) 2313-1 FZ in Perfektion .“ Daniela Sickinger, BLAST „musikalisch das wohl das bislang breitgefächertste Therion-Album“ 6/7 Punkte, Metal Hammer Label # Therion verkaufen stetig von jedem Album seit Jahren 15.000 Einheiten in D/CH/A Line - Up # Neue Myspace Bandseite im Look des neuen Albums im Juli # Neuer Song ab Ende August auf www.myspace.com/therion zu hören # Online Promo im social network via 70.000 Freunde bei myspace und 90.000 Fans bei facebook # E-mail Versand mit Albumhinweis an -

Therion Aus Schweden Sind Einzigartig Und Gehören Mit Sicherheit Zu Den Einflussreichsten Metal Bands Dieses Planeten
Oeschstrasse 40 D-73072 Donzdorf / Germany 0049 7162 928020 -25 -47 - Celebrator Of Becoming – 4 DVD + 2 CD Package Style: Symphonic Opera Metal NB 1677 Release: 05.05.2006 Several Infos / Need to know : Therion aus Schweden sind Einzigartig und gehören mit Sicherheit zu den einflussreichsten Metal Bands dieses Planeten. Bereits seit Anfang der Neunziger Jahre treiben die „Masters of Symphonic Opera Metal“ ihr Unwesen. Mit “Celebrators Of Becoming” veröffentlichen Therion das wahrscheinlich bisher detailierteste und umfangreichste Boxset in der Geschichte des Heavy Metal! Auf ganzen 4 DVDs und 2 Audio CDs wird die gesamte Band Geschichte anhand von Live Material (u.a. Südamerika, Europa und seltene historische Aufnahmen), Video Clips und vielem mehr nachgezeichnet. Dabei bringen es die DVDs auf eine Laufzeit von insgesamt über 10 Stunden, die Audio CDs auf über 2 Stunden! “Celebrators Of Becoming” definiert den Begriff „Gigantisch“ wahrlich neu! Formats: Picture: 16:9 & 4:3 , FSK 12, Sound: Dolby Digital 2.0, Code: Region Free, 4 DVD + 2 CD Digipak NB 1088-0 EAN: 727361167707 Pricecode: DVD07 (this is a new pricecode) Territory: World Press / Marketing - Die erste DVD der einmaligen symphonic Metal Band aus Schweden! - Das Megapackage auf 4 DVDs und 2 live CDs (live in Mexico)! - Therion haben bis dato insg. 170.000 Alben von ihrem Katalog in Deutschland verkauft! - Anzeigenschaltung, Interviews und Reviews in Rock Hard Metal Hammer Orkus (Geburtstagsausgabe) Heavy Legacy Metal Heart - Titellasche Zillo Sonic Seducer Gothic EMP - Ladendekoationen - Werbung in 250.000 CDs - Rundmail an 30.000 Metalfans - Internetpromo auf der Label- und Bandwebsite -for more information: www.nuclearblast.de/media or www.sonataarctica.info Tracklists: DVD 1 (Live in Mexico) Songs (123min22sec) 1. -

Metal and Magic: the Intricate Relation Between the Metal Band Therion and the Magic Order Dragon Rouge
METAL AND MAGIC: THE INTRICATE RELATION BETWEEN THE METAL BAND THERION AND THE MAGIC ORDER DRAGON ROUGE Kennet Granholm Introduction Since its earliest beginnings, metal music has had a complex relation to religion in general, and to transgressive expressions of the esoteric in par- ticular. In the African-American blues of the early twentieth century, from which metal takes varying degrees of influence, one could fijind narratives of musicians having made deals with the Devil (see Spencer 1993). In con- temporary metal music, esoteric themes are often employed solely for aes- thetic reasons, but a fair number of metal musicians do profess to some esoteric beliefs. A prominent example of the latter is the symphonic metal band Therion, where both the principal composer and main lyricist have close ties to the magic order Dragon Rouge. As the overwhelming majority of Therion lyrics deal with esoteric subject matter it would seem easy to establish a profound and intimate connection between the magic order and the band as a whole, and, furthermore, see the function of Therion as a vehicle to promote Dragon Rouge teachings. However, connections between art (in this case popular music) and religion (in this case the esoteric) are seldom so simple and clear-cut. As I will demonstrate, this applies to Therion and Dragon Rouge as well. In this chapter I will take a closer look at the connections that exist between Therion and Dragon Rouge, and how these connections come into play in the band’s material. I will also discuss problems in researching popular culture and the esoteric, as well as provide a brief overview of the history of the esoteric in metal music. -

THERION Release Date Pre-Order Start Vovin Uu 25/01/2019 Uu 07/12/2018
New Release Information uu January THERION Release Date Pre-Order Start Vovin uu 25/01/2019 uu 07/12/2018 uu advertising in many important music magazines DEC/JAN 2019 uu album reviews, interviews in all important Metal magazines in Europe’s DEC/JAN 2019 issues uu song placements in European magazine compilations uu spotify playlists in all European territories Price Code: LP20 uu instore decoration: flyers NB 4762-1 2LP + CD uu Facebook, YouTube, Twitter, Google+ organic promotion uu Facebook ads and promoted posts + Google ads in both the search and display networks, bing ads and gmail ads (tbc) uu Banner advertising on more than 60 most important Metal & Rock websites all over Europe uu additional booked ads on Metal Hammer Germany and UK, and in Territory: World the Fixion network (mainly Blabbermouth) uu video and pre-roll ads on You tube uu ad campaigns on iPhones for iTunes and Google Play for Androids uu banners, featured items at the shop, header images and a back ground on nuclearblast.de and nuclearblast.com uu features and banners in newsletters, as well as special mailings to targeted audiences in support of the release uu Tracklists: CD: 01. The Rise Of Sodom And Gomorrah 02. Birth Of Venus Illegitima 03. Wine Of Aluqah 04. Clavicula Nox 05. The Wild Hunt 06. Eye Of Shiva 07. Black Sun 08. The Opening 09. Morning Star 10. Black Diamonds 11. Raven Of Dispersion Bonus: 12. The King 13. Crazy Night 14. Mark Of Cain 15. From The Dionysian Days 2LP (33 RPM): Side A 01. -

Underground Power List 2
These will arrive soon: Syrus - Tales of War restock CDs, Solstafir CD + LP, Winterhawk LPs, No Remorse + Eat Metal Records releases, ESP - Vinyl (LIM. 250), Cerebus CD, Overlord CD + LP, Walpyrgus on CD + LP, Khemmis 7", SLAEGT CD + LP, Atlantean Kodex Live CD + DLP, Savior Machine + Solstice LPs (both FLOGA), Cirith Ungol Tape Box in 2 weeks and many more. Unfortunately we are still waiting for the Bad Heaven Vinyls - 90% of the Covers have been damaged on the way from Texas, so they have to be changed. ATTENTION: We are NO Nuclear Blast, EMP or High Roller ! We have a family with 2 Kids + both full time Jobs. We started our Label mainly because of our Love to Metal and do all of this in our free time in the night and on weekend. We can not go every day to the post office - so we need some days to answer + and some time to send your stuff - but we try to handle all fast as a shark ! So thanks for your support over the last 15 years, we need you to continue ! NEW Underground Power Records Releases: ANGEL SWORD - Kallio Rock City 7" (NEW* LIM.95 RED VINYL*HEAVY LOAD) - 10 € Underground Power Records 2017 - Brandnew 7" from ANGEL SWORD - Oldschool 80's Heavy Metal/Hard Rock from Finland ! Limited Edition of 333 copies (95 copies in RED Vinyl, 238 in Black Viny) + Insert with Lyrics ! This is a RED Vinyl copy - lim.95 For Fans of classic NWOBHM meets oldschool Nordic Heavy Metal in the vein of the mighty HEAVY LOAD or oldschool ACCEPT ! Awesome melodies ! Great show at the Metal Assault 2016 ! Awesome melodies, raw, powerful + melodic Vocals