Im Kreis Der Kunst Von Wanda Bibrowicz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Carl Und Gerhart Hauptmann – Jahrbuch
Carl und Gerhart Hauptmann – Jahrbuch Bd. VII 2013 Carl und Gerhart Hauptmann - Jahrbuch Redaktion Prof. Dr. Krzysztof A. Kuczyński Katedra Badań Niemcoznawczych \ Lehrstuhl für Deutschlandstudien Uniwersytet Łódzki \ Universität Lodz ul. Narutowicza 59 a, PL 90- 131 Łódź Tel.\Fax. 0048 -42 – 66 55 401 E-Mail: [email protected] Herausgeber der Reihe „Carl und Gerhart Hauptmann – Jahrbuch“ Prof. Dr. Krzysztof A. Kuczyński Herausgeber des Bandes VII, 2013 Prof. Dr. Grażyna Barbara Szewczyk Gutachter: Prof. Dr. Marek Hałub Uniwersytet Wrocławski \ Universität Wrocław Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Mirosława Czarnecka, Universität Wrocław Prof. Dr. Marek Hałub, Universität Wrocław Prof. Dr. Peter Sprengel, FU Berlin Prof. Dr. Anna Stroka, Universität Wrocław Prof. Dr. Grażyna Szewczyk, Universität Katowice ISSN 2084-2511 Vertrieb des Carl und Gerhart Hauptmann-Jahrbuchs Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku / Staatliche Fachhochschule Włocławek Wydawnictwo Naukowe PWSZ we Włocławku Wissenschaftlicher Verlag der Staatlichen Fachhochschule in Włocławek PL 87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17 Fax: 0048 54 321 43 52 E-Mail: [email protected] * Für unverlangt eingesandte Materialien wird keine Haftung übernommen Skład, druk i oprawa Partner Poligrafia Białystok, ul. Zwycięstwa 10; tel. 85 653-78-04; [email protected] Lehrstuhl für Deutschlandstudien der Universität Łódź Gerhart-Hauptmann-Museum Erkner Carl und Gerhart Hauptmann – Jahrbuch Bd. VII Wissenschaftlicher Verlag der Staatlichen Fachhochschule in Włocławek -

29 0 Ausgewä Auktion Berlin, D 31. Mai Um 18 U Ausgewählte Werke 31. Mai 2018
Antes: 37, 38 Ausgewählte Werke Beckmann: 20 Botero: 39, 40 290 Cézanne: 4 Chagall: 30 Auktion Nr. 290 Corinth: 6 Berlin, Donnerstag, Ernst: 32 31. Mai 2018 Feininger: 11, 12 Heckel: 23 um 18 Uhr Hofer: 25 Jawlensky: 28 Klee: 9, 10 Kollwitz: 13 Kricke: 36 Léger: 31 Leistikow: 1 2018 Frühjahr Liebermann: 2, 5 Macke: 17 Mataré: 24 Modersohn-Becker: 7, 8 Muche: 26 Munch: 14, 15 Münter: 16 Ausgewählte Werke Nay: 33, 34 Nolde: 18, 19, 21, 22 Schlemmer: 27 Schumacher: 35 Vuillard: 3 Wollheim: 29 Selected Works, Auction No. 290 grisebach.com Ausgewählte Werke 31. Mai 2018 Berlin, Thursday, 31 May 2018 at 6 p.m. Gabriele Münter. Detail. Los 17 Edvard Munch. Detail. Los 14 Karl Hofer. Detail. Los 25 Norbert Kricke. Los 36 Ernst Wilhelm Nay. Detail. Los 34 Ausgewählte Werke 31. Mai 2018, 18 Uhr Selected Works 31 May 2018, 6 p.m. 8 Experten Specialists Vorbesichtigung der Werke Sale Preview Ausgewählte Werke München Kunst des 19. Jahrhunderts: 3. und 4. Mai 2018 Ausgewählte Werke: 17. und 18. Mai 2018 Grisebach Jesco von Puttkamer Türkenstraße 104 80799 München Hamburg Dr. Markus Krause Micaela Kapitzky 3. Mai 2018 +49 30 885 915 29 +49 30 885 915 32 Galerie Commeter [email protected] [email protected] Stefanie Busold Bergstraße 11 20095 Hamburg Dortmund Ausgewählte Werke: 4. und 5. Mai 2018 Zeitgenössische Kunst: 19. Mai 2018 Galerie Utermann Wilfried Utermann Silberstraße 22 44137 Dortmund Zürich 8. bis 10. Mai 2018 Traute Meins Nina Barge Grisebach +49 30 885 915 21 +49 30 885 915 37 Verena Hartmann [email protected] [email protected] Bahnhofstrasse 14 8001 Zürich Düsseldorf 15. -

Max Liebermann - Sein Briefwechsel Mit Alfred Lichtwark
Max Liebermann - sein Briefwechsel mit Alfred Lichtwark - DISSERTATION zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie der Universität Hamburg Birgit Pflugmacher aus Berlin Hamburg 2001 1. Gutachter: Prof. Dr. Hermann Hipp 2. Gutachter: Dr. Fritz Jacobs Tag des Vollzugs der Promotion: 7. Februar 2000 3 Inhaltsverzeichnis 3 Abkürzungsverzeichnis 4 - 5 Teil I Einleitung 7 - 8 Biographisches über Max Liebermann 9 - 11 Biographisches über Alfred Lichtwark 12 - 14 Max Liebermanns schriftliches Erbe 15 - 20 Erläuterungen zur Transkription des Briefwechsels 21 - 32 Das Verhältnis Max Liebermann zu Alfred Lichtwark 33 - 37 Liebermann - Ein ‘Meisterwerk’ Lichtwarks? 38 - 43 Teil II Der Briefwechsel 1 - 424 Teil III Quellen- und Literaturverzeichnis 1 - 12 Personenverzeichnis 13 - 27 Bildnisverzeichnis 28 - 38 Abbildungsnachweis 39 4 Abkürzungsverzeichnis Abb. Abbildung AKL Allgemeines Künstler Lexikon a. M. am Main Anm. Anmerkung/en BAT British American Tobacco bez. bezeichnet BSM Bayrische Staatsbibliothek München bzw. beziehungsweise cm Zentimeter Conn. Connecticut, USA DDR Deutsche Demokratische Republik ders. derselbe d.h. das heißt dies. dieselbe Diss. Dissertation Dr. Doktor dtv Deutscher Taschenbuchverlag E Eberle f. folgende FCP Foundation Custodia Paris ff. fortfolgende FN Fußnote geb. geborene Hrsg. Herausgeber Inv. Inventar Jg. Jahrgang KB Kunsthalle Bremen KH Kunsthalle Hamburg KK Kupferstichkabinet LAB Landesarchiv Berlin LB Lichwark-Briefe LBI Leo Baeck Institute LM Lichtwark-Mappe LO Lichtwark-Ordner M Mark n nach NF Neue Folge Nr. Nummer o. J. ohne Jahr o. O. ohne Ort o. S. ohne Seite o. V. ohne Verfasser PAK Preußische Akademie der Künste Berlin PK Preußischer Kulturbesitz 5 Penns. Pennsylvania, USA Prof. Professor RA Rijkmuseum Amsterdam S. Seite Sch Schellenberg SLD Stadt- und Landesbibiothek Dortmund S. -

Nr. 170 Oldenburgische 0Ldenburg Landschaft
Zeitschrift der Oldenburgischen Landschaft kulturland Ausgabe 4.2016 | Nr. 170 oldenburgische 0ldenburg landschaft Frischer Wind aus Nordwesten – Neuer Blick – Plattdüütsche Beats – Denkfabrik BOREAS verknüpft Dialog über ungewöhnlichen Oldenburger bei „Plattsounds“ Deutsche und Niederländer Landschaftsgarten erfolgreich kulturland 4|16 Inhalt 2 Die Welt in diesen rauschenden 28 Architektonische Vielfalt ganz nah Farben Das Buch „Baudenkmäler im Oldenbur- Die Brücke in Oldenburg ger Land“ erscheint in Kürze 5 Ursprung Wasser 3 0 Miteinander die Stadtmuseen gestalten Sonderausstellung im Museum für Neue Amtsleiterin setzt auf Dialog Indus trieKultur Delmenhorst mit den Bürgern 6 Lüpertz sieht Münstermann 32 Wie ein Erbe erfolgreich der Ausstellung im Rahmen des Allgemeinheit dient 10 Reformationsgedenkens 2017 Die „Jaspers-Hochkamp-Stiftung“ 7 „Wi kriegt dat hen“ in Westerstede 7 „Wie kommt Sprache an?“ 34 Warum Märchen wirklich wahr sind … 8 Jakobsweg vor der Haustür Gespräch mit Sabine Lutkat, Präsiden- 10 Plattdüütsche Beats in de Grafschaft tin der Europäischen Märchengesell- B e n t h e i m schaft e. V. Oldenburger Bands erfolgreich beim 36 Oldenburg und die „Operation Finale von „Plattsounds“ in Schüttorf Schwalbe“ 26 12 Die Jade verbindet! 37 KOSTBAR 2017 – Ein Geschenk für die Gewässerwoche Jaderegion Umwelt 13 Bei Gott ist kein Ding unmöglich 38 Neuer Blick auf eine vertraute 14 100 Jahre Landtagsgebäude in Umgebung Oldenburg Dialog über einen ungewöhnlichen 15 Frischer Wind aus Nordwesten Landschaftsgarten Denkfabrik BOREAS verknüpft -
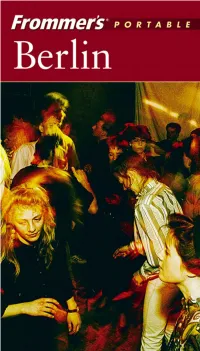
Frommer's Portable Berlin, 3Rd Edition
00 542664 FM.qxd 11/14/03 8:54 AM Page i PORTABLE Berlin 3rd Edition by Darwin Porter & Danforth Prince Here’s what critics say about Frommer’s: “Amazingly easy to use. Very portable, very complete.” —Booklist “Detailed, accurate, and easy-to-read information for all price ranges.” —Glamour Magazine 00 542664 FM.qxd 11/14/03 8:54 AM Page i PORTABLE Berlin 3rd Edition by Darwin Porter & Danforth Prince Here’s what critics say about Frommer’s: “Amazingly easy to use. Very portable, very complete.” —Booklist “Detailed, accurate, and easy-to-read information for all price ranges.” —Glamour Magazine 00 542664 FM.qxd 11/14/03 8:54 AM Page ii Published by: WILEY PUBLISHING,INC. 111 River St. Hoboken, NJ 07030-5744 Copyright © 2004 Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New Jersey. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, except as per- mitted under Sections 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without either the prior written permission of the Publisher, or authorization through payment of the appropriate per-copy fee to the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978/750-8400, fax 978/646-8600. Requests to the Publisher for permis- sion should be addressed to the Legal Department, Wiley Publishing, Inc., 10475 Crosspoint Blvd., Indianapolis, IN 46256, 317/572-3447, fax 317/572-4447, E-Mail: [email protected]. Wiley and the Wiley Publishing logo are trademarks or registered trade- marks of John Wiley & Sons, Inc. -

Diplomarbeit
Die approbierte Originalversion dieser Diplom-/Masterarbeit ist an der Hauptbibliothek der Technischen Universität Wien aufgestellt (http://www.ub.tuwien.ac.at). The approved original version of this diploma or master thesis is available at the main library of the Vienna University of Technology Univ.-Doz. Dr. Rudolf Soukup (http://www.ub.tuwien.ac.at/englweb/). D I P L O M A R B E I T László Zechmeister – From Pioneering Work in Chromatography to the Foundation of the Series „Progress in the Chemistry of Organic Natural Products“ Ausgeführt am Institut für Chemische Technologien und Analytik der Technischen Universität Wien unter der Anleitung von Univ.-Doz. Mag.rer.nat. Dr.techn. Rudolf Werner Soukup durch Michaela Wirth Keplerstraße 7 4061 Pasching Wien, am 23. Mai 2012 Michaela Wirth Table of Content 1. Acknowledgements 4 2. Introduction 5 3. The Life of László Zechmeister 6 3.1. Biographical dates and events 6 3.2. László Zechmeister’s personality 12 3.3. Awards and Honors 14 4. Zechmeister’s Influence on the Development of Chromatography 15 4.1. Literary Contributions to the History of Chromatography 17 4.2. National Award in Chromatography of the American Chemical Society 20 4.3. Working with Chromatography 20 5. Hitherto Mostly Disregarded Contributions to the Development of the Chromatographic Method made by Austrian Chemists 23 5.1. Zdenko Hans Skraup 23 5.2. Fritz Prior 24 6. The Series “Progress in the Chemistry of Organic Natural Products” 26 7. Progress in the Chemistry of Organic Natural Products – A closer look 34 7.1. Volume 1 (1938) 34 7.2. -

The Collection of Kurt Rohde and Frieda Hinze
THE COLLECTION OF KURT ROHDE AND FRIEDA HINZE Stefan Körner As the last wisps of vapor from the flash powder slowly dis- appeared, the exciting, eventful story of an art dealer began to unfold. With turtle soup in tureens of Meissen porcelain, chester cake for dessert and military marches by the wedding band, the best of Dresden society turned out to greet the young bridal couple in the late summer of 1912: Charlotte Berbig, the daughter of wealthy textile industrialists from Dresden and Kurt Rohde, a dashing officer in the Prussian army, had summoned their guests together for a wedding photo on Brühl’s Terrace at the Belvedere. However, it was more the building’s magnificent features and less the military marches which captivated the groom. Kurt Rohde was much more fascinated by art and collecting than by the ability of his troops to march in step, and even the guests, with all their titles of court and commerce, of privy councilor and war councilor, much preferred to revel in the style of the upper class associated with the late empire than to busy themselves with the social upheaval and escalating political tension rampant in Europe. In 1912 the Berbig clan celebrated the young couple with an opulence reminiscent of this “bygone era”, oblivious to the world around them. For the ambitious Kurt Rohde, however, the marriage would provide him with the financial possibilities to make his dreams reality. Kurt Rohde and Charlotte Berbig’s wedding photo taken ADVANCEMENT WITHIN THE EMPIRE on Brühl’s Terrace at the Royal Belvedere in Dresden, photo 28 September 1912 Kurt (Paul Friedrich Franz) Rohde was born in 1882 – quite randomly, as it were, in Erfurt – considering that the family constantly moved due to the father’s job as customs inspector during the prosperous era of Germany’s Gründerjahre. -
Hikes Through the Jelenia Góra City Centre Route
Hikes through the Jelenia Góra City Centre Route Download map: www.jeleniagora.pl facebook.com/MiastoJeleniaGora S E W N E O N O S Z M O U N A R K T A I K N S SO BI ES Z Wrzosówka Ó River W JA GN IĄ C T S IE K u P Ó d L e W I W c C k o E a l n t S e o t e ś r r t c e S i e i S c t ś t o r n a Polski e k e e r Wojs go Av a enu t s id e l en o iego Av ue n S lsk Po ka i ojs W a B E an t 1 Ma ko ja S w I tre a n et S tr K e u e t o C I M Town Hall (Ratuszowy) Square W e l O o N k o A t e e Estate Robotnicze J S r t S a E l t o Z Bóbr River e P R e . t B Y S W O B o A g Z e W i k s ń t A i e g e r O t S D a j a M U 3 i j c u t R y t s n o K I Z E R S K I E U N T A I N S A N D M O H I L L S ÓW TK IĄ N G A J ÓW SZ IE B O S Zgorzelecka Street ICE PL IE C Wo t ln ee o Kamienna River tr śc S i S o tr g J e e a e i n t k s a e i P b a M o w S ł a e u t I O e I n e e tr A v S a v A w e U o ko n g n u e a i e k B N s l o P K T a k s j A A o W I Z C A N Z B O S A B R Town Hall (Ratuszowy) Square Z W A E N S K D I Z Bóbr RiverA E H B O B R I Z E L L S K o n s t y t u c j i 3 M a j a S t r e e t THE MINOR JELENIA GÓRA CITY CENTRE ROUTE There can be nothing more beautiful, than how Jelenia Góra is situated: an attractive town with many impressive buildings, in the valley surrounded from each side by hills, with a magnificent view of Karkonosze Mountains – wrote in one of his letters the future, sixth President of the United States, John Quincy Adams. -

Beyond the Bauhaus Book Subtitle: Cultural Modernity in Breslau, 1918-33 Book Author(S): Deborah Ascher Barnstone Published By: University of Michigan Press
University of Michigan Press Chapter Title: Front Matter Book Title: Beyond the Bauhaus Book Subtitle: Cultural Modernity in Breslau, 1918-33 Book Author(s): Deborah Ascher Barnstone Published by: University of Michigan Press. (2016) Stable URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctt1gk088m.1 JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://about.jstor.org/terms This book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Funding is provided by Knowledge Unlatched. University of Michigan Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Beyond the Bauhaus This content downloaded from 138.25.78.25 on Tue, 20 Mar 2018 04:56:31 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms This content downloaded from 138.25.78.25 on Tue, 20 Mar 2018 04:56:31 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms 2RPP Beyond the Bauhaus This content downloaded from 138.25.78.25 on Tue, 20 Mar 2018 04:56:31 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms 2RPP Social History, Popular Culture, and Politics in Germany Kathleen Canning, Series Editor Recent Titles Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational Jay H. -

Designing Modern Germany Jeremy Aynsley
DESIGNING MODERN GERMANY JEREMY AYNSLEY Designing Modern Germany Designing Modern Germany Jeremy Aynsley reaktion books For Sarah Published by Reaktion Books Ltd 33 Great Sutton Street London ec1v 0dx, uk www.reaktionbooks.co.uk First published 2009 Copyright © Jeremy Aynsley 2009 All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers. Printed and bound in China by C&C Offset Printing Co., Ltd British Library Cataloguing in Publication Data Aynsley, Jeremy Designing modern Germany 1. Design – Germany – History – 20th century I. Title 745.4’0943’0904 isbn: 978 1 86189 401 4 Contents Introduction: The Culture of Design in Germany 7 1 Design Ideals, Design Reform, Design Professions, 1870–1914 25 2 Experiment and Tradition in Design, 1917–33 69 3 Politics and Design: Reaction and Consolidation, 1933–45 113 4 Reconstruction and the Tale of Two Germanys, 1945–75 145 5 Reunification: Design in a Global Context, 1975–2005 187 Conclusion 222 References 225 Select Bibliography 238 Acknowledgements 245 Photo Acknowledgements 246 Index 247 Introduction: The Culture of Design in Germany Reference to design in Germany can evoke strong, contrasting and even contradictory images. Design is understandably one of the leading cultural contributions for which the country has a deserved reputation. When we use the term ‘German design’, however, we must do so with caution. Immediately we need to qualify what we mean: when, where, who or what? To construct a history of the culture of design by nation is a naturally com- plex and to some extent artificial process for any country and all the more so for one with so many conflicting ideas of national identity. -

Cultural Modernity in Breslau, 1918
2RPP Beyond the Bauhaus 2RPP Social History, Popular Culture, and Politics in Germany Kathleen Canning, Series Editor Recent Titles Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational Jay H. Gellar and Leslie Morris, Editors Beyond the Bauhaus: Cultural Modernity in Breslau, 1918–33 Deborah Ascher Barnstone Stop Reading! Look! Modern Vision and the Weimar Photographic Book Pepper Stetler The Corrigible and the Incorrigible: Science, Medicine, and the Convict in Twentieth- Century Germany Greg Eghigian An Emotional State: The Politics of Emotion in Postwar West German Culture Anna M. Parkinson Beyond Berlin: Twelve German Cities Confront the Nazi Past Gavriel D. Rosenfeld and Paul B. Jaskot, Editors Consumption and Violence: Radical Protest in Cold-War West Germany Alexander Sedlmaier Communism Day-to-Day: State Enterprises in East German Society Sandrine Kott Envisioning Socialism: Television and the Cold War in the German Democratic Republic Heather L. Gumbert The People’s Own Landscape: Nature, Tourism, and Dictatorship in East Germany Scott Moranda German Colonialism Revisited: African, Asian, and Oceanic Experiences Nina Berman, Klaus Mühlhahn, and Patrice Nganang, Editors Becoming a Nazi Town: Culture and Politics in Göttingen between the World Wars David Imhoof Germany’s Wild East: Constructing Poland as Colonial Space Kristin Kopp Colonialism, Antisemitism, and Germans of Jewish Descent in Imperial Germany Christian S. Davis Africa in Translation: A History of Colonial Linguistics in Germany and Beyond, 1814–1945, Sara Pugach Between National Socialism and Soviet Communism: Displaced Persons in Postwar Germany, Anna Holian Dueling Students: Conflict, Masculinity, and Politics in German Universities, 1890–1914 Lisa Fetheringill Zwicker The Golem Returns: From German Romantic Literature to Global Jewish Culture, 1808–2008, Cathy S. -
Thursday, September 19 > Augsburg: Universitätsbibliothek
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BibLIOPHILES ASSOCIATION INTERNATIONALE DE bibLIOPHILIE XXVIIIth Congress Munich 2013 THURSDAY, SEPTEMBER 19 > AUGSBURG: UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK PROGRAMME COORDINATION AND EDITORIAL SUPERVISION Dr. Bettina Wagner AIB|13 MUNICH 3 AUGSBURG UNIVERSITY LIBRARY Soon after Augsburg University had been founded in 1970, its library could take over a small stock of old books from an Upper Bavarian theological college which had been closed some years previously. This collection did contain some noteworthy items from the early modern period; still, Augsburg University Library’s reputation as a repository of rare books rests on a number of collections which were acquired at a later time. By far the most important of these is the Oettingen-Wallerstein Library, printed books and manuscripts collected by the mem- bers of a North Swabian noble family over the course of some 500 years. Significant contributions to its holdings were made by Count Ernst II von Oettingen-Wallerstein, who in the 1650s bought the library of his brother-in-law Marquart Fugger, mem- ber of one of Augsburg’s most renowned Patrician families; by Prince Kraft Ernst (1748-1802), an avid collector of books with catholic tastes and a marked interest in French literature, who also maintained a first-rate court orchestra and thus added much handwritten and printed sheet music to his collections; and by Prince Ludwig (1791-1870), whose collector’s mania extended to spectacular illuminated manuscripts and led straight to financial ruin. When in 1802/03 the Oettingen-Wallerstein family came into the possession of the estates of five Swabian monasteries which had fallen victim to the secularization, this meant another major increase of their library’s holdings, in particular an influx of books on theology and ecclesiastical history.