Seht, Unser Gott Lädt Alle Ein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
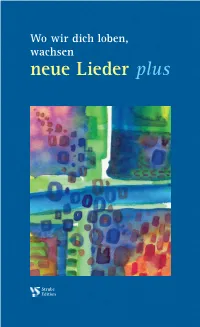
Neue Lieder Plus
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus Strube Edition ALPHABETISCHES VERZEICHNIS Accorde-nous la paix .............. 202 Christe, der du trägst Adieu larmes, peines .............. 207 die Sünd der Welt .................. 110 Aimer, c’est vivre .................... 176 Christ, ô toi qui portes Allein aus Glauben ................. 101 nos faiblesses ........................ 110 Allein deine Gnade genügt ....102 Christ, ô toi visage de Dieu .... 111 Alléluia, Venez chantons ........ 174 Christus, Antlitz Gottes ........... 111 Alles, was atmet .................... 197 Christus, dein Licht .................. 11 Amazing love ......................... 103 Christus, Gottes Lamm ............ 12 Amen (K) ............................... 104 Christus, höre uns .................... 13 An den Strömen von Babylon (K) ... 1 Christ, whose bruises An dunklen, kalten Tagen ....... 107 heal our wounds ................... 111 Anker in der Zeit ...................... 36 Con alegria, Atme in uns, Heiliger Geist ..... 105 chantons sans barrières ......... 112 Aube nouvelle dans notre nuit .. 82 Con alegria lasst uns singen ... 112 Auf, Seele, Gott zu loben ........ 106 Courir contre le vent ................. 40 Aus den Dörfern und aus Städten .. 2 Croix que je regarde ............... 170 Aus der Armut eines Stalles ........ 3 Danke für die Sonne .............. 113 Aus der Tiefe rufe ich zu dir ........ 4 Danke, Vater, für das Leben .... 114 Avec le Christ ........................... 70 Dans la nuit Bashana haba’a ..................... 183 la parole de Dieu (C) .............. 147 Behüte, Herr, Dans nos obscurités ................. 59 die ich dir anbefehle .............. 109 Das Leben braucht Erkenntnis .. 14 Bei Gott bin ich geborgen .......... 5 Dass die Sonne jeden Tag ......... 15 Beten .................................... 60 Das Wasser der Erde .............. 115 Bis ans Ende der Welt ................ 6 Da wohnt ein Sehnen Bist du mein Gott ....................... 7 tief in uns .............................. 116 Bist zu uns wie ein Vater ........... -

Und Bettag – 18
GOTTESDIENST ZEITGLEICH Buß- und Bettag – 18. November 2020 Auf die Glocken vor Ort hören oder auf die Glocken hier: Glockengeläut aus St. Andreas Hildesheim Eine Kerze entzünden Einstimmung Heute ist Buß- und Bet-Tag. Ein Tag zum Sortieren. Ehrlich anschauen, was in diesem Jahr war. Was in uns ist. Was wir getan und gelassen haben. Es anschauen und es Gott hinhalten: Das Gelungene. Und heute auch besonders das Gescheiterte. Was soll bleiben? Was kann weg? Und wohin damit? Wir sind zusammen. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Miteinander verbunden - in Gedanken und im Beten. Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sein Friede sei mit uns allen. Amen Bibeltext des Tages: Lukas 13, 6-9 (Übersetzung: Neue Genfer Übersetzung) (lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) Das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis: »Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen; doch wenn er kam und sehen wollte, ob der Baum Früchte trug, fand er keine. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte: »Schon drei Jahre komme ich jetzt, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde keine. Hau ihn um! Warum soll er den Boden noch länger aussaugen?‹ – ›Herr‹, erwiderte der Gärtner, ›lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Früchte – wenn nicht, kannst du ihn umhauen.‹« Lied (gesungen oder angehört oder vorgelesen): Ich möchte Glauben haben (anhören durch Klick in der Zeile) (Evangelisches Gesangbuch 596, 1-4) Ich möchte Glauben haben, der über Zweifel siegt, der Antwort weiß auf Fragen und Halt im Leben gibt. -

Lieder Und Gesänge Aus Dem Neuen Gotteslob+Hallelujalesejahrb
Lieder und Gesänge aus Gotteslob+Halleluja Lesejahr B Dezernat Pastoral, Abt. Liturgie und Verkündigung : Michael Dörnemann, Stefan Glaser, Jörg Stephan Vogel 1. Adventssonntag (LB) Eröffnungsgesang GL 231, 1+4+5+6 „O Heiland reiß die Himmel auf“ (→1. Lesung) (aGL 105) GL 554, 1+2 „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (→ Evangelium) (aGL 110) GL 218, 1+2 „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ (aGL 107) Kyrie GL 163, 2 „Herr Jesus, du König aller Menschen“ (→Evangelium) (aGL 495,2) GL 158 „Tau aus Himmelshöhn“ (a GL 103) HAL 10 „Kyrie, Kyrie eleison“ Antwortpsalm GL 634, 3 „Richtet euch auf“ mit Ps 80 (FrKantorale S.4f.) (aGL 126) GL 48, 1 „Biete deine Macht auf, Herr, unser Gott“ mit Ps 80 (neu!) GL 231, 1+4+6 „O Heiland reiß die Himmel auf“ (→1. Lesung) (aGL 105) GL 721/722/723, 1+3+4 „O komm, o komm, Emmanuel“ (→ 1. Lesung) (aGL 817) Halleluja GL 174, 5 „Halleluja“ + Vers (aGL 530,6) Credo GL 3,4 sprechen (aGL 2,5) GL 355 „Wir glauben Gott im höchsten Thron“ (neu!; auch singbar auf « O Heiland reiß » 231) Fürbittruf: GL 232 „Dein Reich komme, Maranatha“ (neu!) GL 634, 6 „Komm, Herr Jesus, Maranatha“ (neu!) Gabenbereitung GL 233, 1-4 „O Herr, wenn du kommst“ (→Evangelium) (neu!) HAL 70, 1-5 „Durch das Dunkel hindurch“ GL 221, 1+2+5 „Kündet allen in der Not“ (aGL 106) GL 218, 1+4+5 „Macht hoch die Tür“ (aGL 107) Sanctus GL 193 „Heilig, heilig, heilig, ist Gott, der Herr der Mächte“ (aGL 481) GL 191 „Heilig, heilig, heilig Gott“ (blaues Halleluja 37) Agnus Dei GL 715 „Gottes Lamm, Herr Jesu Christ“ (aGL 161) HAL 59 „Gottes Lamm“ Dankhymnus GL 230, 1+3+5+6 „Gott, heil´ger Schöpfer aller Stern“ (→Evangelium) (aGL 116) GL 552, 1-5 „Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt“ (→Evangelium) (neu!) GL 549, 1-3 „Es wird sein in den letzten Tagen“ (neu!) 1 2. -

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis (M) = Mehrstimmig • = Erweiterte Ausgabe 2020
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis (m) = mehrstimmig • = Erweiterte Ausgabe 2020 # Bleib mit Deiner Gnade bei uns (m).......278 10.000 Reasons • ................... 309 Bleibe, Herr, jetzt bei uns ..............265 Bleibet hier und wachet mit mir (m) ..... 431 A Bless the Lord, my soul (m) .............673 Aber Du weißt den Weg für mich (m) • ....574 Bless the Lord, o my soul • ............ 309 Adoramus te Christe (m) •..............705 Blessed be your name •................260 Adoramus te, Domine (m) ............. 685 Bóg jest miłością (m) ..................541 Agnus Dei (Osanger) • ................ 222 Bonifatiuslied • ..................... 504 Agnus Dei, Gottes Lamm • .............224 Bonum est confidere in Domino (m) ......109 All das wünsch ich dir (m) ..............715 Brandstifter .........................549 All die Fülle ist in Dir, o Herr ........... 664 Brot und Wein der Welt ............... 120 All hail to you, Don Bosco ..............512 Brot, das die Hoffnung nährt .......... 228 Alle guten Gaben (1) ..................320 Alle guten Gaben (2) ................. 321 C Alle Knospen springen auf ............. 421 Caminando va (m) . 566 Alle meine Quellen entspringen .........661 Carpe Diem......................... 540 Alle Menschen höret ................. 122 Christe, Du Lamm Gottes (Kanon)....... 211 Alleluja, Du bist der Weg •...............92 Christe, Du Lamm Gottes (Schmitz) ..... 221 Alles ist möglich • ................... 730 Christus, Dein Licht (m) ................576 Alles, was atmet......................619 Christus, -

Gottes- Dienst War Ein Zentrales Anliegen Des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65)
Hintergründe ∙ Geschichten ∙ Erklärungen zu einigen Kirchenliedern zusammengestellt von Beat Grögli und illustriert von Sophia Bihler 1 Weisst du auch, was du singst? Kirchenlieder erzählen Geschichten. Sie sind in einem bestimmten Kontext entstanden, sind verbunden mit den kulturellen und gesell- schaftlichen Strömungen ihrer Zeit, haben sich entwickelt und wurden neuen Begebenheiten angepasst. Wer etwas davon weiss, wird sie mit mehr Gewinn singen. In der Apostelgeschichte (8,30) fragt der Apostel Philippus einen Jerusa- lem-Wallfahrer, neben dessen Wagen er hergeht und der im Buch des Propheten Jesaja liest: Weisst du auch, was du liest? Die Erklärungen des Apostels erschliessen dem anderen den Sinn der Heiligen Schrift. Diese kleine Broschüre möchte eine Hilfe sein bei der Frage: Weisst du auch, was du singst? Kirchenlieder sind nicht verstaubt und langweilig, sondern spannend und schön! Die Erklärungen in dieser Broschüre sind kurz. Das hängt damit zusam- men, dass ich sie zuerst für den Anschlagkasten in der Wallfahrtskirche Heiligkreuz verfasste. Mehr als zwei Seiten Text hatten dort nicht Platz! Ich musste mich auf einige wesentliche Punkte konzentrieren. Eine weitere Einschränkung ist die Auswahl der Lieder, die ausschliesslich aus dem Katholischen Gesangbuch (KG) stammen. Die Darstellung folgt der dortigen Nummerierung. Eine grosse Hilfe bei der Zusammenstellung dieser Erläuterungen war mir das Buch Geistliches Wunderhorn. Grosse deutsche Kirchenlieder (im Folgenden abgekürzt mit GW), das 2001 im C.H. Beck-Verlag erschienen ist. Wer sich weiter vertiefen will, ist dort gut bedient. Herzlich danke ich Sophia Bihler aus dem Heiligkreuz für die Illustra- tionen, die sie mit jugendlichem Elan ins Werk gesetzt hat. St. Gallen, am Gedenktag der heiligen Cäcilia, 22. -

Das Fußballstadion Als Stätte Inklusiver Kultur –
Titel „Das Fußballstadion als Stätte inklusiver Kultur – Eine Untersuchung der Interaktionen von Fans des 1. FSV Mainz 05 zur Teilhabe der Fans mit Behinderungen“ Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) eingereicht am gemeinsamen Promotionszentrum Soziale Arbeit der Hochschule RheinMain, der Hochschule Fulda, der Frankfurt University of Applied Sciences und der Hochschule Darmstadt Kerstin Steinfurth Dienheim Geb. 28.06.1963 in Nierstein Erstbetreuer: Prof. Dr. Petra Gromann Hochschule Fulda Zweitbetreuerin: Prof. Dr. Henning Daßler Hochschule Fulda Eingereicht im Juli 2020 Prüfungstermin 28. Oktober 2020 Erscheinungsort: Fulda im November 2020 Zusammenfassung ‚Inklusiv leben‘ heißt, selbstverständlich Teil einer Gesellschaft sein und bedeutet, sich einbringen und gut aufgehoben fühlen in einem Netzwerk von gewünschten Beziehungen. Danach strebt der Mensch, das ist Teil seines persönlichen Glücks. Menschen mit Behinderungen erfahren auch heute noch trotz grundsätzlicher rechtlicher Gleichstellung Stigmatisierungen und strukturelle Diskriminierung. Ziel der Studie ist es Gelin- gensbedingungen von inklusiven Lebensräumen zu untersuchen. Es wird davon ausgegangen, dass sich Men- schen durch die direkte Begegnung mit anderen als Teil der Gemeinschaft fühlen. Das Stadion des Fußballver- eins 1. FSV Mainz 05 erfüllt die strukturellen Voraussetzungen der barrierefreien Zugänglichkeit und bietet damit Fans mit und ohne Behinderungen die Möglichkeit zur Begegnung. Ob diese Begegnungen auch den qualitativen Anforderungen des persönlichen Wohlbefindens gerecht werden, wurde mittels der Grounded Theory Methode überprüft. Im Ergebnis bestätigen sich im Stadion des 1. FSV Mainz 05 die barrierefreie und sozialräumliche Ausgestaltung des Umfelds sowie der wertegetragene Umgang in den Begegnungen der Fans untereinander und des Vereins. Die Studie zeigt auf, dass Menschen mit und ohne Behinderungen die gleichen Interessen hinsichtlich des eigenen guten Lebens verfolgen. -

German Documentaries 2007” Is Information for the Respective Production Companies Or Designed As a Tool and Guide for Everyone Professionally Sales Agents
PRINT_GD07#.qxd 26.01.2007 11:14 Uhr Seite 1 Dearest readers and users of this catalogue, if we address you today not only as "readers,” but as you with the wide range of our country’s production land- "users,” this is quite intentional. As over the past ten years, scape. For this reason, each title also includes the contact the annual catalogue "german documentaries 2007” is information for the respective production companies or designed as a tool and guide for everyone professionally sales agents. In this way, we would like to not only assist involved with German documentary films. There’s plenty to you in obtaining viewing copies, but also recommend part- offer to television commissioning editors, film buyers, ners for future international co-productions. festival organizers, cultural managers, and journalists who Nearly all of the companies listed are members of the are interested in the thematic and formal variety of German "German Documentary Association” / AG DOK – the largest documentary filmmaking. professional association of independent film and television Of course, such a tool needs to be functional and easy to producers in Germany. With its initiative "german films,” use. That’s why we have tried to simplify your search for the AG DOK launched the independently produced docu- the films best suited to your needs. Our list of topics is divi- mentary in the international marketplace ten years ago. ded into fourteen catagories from "A” for "Arts” to "Y” for Today, the label is an integral part of the "german films” "Youth,” offering a wealth of topics extending far beyond sales platform, which is present not only at trade shows what is typically found at most international film markets. -

Lieder-Liste 140130 Für Geplante Cusic-Mappe Mit Quellen
Inhaltsverzeichnis der geplanten Cusic-Mappe 1-220 (01/2014) Quelle der Vorlage [mit Lied-Nr.] : Kzg. : Kreuzungen [von Martin Müller, Sasbach] E&H : Erdentöne-Himmelsklang [Schwabenv.] SmH : Singt mit Herz [Druck Hartmann, Han.] € pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro …) …) …) …) …) …) …) k+s : kommt und singt [Erzbistum Köln] GL : Neues Gotteslob [Bistümer Deutschlands] LZ : Liederzettel sehr unterschiedlicher Herkunft AnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlder Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen TonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonart : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle KostenKostenKostenKostenKostenKostenKostenKosten(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.- Nr. Liedtitel Quelle Autoren : Text / Musik Copyright ( ggf. Text / Musik ) s = € Bem. Hanna Lam / Wim ter Burg | Verlag G. F. Callenbach, Nijkerk NL | 113 Abraham, Abraham, verlass dein Land k+s 351 1 = dt. Übertr. Diethard Zils Gustav Bosse Verlag, Regensburg 032 Alle Knospen springen auf Kzg 11 Wilhelm Willms / Ludger Edelkötter KIMU Kindermusikverlag GmbH, Pullheim 1 = 143 Amen ! Amen ! Kzg 14 Spiritual 1 4+ 174 Ameni, Amen - All ihr Werke lobt -

Gesamtverzeichnis Nach Liedanfängen Lieder 1 Bis 1387 – Stand: Nov
Gesamtverzeichnis nach Liedanfängen Lieder 1 bis 1387 – Stand: Nov. 2020 Nummer Abendstern, der Tag verblaßt – Rudolf Alexander Schörder (1878-1962) 1319 Ma17 Aber ich will micht freuen – Habakuk 3,18 1254 Ma15 Ab heute seid ihr fest vereint - Lied zur Trauung 655 Hö16 Ach Herr, wie sind der Feinde viel 015 Un01 Achte auf deine Gedanken - Beate Heinen 714 Hö18 Ach nein, das ist kein Sterben – Durch Leid zur Herrlichkeit 943 Ma05 Ach, wie hab’ ich mich erschreckt 334 Hö06 Alle eure Sorge (Kanon) 148 Wo03 Allein aus Glauben, allein aus Gnade 800 Hö20 Alle Mütter waren einmal klein – Mascha Kaléko 993 Ma07 Alles, alles magst du nehmen 019 Un01 Alles Leben ströhmt aus dir – Rudolphi / Tobler 1318 Ma17 Alles, was uns hier begegnet - Margret Birkenfeld 650 Hö16 All Morgen ist ganz frisch und neu - EG 440 804 Hö20 All was unser Tun und Anfang ist – Kanon zu 4 Stimmen 1158 Ma11 Als ein behutsam Lciht – Anbetung des Kindes 961 Ma05 Als furchterfüllt die andern Jünger flohn – Julius Sturm 1138 Ma11 Als Jesus auf die Erde kam – M.G. Schneider 1971 1354 Ma18 Als sich der Mensch versündigte im Garten 109 Wo01 Als unser Herr am Kreuzesstamm – Rudolf Alexander Schröder 1139 Ma11 Als uns Gott die Welt erbaute – Erwin Sohnius 1172 Ma11 Amazing Grace – Erstaunlich Gnade 950 Ma05 Am Brunnen vor dem Tore – Der Lindenbaum – MGV von Franz Schubert 1180 Ma12 Amen, Amen, - aus China 898 Ma04 Am Himmel stand ein heller Stern 487 Hö11 Amsel, Drossel, Star und Fink – Humanistisches Frühlingslied – Heinz Erhardt 1093 Ma10 Am Wirtshaus an der Straße - Hermann Löns -

Katalog 2019 2 >
Katalog 2019 2 > Wer nicht neugierig ist, singt nichts Neues. Das sind wir > Neue Noten! Digitale Noten! Neugierig? > www.dehm-verlag.de Katalog 2019 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm 3 Das sind wir ... < > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust, und mehr… Der Dehm Verlag ist ein Partner für kreative Köpfe, die ihr musikalisches Schaffen und ihre Ideen in die Öffentlichkeit bringen möchten. Weil uns die Musik am Herzen liegt, weil Musik belebt, verbindet und bewegt, arbeiten wir mit Musiker/innen und Texter/innen stets an neuen Liedern und Chorwerken. Das sind wir > Patrick Dehm Cornelius Dehm Jürgen Kandziora 2019 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm Verleger: Patrick Dehm Dehm Verlag e.K. Rechte & Lizenzen: Cornelius Dehm Auf der Unterheide 40 Notensatz: Jürgen Kandziora 65549 Limburg/Lahn Gestaltung: Ulrike Mahr, Tel. +49 (0) 6431-71905 Mahr Graphic & Performing Arts, Kronach Fax +49 (0) 6431-976016 Preisänderungen, Lieferbarkeit und Irrtümer [email protected] vorbehalten. (Stand: Februar 2019) www.dehm-verlag.de 4 > Das sind wir ... > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust, und mehr… > Notenmaterial und Fortbildung Das ist unser Beitrag, damit sich neue Chöre gründen und bestehende Chöre neue Nahrung finden. Chöre und Kirchengemeinden suchen nach zeitgenössischen Texten und Musik. Das nehmen wir ernst und bieten modernes Notenmaterial an. Das sind wir Um unser Ziel zu erreichen, Chören zu lebendiger Musik und zeitgemäßer Sprache zu > verhelfen, haben wir Seminare mit Tagesworkshops, halbtägigem und ganztägigem offenen Singen und einer einwöchigen Fortbildung entwickelt. Infos zu den Fortbildungen finden sich auf unserer Website www.neuesgeistlicheslied.de. -

Neues Gotteslob, Liedregister Stammteil + LM
Alphabetisches Verzeichnis der Gesänge nur LM GL GL Ps JUG 2013 1974 Titel Form1 Nr. Hinweis OLO 827 657 Ach wie flüchtig, ach wie nichtig Lied 816 Adoramus te, Domine Kehrvers 838 All meine Quellen entspringen in dir (Schw. L. Heinzl) Lied 2 730 928 Alle Menschen höret auf dies neue Lied Lied 803 552 Alles Leben ist dunkel Lied 737 Amen (Ruf, Abschluß des Hochgebets) Ruf 869 934 Andere Lieder wollen wir singen (Janssens) Janssens 5 751 811 Auf Christen, singt festliche Lieder Lied Strophen neu geordnet 874 Aus deiner Hand kommt alles Leben (Eckert/Raabe) Lied 601 714 Aus den Dörfern und Städten / Eingeladen zum Fest des Glaubens Lied 4 884 581 Ave Maria klare Lied 882 941 Ave, Stern der Meere Lied 865 927 Bei des Abendmahles Schlusse Lied 853 618 Brich dem Hungrigen dein Brot Lied 873 925 Christen lasst uns niederbeugen Lied 778 830 Christus ist erstanden! O tönt, ihr Jubellieder tönt (L) Lied 719 890 Christus, unser Licht, Kraft und Zuversicht (KL) Kyrielitanei 834 Da wohnt ein Sehnen tief in uns (Eckert / Quigley) Lied 759 812 Das alte Jahr vergangen ist Lied 728 931 Das eine Brot wächst auf vielen Halmen (Zenetti) Lied 233 779 831 Das Grab ist leer, der Held erwacht Lied 790 845 Dein Gnad, dein Macht und Herrlichkeit Lied 866 921 Deinem Heiland, deinem Lehrer Lied 735 Deinen Tod, o Herrn verkünden wir Ruf 887 948 Dem großen Martyrer sei Ehre Lied 750 Dem Herrn in der Höhe Gloria soll klingen Lied 799 967 Dem Herzen Jesu singe Lied 774 820 Der am Kreuz ist meine Liebe Lied 883 Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft (ges. -

NGL) Im Neuen Gotteslob (2013
Verzeichnis der Neuen Geistlichen Lieder (NGL) im neuen Gotteslob (2013) Nr. im GL Stammteil 1. 397 Alle meine Quellen (Kanon) 2. 87 Aller Augen warten auf dich 3. 346 Atme in uns, Heiliger Geist 4. 283 Aus der Tiefe rufe ich zu dir 5. 85 Ausgang und Eingang (Kanon) 6. 82 Behutsam leise nimmst du fort 7. 453 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott 8. (325) Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit 9. (94) Bleib bei uns, Herr 10. 378 Brot, das die Hoffnung nährt 11. (370) Christus, du Herrscher Himmels und der Erde 12. 287 Christus war für uns gehorsam bis zum Tod 13. (210) Das Weizenkorn muss sterben 14. 389 Dass du mich einstimmen lässt 15. 201,1 Deinen Tod, o Herr 16. 452 Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen 17. 100 Der Lärm verebbt 18. 412 Die Herrlichkeit des Herrn (Kanon) 19. 323 Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt 20. 182 Du sei bei uns 21. 146 Du rufst uns, Herr 22. 161 Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld 23. 166 Ehre sei Gott in der Höhe 24. 102 Eine ruhige Nacht (Kanon) 25. (439) Erhör, o Gott, mein Flehen 26. (549) Es wird sein in den letzten Tagen 27. 292 Fürwahr, er trug unsre Krankheit 28. 173/1 Gloria, gloria, in excelsis Deo 29. 169 Gloria, Ehre sei Gott 30. 259 Gottes Stern, leuchte uns 31. 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Kanon) 32. 468 Gott gab uns Atem 33. (464) Gott liebt diese Welt 34. 399 Gott loben in der Stille 35.