Kleine Bestimmungshilfen, Teil 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
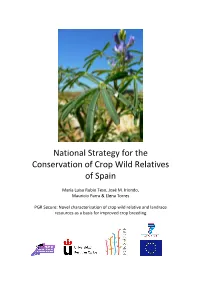
1 Introduction
National Strategy for the Conservation of Crop Wild Relatives of Spain María Luisa Rubio Teso, José M. Iriondo, Mauricio Parra & Elena Torres PGR Secure: Novel characterization of crop wild relative and landrace resources as a basis for improved crop breeding The research reported here was made possible with funding from the EU Seventh Framework Programme. PGR Secure is a collaborative project funded under the EU Seventh Framework Programme, THEME KBBE.2010.1.1-03, ‘Characterization of biodiversity resources for wild crop relatives to improve crops by breeding’, Grant Agreement no. 266394. The information published in this report reflects the views of PGR Secure partner, URJC. The European Union is not liable for any use that may be made of the information contained herein. Acknowledgements: We are grateful to Cristina Ronquillo Ferrero and Aarón Nebreda Trejo who collaborated in the process of data gathering and data analysis for the generation of this strategy. We are also grateful to Lori De Hond for her help with proof reading and linguistic assistance. Front Cover Picture: Lupinus angustifolius L., by Rubén Milla 2 Contents 1 Introduction ................................................................................................................... 5 2 Prioritization of Crop Wild Relatives in Spain ................................................................ 6 2.1 Introduction ............................................................................................................ 6 2.2 Methods ................................................................................................................. -

Investigação De Isoflavonas Em Espécies De Leguminosas Nativas Do Sul Do Brasil, Com Ênfase Em Trifolium Riograndense Burkart
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE FARMÁCIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS Investigação de Isoflavonas em Espécies de Leguminosas Nativas do Sul do Brasil, com Ênfase em Trifolium riograndense Burkart GREICE RAQUEL DETTENBORN PORTO ALEGRE, 2009. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE FARMÁCIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS Investigação de Isoflavonas em Espécies de Leguminosas Nativas do Sul do Brasil, com Ênfase em Trifolium riograndense Burkart Dissertação apresentada por Greice Raquel Dettenborn para obtenção do título de Mestre em Ciências Farmacêuticas Orientador: Prof. Dr. José Ângelo Silveira Zuanazzi Porto Alegre, 2009. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, em nível de Mestrado da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aprovada em 18.06.2009, pela Banca Examinadora constituída por: Profa. Dr. Edna Sayuri Suyenaga Centro Universitário Feevale Profa. Dr. Silvia Teresinha Sfoggia Miotto Universidade Federal do Rio Grande do Sul Profa. Dr. Amélia Teresinha Henriques Universidade Federal do Rio Grande do Sul D479i Dettenborn, Greice Raquel Investigação de isoflavonas em espécies de leguminosas nativas do sul do Brasil, com ênfase em Trifolium riograndense Burkart / Greice Raquel Dettenborn – Porto Alegre: UFRGS, 2009. – xiv, 123p.: il ., gráf., tab. Dissertação (mestrado). UFRGS. Faculdade de Farmácia. Programa de Pós- graduação em Ciências Farmacêuticas. 1. Farmacologia. 2. Leguminosae. 3. Trifolium riograndense. 4. Trevo. 5. Isoflavonas. I. Zuanazzi, José Angelo Silveira. II. Título. CDU: 615.322:582.736 Bibliotecária responsável: Claudia da Silva Gonçalves de Leon, CRB10/1012 II AGRADECIMENTOS Ao querido Prof. Dr. José Angelo Silveira Zuanazzi, pela orientação, estímulo, amizade e ensinamentos inestimáveis. -

Ecology of the Naturalisation and Geographic Distribution of the Non-Indigenous Seed Plant Species Of
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Lincoln University Research Archive Ecology of the naturalisation and geographic distribution of the non-indigenous seed plant species of New Zealand. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at Lincoln University by Hazel A. W. Gatehouse Lincoln University 2008 ii iv Abstract of a thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Ph.D. Ecology of the naturalisation and geographic distribution of the non- indigenous seed plant species of New Zealand. by Hazel A. W. Gatehouse The naturalisation and subsequent spread of non-indigenous plant species (NIPS) is a major problem for most regions of the world. Managing plant invasions requires greater understanding of factors that determine initial naturalisation and distribution of wild NIPS. By the year 2000, 2252 NIPS were recorded as wild (1773 fully naturalised and 479 casual) in New Zealand. From published literature and electronic herbaria records, I recorded year of discovery of wild populations, and regional distribution of these wild NIPS. I also recorded species related attributes hypothesised to affect naturalisation and/or distribution, including global trade, human activities, native range and biological data; and regional attributes hypothesised to affect distribution, including human population densities, land use/cover, and environmental data. I used interval-censored time-to-event analyses to estimate year of naturalisation from discovery records, then analysed the importance of historical, human activity, biogeographical and biological attributes in determining patterns of naturalisation. Typically, NIPS that naturalised earlier were herbaceous, utilitarian species that were also accidentally introduced and/or distributed, with a wide native range that included Eurasia, naturalised elsewhere, with a native congener in New Zealand. -

The Naturalized Vascular Plants of Western Australia 1
12 Plant Protection Quarterly Vol.19(1) 2004 Distribution in IBRA Regions Western Australia is divided into 26 The naturalized vascular plants of Western Australia natural regions (Figure 1) that are used for 1: Checklist, environmental weeds and distribution in bioregional planning. Weeds are unevenly distributed in these regions, generally IBRA regions those with the greatest amount of land disturbance and population have the high- Greg Keighery and Vanda Longman, Department of Conservation and Land est number of weeds (Table 4). For exam- Management, WA Wildlife Research Centre, PO Box 51, Wanneroo, Western ple in the tropical Kimberley, VB, which Australia 6946, Australia. contains the Ord irrigation area, the major cropping area, has the greatest number of weeds. However, the ‘weediest regions’ are the Swan Coastal Plain (801) and the Abstract naturalized, but are no longer considered adjacent Jarrah Forest (705) which contain There are 1233 naturalized vascular plant naturalized and those taxa recorded as the capital Perth, several other large towns taxa recorded for Western Australia, com- garden escapes. and most of the intensive horticulture of posed of 12 Ferns, 15 Gymnosperms, 345 A second paper will rank the impor- the State. Monocotyledons and 861 Dicotyledons. tance of environmental weeds in each Most of the desert has low numbers of Of these, 677 taxa (55%) are environmen- IBRA region. weeds, ranging from five recorded for the tal weeds, recorded from natural bush- Gibson Desert to 135 for the Carnarvon land areas. Another 94 taxa are listed as Results (containing the horticultural centre of semi-naturalized garden escapes. Most Total naturalized flora Carnarvon). -

Flowering Plants and Ferns of Keele University David W
Flowering Plants and Ferns of Keele University David W. Emley Updated June 2019 Keele is perhaps more interesting for its trees than for its flowering plants, however there are a few unusual species amongst them. The deciduous woodland, consisting mainly of Oak and Sycamore, has a poor ground flora which makes for a fine display of Bluebells in the spring. It also has Yellow Archangel, a plant associated with ancient woodland as well as the lovely Wood Sorrel. The former sewage-works site, just south of Lake 5, was once home to a small colony of Harebell and Betony. The area between that site and the entrance to Lymes Road used to be very good for plants. Indeed, there was a colony of Common Spotted Orchids and a few Northern Marsh Orchids. These appear to have gone - it is too overgrown now. The small gully that leads into Lake 7 is lined with Bluebells but also Ramsons or Wild Garlic; its main site at Keele. Keele has a good bramble flora and is the type locality for Rubus sneydii, named by Eric Edees; a national expert on brambles who lived nearby. One plant, Rhododendron ponticum, is causing problems in the deciduous woodland where it is very invasive and is unfortunately the host of Phytophthora ramorum. This virus can seriously affect oaks, larches and many other trees. Because of this Keele has to remove all its Larch and most of its Rhododendron. This will, of course, open up the woodland to let the native ground flora grow up and extensive replanting with native trees is scheduled to start in autumn 2015. -

Bioblitz Vascular Plant List 2013 Compiled by Jonathan Mitchley and Fay Newbery
University of Reading BioBlitz Vascular Plant List 2013 Compiled by Jonathan Mitchley and Fay Newbery 1. Acer campestre (Field Maple) 2. Acer pseudoplatanus (Sycamore) 3. Achillea millefolium (Yarrow) 4. Achillea ptarmica (Sneezewort) 5. Acorus calamus (Sweet-flag) 6. Aegopodium podagraria (Ground-elder) 7. Aesculus hippocastanum (Horse-chestnut) 8. Agrostis capillaris (Common Bent) 9. Agrostis stolonifera (Creeping Bent) 10. Ajuga reptans (Bugle) 11. Alliaria petiolata (Garlic Mustard) 12. Allium triquetrum (Three-cornered Garlic) 13. Allium ursinum (Ramsons) 14. Alnus glutinosa (Alder) 15. Alopecurus myosuroides (Black-grass) 16. Alopecurus pratensis (Meadow Foxtail) 17. Anagallis arvensis (Scarlet Pimpernel) 18. Anemone nemorosa (Wood Anemone) 19. Anisantha sterilis (Barren Brome) 20. Anisantha tectorum (Drooping Brome) 21. Anthoxanthum odoratum (Sweet Vernal-grass) 22. Anthriscus sylvestris (Cow Parsley) 23. Aphanes arvensis (Parsley-piert) 24. Aquilegia vulgaris (Columbine) 25. Arctium minus (Lesser Burdock) 26. Arrhenatherum elatius (False Oat-grass) 27. Artemisia vulgaris (Mugwort) 28. Arum maculatum (Lords-and-Ladies) 29. Helictotrichon pubescens (Downy Oat-grass) 30. Ballota nigra (Black Horehound) 31. Bellis perennis (Daisy) 32. Betula pendula (Silver Birch) 33. Brachypodium sylvaticum (False Brome) 34. Brassica napus (Rape) 35. Bromus hordeaceus (Soft-brome) 36. Buddleia davidii (Butterfly Bush) 37. Buxus sempervirens (Box) 38. Caltha palustris (Marsh-marigold) 39. Calystegia sepium (Hedge Bindweed) 40. Capsella bursa-pastoris (Shepherd’s-purse) 41. Cardamine hirsuta (Hairy Bitter-cress) 42. Cardamine pratensis (Cuckooflower) 43. Carduus nutans (Musk Thistle) 44. Carex divulsa (Grey Sedge) 45. Carex flacca (Glaucous Sedge) 46. Carex hirta (Hairy Sedge) 47. Carex otrubae (False Fox-sedge) 48. Carex pendula (Pendulous Sedge) 49. Carex remota (Remote Sedge) 50. Carex riparia (Greater Pond-sedge) 51. -

Table of Contents
Table of Contents Abstract....................................................................................................................................................... 1 I. Introduction ............................................................................................................................................. 3 II. Present Germplasm Activities ................................................................................................................ 4 A. Germplasm Collections..................................................................................................... 4 B. Primary Research Locations ............................................................................................. 4 III. Status of Crop Vulnerability ................................................................................................................ 6 A. Trifolium species............................................................................................................... 6 B. Other CSPL genera ........................................................................................................... 7 IV. Germplasm Needs.......................................................................................................................... 9 A. Collection.......................................................................................................................... 9 B. Preservation .................................................................................................................... -

The Vascular Plant Red Data List for Great Britain
Species Status No. 7 The Vascular Plant Red Data List for Great Britain Christine M. Cheffings and Lynne Farrell (Eds) T.D. Dines, R.A. Jones, S.J. Leach, D.R. McKean, D.A. Pearman, C.D. Preston, F.J. Rumsey, I.Taylor Further information on the JNCC Species Status project can be obtained from the Joint Nature Conservation Committee website at http://www.jncc.gov.uk/ Copyright JNCC 2005 ISSN 1473-0154 (Online) Membership of the Working Group Botanists from different organisations throughout Britain and N. Ireland were contacted in January 2003 and asked whether they would like to participate in the Working Group to produce a new Red List. The core Working Group, from the first meeting held in February 2003, consisted of botanists in Britain who had a good working knowledge of the British and Irish flora and could commit their time and effort towards the two-year project. Other botanists who had expressed an interest but who had limited time available were consulted on an appropriate basis. Chris Cheffings (Secretariat to group, Joint Nature Conservation Committee) Trevor Dines (Plantlife International) Lynne Farrell (Chair of group, Scottish Natural Heritage) Andy Jones (Countryside Council for Wales) Simon Leach (English Nature) Douglas McKean (Royal Botanic Garden Edinburgh) David Pearman (Botanical Society of the British Isles) Chris Preston (Biological Records Centre within the Centre for Ecology and Hydrology) Fred Rumsey (Natural History Museum) Ian Taylor (English Nature) This publication should be cited as: Cheffings, C.M. & Farrell, L. (Eds), Dines, T.D., Jones, R.A., Leach, S.J., McKean, D.R., Pearman, D.A., Preston, C.D., Rumsey, F.J., Taylor, I. -
THE Alderney PLA NT LIST
The Alderney Plant List This list last updated 10.01.2008 39 THE PLANT LIST No. Scientific name English name Finder/date Note; Individual squares are not generally shown for abundant, common, or frequent plants * = 1999 list of Endangered or Scarce species # = rare species in Alderney(not usually endangered) Often freque PTERIDOPHYTA Lycopodiopsida Selaginellaceae 1 Selaginella kraussiana # Kraus's clubmoss JP 1993 Isoetaceæ 2 Isoetes histrix # * Land Quillwort (RDBk) EDM 1902 Equisetopsida Equisetaceæ 3 Equisetum arvense Field Horsetail EDM 1901 4 Equisetum palustre Marsh Horsetail CCB 1838 5 Equisetum telmateia # Great Horsetail CRPA 1900 Ophioglossaceæ 6 Ophioglossum vulgatum # Adder's-tongue JES 1969 7 Ophioglossum lusitanicum # * Least Adder's-tongue (RDBk EDM 1906 Pteropsida Osmundaceæ 8 Osmunda regalis # Royal Fern WMT 1967 Adiantaceæ 9 Adiantum capillus-veneris # * Maidenhair Fern (Scarce) WTA 1865 Polypodiaceæ 10 Polypodium vulgare # Polypody CCB 1838 11 Polypodium interjectum Intermediate Polypody RMW 1962 Dennstædtiaceæ (Formerly hyppolepidaceæ) 12 Pteridium aquilinum Bracken CCB 1838 Aspleniaceæ 13 Phyllitis scolopendrium Hart's-tongue Fern CCB 1838 14 Asplenium adiantum-nigrum Black Spleenwort CCB 1838 40 THE PLANT LIST Frequency Fertile Squares where found and notes period nt or com mon in Britain 1 site 8, Large patch 10 x 1.5m along base of church wall NW (NW corner) vr 1 to 6 5,10, 14 2 new sites on E coast found 6/1995, JB, MK lc 3 to 7 Generally distributed in damp places. Separate lf 4 to 8 4,7,8,9,10,13. Cones on vegetative shoots. 2 sites 3 to 5 12, Veg stem to 1.5m. -
BSBINEWS April 2002 Edited by Gwynn Ellis, FLS No
BSBINEWS April 2002 Edited by Gwynn Ellis, FLS No. 90 41 Marlborough Road, Roath Cardiff CF23 5B U Hypericum olympicum del. GM.S. Easy © 2001 (see p. 47) 2 Administration and Important Addresses 11 ADMINISTRATION AND IMPORTANT ADDRESSE~I PRESIDENT Dr Geoffrey Halliday 26 Mowbray Drive, Burton-in-Kendal, Carnforth, Lancashire, LA6 lNF Tel.: 01524781550 PRESIDENT-ELECT Mr Richard Pryce Trevethin, School Road, Pwll, L1anelli, Carmarthenshire, SA15 4AL Tel. & Fax: 01554 775847; e-mail: [email protected] HON. GENERAL SECRETARY (General Enquiries) Miss Ailsa Burns 3 Rosliston Road, Stapenhill, Burton-upon-Trent, Staffordshire DEI5 9RJ Tel.: 01283-568136; e-mail: [email protected] HON. TREASURER (All financial matters except Subscriptions) Mr Michael Braithwaite 19 Bucc1euch Street, Hawick, Roxburghshire, TD9 OHL Tel.: 01450-372267; Fax: 01450-373591 HON. EDITOR (BSBI NEWS) MrGwynn Ellis 41 Marlborough Road, Roath, CardiffCF23 5BU Tel. & Fax: 029-2049-6042; e-mail: [email protected] or [email protected] MEMBERSHIP SECRETARY (Payment of Subs and changes of address) Mr Michael Walpole 68 Outwoods Road, Loughborough, Leics. LEll 3LY (Please quote membership number on all correspondence; it is on the address label on your mailings, and in the List of Members in Year Book 2001 and 2002). Tel.: 01509-215598; e-mail: [email protected] HON. FIELD SECRETARY (Enquiries on Field Meetings) Mrs Jane Croft 12 Spaldwick Road, Stow Longa, Huntingdon, Cambs. PE28 OTL E-mail: [email protected] BSBI PROJECT MANAGER (Atlas 2000, Co-ordinators and Threatened Plants Database) Mr David Pearman The Old Rectory, Frame St Quintin, Dorchester, Dorset DT2 OHF Tel.: 01935-83702; e-mail: [email protected] WATSONIA RECEIVING EDITOR Mr M.N. -
BSBI News No. 91
2 Administration and Important Addresses 11 ADMINISTRATION AND IMPORTANT ADDRESSES 11 PRESIDENT Mr Richard Pryce Trevethin, School Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4AL Tel. & Fax: 01554775847; e-mail: PryceEco@ao!.com HON. GENERAL SECRETARY (General Enquiries) Miss Ailsa Burns 3 Rosliston Road, Stapenhill, Burton-upon-Trent, Staffordshire DE15 9RJ Te!.: 01283-568136; e-mail: BSBIHonGenSec@ao!.com HON. TREASURER (All financial matters except SUbscriptions) Mr Michael Braithwaite 19 Buccleuch Street, Hawick, Roxburghshire, TD9 OHL Te!.: 01450-372267; Fax: 01450-373591 HON. EDITOR (BSBI NEWS) Mr Gwynn Ellis 41 Marlborough Road, Roath, Cardiff CF23 5BU Te!. & Fax: 029-2049-6042; e-mail: BSBINewsEditor@ao!.com or [email protected] MEMBERSHIP SECRETARY (payment of Subs and changes of address) Mr Michael Walpole 68 Outwoods Road, Loughborough, Leics. LEll 3LY (Please quote membership number ou all correspondence; it is on the address label on your mailings, and in the List of Members in YearBook 2001 and 2002) Te!': 01509-215598; e-mail: mike.walpole@dia!.pipex.com HON. FIELD SECRETARY (Enquiries on Field Meetings) Mrs Jane Croft 12 Spaldwick Road, Stow Longa, Huntingdon, Cambs. PE28 OTL E-mail: [email protected] BSBI PROJECT MANAGER Mr David Pearman The Old Rectory, Frome St Quintin, Dorchester, Dorset DT2 OHF Te!.: 01935-83702; e-mail: DPearman4@ao!.com BSBI CO-ORDINATOR Mr Alex Lockton 66 North Street, Shrewsbury, Shropshire, SYl 2JL Te!. & Fax: 01743 343789; Mobile: 0585 700368; e-mail: [email protected] BSBI VOLUNTEER OFFICER Mr Pete Selby 12 Sedgwick Road, Bishopstoke, Eastleigh, Hampshire S050 6FH . Te!. 02380 644368; e-mail: [email protected] WATSONIA RECEIVING EDITOR Mr Martin N. -

Ecuador & Galapagos
Isles of Scilly trip report, 8th to 15th May 2017 WILDLIFE TRAVEL Scilly 2017 Isles of Scilly trip report, 8th to 15th May 2017 onday 8 May 2017: St Mary’s On a glorious, sunny day the group all arrived on St Mary’s, except for Ken who had arrived on Scilly several days earlier and Rosemary who was waiting on the quay. RMS Scillonian got in early and it was not long before everyone was making their way through Hugh Town to Mincarlo guesthouse. On the way, Rosemary pointed out places of interest; the bank ATM, sandwich shops, Co-op, deli and where she was staying in a self-catering cottage. The latter would be a useful place to keep the library of identification books and a handy meeting place. After leaving our bags at Mincarlo everyone settled for a picnic lunch on Porthcressa beach looking due south over an idyllic view. After lunch, the group returned to Mincarlo to unpack before reassembling for a short walk up onto Peninnis Head. Our route took us up the steep path beside Buzza quarry and first encounters with some typical Scilly plants; Hottentot-fig Carpobrotus edulis, Rock Sea-spurrey Spergularia rupicola, Small-flowered Tree- mallow Malva pseudolavatera, Lesser Sea-fig Erepsia heteropetala (high on the quarry walls), Greater Quaking-grass Briza maxima and at the top of the hill a beautiful patch of the grass Rough Dog’s-tail Cynosurus echinatus. The first of the clover species were noted: Slender Trefoil Trifolium micranthum and Bird’s-foot Clover T. ornithopoidiodes as well as Sea Spleenwort Asplenium marinum which is frequent on walls as well as coastal rocks.