Anton Erhard Martinelli (1684‐1747)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
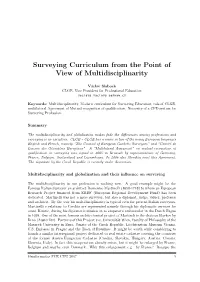
Surveying Curriculum from the Point of View of Multidisciplinarity
Surveying Curriculum from the Point of View of Multidisciplinarity V´aclav Slaboch CLGE, Vice President for Professional Education vaclavs.vaclavs seznam.cz Keywords: Multidisciplinarity, Modern curriculum for Surveying Education, role of CLGE, multilateral Agreement of Mutual recognition of qualification. Necessity of a CPD system for Surveying Profession. Summary The multidisciplinarity and globalization makes fade the differences among professions and surveying is no exception. CLGE – CLGE has a name in two of the many European languages English and French, namely “The Council of European Geodetic Surveyors” and “Comit´ede Liaison des G´eom`etres Europ´eens”. A “Multilateral Agreement” on mutual recognition of qualification in surveying was signed in 2005 in Brussels by representatives of Germany, France, Belgium, Switzerland and Luxembourg. In 2006 also Slovakia joint this Agreement. The signature by the Czech Republic is recently under discussion. Multidisciplinarity and globalization and their influence on surveying The multidisciplinarity in our profession is nothing new. A good example might be the Famous Italian Surveyor an architect Domenico Martinelli (1650-1718) to whom an European Research Project financed from ERDF (European Regional Development Fund) has been dedicated. Martinelli was not a mere surveyor, but also a diplomat, judge, valuer, professor and architect. By the way his multidisciplinarity is typical even for present Italian surveyors. Martinelli´s relations to Czechia are represented namely through his diplomatic services for count Kounic, during his diplomatic mission in as emperor’s ambassador in the Dutch Hague in 1698. One of the most famous architectonical project of Martineli is the chˆateau Slavkov by Brno (Austerlitz). Partners of this Project are, Universit¨atWien, Faculty of Philosophy of the Masaryk University in Brno, Senate of the Czech Republic, Liechtenstein Museum Vienna, U.S. -

Baroque Architecture
'"" ^ 'J^. rfCur'. Fig. I. — Venice. S. Maria della Salute. (See pp. 88-90.) BAROQUE ARCHITECTURE BY MARTIN SHAW BRIGGS A.K.I. B. A. " iAulhor of " In the Heel of Italy WITH 109 ILLUSTRATIONS NEW YORK ; ' McBRIDE, NAST & COMPANY ^ y 1914 ,iMvMV NA (^Ay n^/i/j reserved) In all ages there have been some excellent workmen, and some excellent work done.—Walter Pater. PREFACE is commonly supposed that the purpose of a preface is to IT explain the scope of a book to those who do not read so far as the first page. There is a touch of cynicism in such an opinion which makes one loth to accept it, but I prefer to meet my troubles half way by stating at the outset what I have emphasized in my last chapter—that this book is not in any way an attempt to create a wholesale revival of Baroque Architecture in England. It is simply a history of a complex and neglected period, and has been prepared in the uncertain intervals of an architectural practice. The difficulty of the work has been increased by the fact that the subject has never been dealt with as a whole in any language previously. Gurlitt in his Geschichte des Barockstiles, published in 1887, covered a considerable part of the ground, but his work is very scarce and expensive. To students his volumes may be recommended for their numerous plans, but for details and general views they are less valuable. In recent years several fine mono- graphs have appeared dealing with Baroque buildings in specific districts, and very recently in a new international series the principal buildings of the period in Germany and Italy have been illustrated. -

Background FELLOWSHIP REPORT
FELLOWSHIP REPORT Summary of work activities Iulia Adelina Turiac Intervention Epidemiology path (EPIET) Cohort 2015 Background The ECDC Fellowship Training Programme includes two distinct curricular pathways: Intervention Epidemiology Training (EPIET) and Public Health Microbiology Training (EUPHEM). After the two-year training EPIET and EUPHEM graduates are considered experts in applying epidemiological or microbiological methods to provide evidence to guide public health interventions for communicable disease prevention and control. Both curriculum paths are part of the ECDC fellowship programme that provides competency based training and practical experience using the ‘learning by doing’ approach in acknowledged training sites across the European Union (EU) and European Economic Area (EEA) Member States. Intervention Epidemiology path (EPIET) Field epidemiology aims to apply epidemiologic methods in day to day public health field conditions in order to generate new knowledge and scientific evidence for public health decision making. The context is often complex and difficult to control, which challenges study design and interpretation of study results. However, often in Public Health we lack the opportunity to perform controlled trials and we are faced with the need to design observational studies as best as we can. Field epidemiologists use epidemiology as a tool to design, evaluate or improve interventions to protect the health of a population. The European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) was created in 1995. Its purpose is to create a network of highly trained field epidemiologists in the European Union, thereby strengthening the public health epidemiology workforce at Member State and EU/EEA level. Current EPIET alumni are providing expertise in response activities and strengthening capacity for communicable disease surveillance and control inside and beyond the EU. -

Historic Centre of Vienna
WHC Nomination Documentation File Name: 1033.pdf UNESCO Region: EUROPE AND THE NORTH AMERICA __________________________________________________________________________________________________ SITE NAME: Historic Centre of Vienna DATE OF INSCRIPTION: 16th December 2001 STATE PARTY: AUSTRIA CRITERIA: C (ii)(iv)(vi) DECISION OF THE WORLD HERITAGE COMMITTEE: Excerpt from the Report of the 25th Session of the World Heritage Committee The Committee inscribed the Historic Centre of Vienna on the World Heritage List under criteria (ii), (iv), and (vi): Criterion (ii): The urban and architectural qualities of the Historic Centre of Vienna bear outstanding witness to a continuing interchange of values throughout the second millennium. Criterion (iv): Three key periods of European cultural and political development - the Middle Ages, the Baroque period, and the Gründerzeit - are exceptionally well illustrated by the urban and architectural heritage of the Historic Centre of Vienna. Criterion (vi): Since the 16th century Vienna has been universally acknowledged to be the musical capital of Europe. While taking note of the efforts already made for the protection of the historic town of Vienna, the Committee recommended that the State Party undertake the necessary measures to review the height and volume of the proposed new development near the Stadtpark, east of the Ringstrasse, so as not to impair the visual integrity of the historic town. Furthermore, the Committee recommended that special attention be given to continuous monitoring and control of any changes to the morphology of the historic building stock. BRIEF DESCRIPTIONS Vienna developed from early Celtic and Roman settlements into a Medieval and Baroque city, the capital of the Austro- Hungarian Empire. It played an essential role as a leading European music centre, from the great age of Viennese Classicism through the early part of the 20th century. -

Surveying Curriculum from the Point of View of Multidisciplinarity
Surveying Curriculum from the Point of View of Multidisciplinarity Vaclav SLABOCH, CLGE, Vice President for Professional Education Key words: Multidisciplinarity, Modern curriculum for Surveying Education, role of CLGE, multilateral Agreement of Mutual recognition of qualification. Necessity of a CPD system for Surveying Profession. SUMMARY The multidisciplinarity and globalization makes fade the differences among professions and surveying is no exception. CLGE - CLGE has a name in two of the many European languages English and French, namely “The Council of European Geodetic Surveyors” and “Comité de Liaison des Géomètres Européens”. A “Multilateral Agreement” on mutual recognition of qualification in surveying was signed in 2005 in Brussels by representatives of Germany, France, Belgium, Switzerland and Luxembourg. In 2006 also Slovakia joint this Agreement. The signature by the Czech Republic is recently under discussion. 1. MULTIDISCIPLINARITY AND GLOBALIZATION AND THEIR INFLUENCE ON SURVEYING The multidisciplinarity in our profession is nothing new. A good example might be the Famous Italian Surveyor an architect Domenico Martinelli (1650-1718 ) to whom an European Research Project financed from ERDF (European Regional Development Fund) has been dedicated. Martinelli was not a mere surveyor, but also a diplomat, judge, valuer, professor and architect. By the way his multidisciplinarity is typical even for present Italian surveyors. Martinelli´s relations to Czechia are represented namely through his diplomatic services for count Kounic, during his diplomatic mission in as emperor’s ambassador in the Dutch Hague in 1698 One of the most famous architectonical project of Martineli is the château Slavkov by Brno (Austerlitz) . Partners of this Project are, Universität Wien, Faculty of Philosophy of the Masaryk University in Brno, Senate of the Czech Republic, Liechtenstein Museum Vienna, U.S. -

Art Historiography on the Main Building of the University of Wrocław– a Battlefeld of Ideologies
RIHA Journal 0215 | 30 June 2019 Art Historiography on the Main Building of the University of Wrocław– A Battlefeld of Ideologies Karolina ara and !"ilia Kłoda Abstract The main building of the Univer ity of Wro#$aw, with it magni'#ent fa(ade fa#ing the )dra River, i one of the mo t im*ortant hi tori#al monument of the city and a ma+or touri t attra#tion, It al o hou e a signi'#ant in titution in the Poli h edu#ational land #a*e. Founded by Je uit and built in early eighteenth/#entury Baro1ue style, the Univer ity i clo ely conne#ted with the hi tory of the Hab burg monar#h! and it 2ounter/Reformation aim , For thi rea on, after 1945, it heritage wa di4#ult to re#on#ile with the o4#ial Communi t ideology and it initially anti/5erman sentiment , Thi arti#le ta#6le the que tion of how both art hi toriogra*hy and the po*ular media& in#luding guideboo6 and the pre of the Peo*le7 Re*ubli# of Poland, be#ame engaged in the ta 6 of proving the Poli h root of the Univer ity of Wro#$a%. To thi end, we provide an overview of the shifting inter*retation and attribution of the 0aro1ue edi'#e from it beginning in the eighteenth century until the se#ond de#ade of the twent!/'r t centur! in order to highlight the feature s*e#i'# to the di #our e in 8o#iali t time , $ontents Introdu#tion The ar#hite#tural hi tor! of the Univer it! and fr t referen#e to it Introdu#tion of the national identity argument in art hi toriogra*h! Re ear#h from the late 1920s until the end of the Se#ond World War -oli h re ear#h after 1945 The Univer ity of Wro#$aw in guide boo6 -

To Baroque Czech Republic
Guide to Baroque Czech Republic Edition 2017 Guide to Baroque Czech Republic Welcome to the Czech Republic .............................................................................. 2 Czech Republic, Land of Baroque ...........................................................................4 Prague “Baroque Heart of Europe” ............................................................................... 8 Příbram “Heading for the Silver Altar of the Virgin Mary of Svatá Hora” ............... 12 Český Krumlov “Across the Cloak Bridge to the Baroque Theatre and Gardens” .. 14 Holašovice “In Pursuit of Charming Houses of Rural Baroque” .............................. 18 Plzeň Region “West-Bohemian Baroque Gems” ....................................................... 22 Kladruby “Uncompromising Beauty” ......................................................................... 24 Karlovy Vary “Baroque Soul of an Art Nouveau Town” ............................................26 Mariánské Lázně “Expedition to Cross Spring”........................................................28 Teplice “Pop over to Little Paris”..................................................................................30 Kutná Hora “Cathedral of Two Worlds” .....................................................................32 Kuks “Following the Grand Dream of Count Špork” ...................................................36 Broumovsko “Churches Like Beads on a String” .......................................................40 Zelená hora “Santini's Ingenious Epilogue” -

To Baroque Czech Republic
Guide to Baroque Czech Republic Edition 2017 Guide to Baroque Czech Republic Welcome to the Czech Republic .............................................................................. 2 Czech Republic, Land of Baroque ...........................................................................4 Prague “Baroque Heart of Europe” ............................................................................... 8 Příbram “Heading for the Silver Altar of the Virgin Mary of Svatá Hora” ............... 12 Český Krumlov “Across the Cloak Bridge to the Baroque Theatre and Gardens” .. 14 Holašovice “In Pursuit of Charming Houses of Rural Baroque” .............................. 18 Plzeň Region “West-Bohemian Baroque Gems” ....................................................... 22 Kladruby “Uncompromising Beauty” ......................................................................... 24 Karlovy Vary “Baroque Soul of an Art Nouveau Town” ............................................26 Mariánské Lázně “Expedition to Cross Spring”........................................................28 Teplice “Pop over to Little Paris”..................................................................................30 Kutná Hora “Cathedral of Two Worlds” .....................................................................32 Kuks “Following the Grand Dream of Count Špork” ...................................................36 Broumovsko “Churches Like Beads on a String” .......................................................40 Zelená hora “Santini's Ingenious Epilogue” -

Md~And§J~ ~???6~And&~J~
d :o/~ md~and§J~ ~???6~and&~J~ Essays in Architectural History Presented to Hellmut Hager on his Sixty-sixth Birthday Edited by Henry A. Millon and Susan Scott Munshower Papers in Art History from The Pennsylvania State University Volume VIII IC/ 9 2- Fig. 21- 13 Here attributed to J.B. Fischer von Erlach, design for the Garden Palace Building, drawing. Cooper Hewilt Museum, New York. Turin's Contrada di Po as Theatre and Stradcne 497 Fig. 20-16 Ascanio Vitozzi, Contrada Nuova, Turin, 1615. From Augusto Cavallari Murat, ed., Forma urbana ed architellura nella Torino barocca, Turin, 1968, vol. 1. V' • • • • a • • ~f'N<t'"!) ~"'"l't~~ Fig. 20-17 Amedeo di Castcllamonte, Contrada di Po and exedra at Po gate, Turin, 1673- 1683, ink and water color. Turin, Archivio di Stato, Sez. Ia, Carte topografiche per A e B, Torino. Fischer von Erlach, Tiepolo, and the Unity of the Visual Arts* I am concerned in this paper to make two principal tarpiece merges the principle of an isolated figure group observations about the history of what has become one with that of a narrative relief, and incorporates the natural of the leading ideals of modern aesthetics, the notion light in both its form and its meaning (do the plastic of a unity among the various visual arts. The idea is rays belong to the architecture or to the sculpture? Is commonly, if quite anachronistically, sold under the label Teresa impregnated by the angel or illuminated by the "Gesamtkunstwerk." Too few people are aware that light?). Finally, the heavenly apparition painted in the this term was coined about 1850 by Richard Wagner vault seems to rise beyond and descend into the actual to express his holistic conception of an integrated mu space of the chapel via modeled polychrome stucco sic-drama-spectacle. -
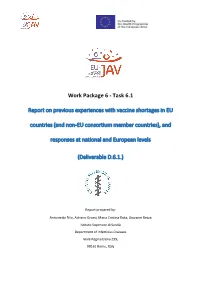
Report on Vaccine Shortages WP6 Task 6.1 FINAL
Work Package 6 - Task 6.1 Report on previous experiences with vaccine shortages in EU countries (and non-EU consortium member countries), and responses at national and European levels (Deliverable D.6.1.) Report prepared by: Antonietta Filia, Adriano Grossi, Maria Cristina Rota, Giovanni Rezza Istituto Superiore di Sanità Department of Infectious Diseases Viale Regina Elena 299, 00161 Rome, Italy Grant Agreement No.: 801495 Start Date: 01/08/2018 End Date: 31/07/2021 Project title European Joint Action on Vaccination — EU-JAV WP number WP6 Deliverable number D6.1 Responsible partner No. 9 Organisation Istituto Superiore di Sanità Name Antonietta Filia E-mail address [email protected] Nature Report on previous experiences with vaccine shortages in EU Report countries (and non-EU consortium member countries), and responses at national and European levels For more information about the report, please contact: Antonietta Filia M.D. Ph.D. Istituto Superiore di Sanità Department of Infectious Diseases Email: [email protected] Acknowledgements We would like to thank Truus de Graaf (Netherlands), Ángela Domínguez (Spain), Domenico Martinelli and Rosa Prato (Italy), José Tuells (Spain), and Pertti Sormunen (THL- Finland), for piloting the survey on vaccine shortages. We are also grateful to all participants in the survey. 1 Table of Contents Table of Contents .............................................................................................................................................. 2 List of Acronyms ............................................................................................................................................... -

One Thousand Years of Bibliophily from the 17Th to the 21St Century
One Thousand Years of Bibliophily From the 17th to the 21st Century PrPh Books Philobiblon 26 E 64th Street via Antonio Bertoloni 45 NY 10065 - New York 00197 - Roma +1 (646) 370-4657 +39 06 4555 5970 [email protected] via Borgonuovo 12 20121 - Milano +39 02 8907 6643 [email protected] Libreria Antiquaria Pregliasco via Accademia Albertina 3bis Philobiblon Uk Ltd 10123 - Torino correspondence address: +39 011 81 77 114 Third Floor, Carrington House, [email protected] 126-130 Regent Street London, W1B 5SD One Thousand Years of Bibliophily From the 17th to the 21st Century One Thousand Years of Bibliophily From the 11th to the 15th Century (items nos. 1 - 44) The Sixteenth Century (items nos. 45 - 178) From the 17th to the 21st Century (items nos. 179 - 290) Wind Roses and Compasses 179 Padovani, Fabrizio (fl. 16th-17th century). Tractatus duo, alter De Ventis, alter perbrevis De Terraemotu. Adiecto indice copiosissimo... Bologna, Giovanni Battista Bellagamba, 1601. Folio (312x217 mm). Collation: †4, A4, B4+1 (a singleton signed B3 added after quire B), C-Y4. [8], 1-16, 17*-18*, 17-163 [i.e. 165], [13] pages. Italic, roman, and Greek type. Woodcut printer’s device on the title-page. Thirty-nine engravings, including three full-page. Woodcut decorated initials, head- and tailpieces. Contemporary cardboards. A very fine, wide-margined copy. The rare first and only edition of this finely illustrated book, including fine engraved maps and plates of wind roses and compasses, among other technologies and technical schemata. The work is by Fabrizio Padovani, the ‘philosophus ac medicus’ from Forlì; it addresses the effects of winds and contains a full-page chart of the world, the Carta Marina, which also shows the Americas in a style that recalls the famous Nova Tabula executed by Giacomo Gastaldi for the Italian edition of Ptolemy’s Geography in 1548. -

Hrady a Zámky
HRADY A ZÁMKY NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ EDITORIAL Interest in recognising and understanding historical buildings as docu- menting national history initiated the monument protection movement at the end of the 18th century. The fashionable wave of romanticism at the beginning of the 19th century, when an emotional fascination with U zrodu ochrany památek stál na konci 18.století vědecký zájem the ruins of medieval castles and churches affected broader groups na poznání významných „starožitných“ staveb jako dokladů národní of society, brought up a new social topic: practical questions concer- historie. S módní vlnou romantismu počátku 19. století, kdy emocio- ning the preservation of historical buildings for both the present and nální okouzlení středověkými ruinami hradů a kostelů zasáhlo širší the future. After monument protection became institutionalised in společenské vrstvy, přišlo nové společenské téma, totiž praktické many European countries in the course of the 19th century, the experts otázky zachování historických staveb pro přítomnost a budoucnost. defined three declarative objectives of this newly-formed endeavour: Poté, co se v průběhu 19.století ochrana památek v řadě evropských scientific understanding of the monuments, their promotion among zemích institucionalizovala, formulovala odborná veřejnost tři prokla- the wider public and their physical protection. mativní cíle nového oboru – vědecké poznání památek, jejich popula- The 20th century brought specialisation into virtually all human rizaci v nejširších společenských vrstvách a fyzickou ochranu pamá- activities, including monument protection. Unfortunately, the original tek. Dvacáté století přineslo specializaci snad všech lidských činností concept was gradually marginalised, especially in the area of direct a specializace se nevyhnula ani ochraně památek.