Wolf-Dieter Narr Niemands-Herrschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Carl Orffs Hesperische Musik
MATTHIAS JOHANNES PERNERSTORFER / WIEN Carl Orffs hesperische Musik Carl Orffs ‚Antigonae‘ (1940–49) und ‚Oedi pus der Tyrann‘ (1951– 58) nach Sophokles in der Übersetzung von Friedrich Hölderlin sowie der aischyleische ‚Prometheus‘ (1963–67) in der Originalsprache gehören zu den bedeutendsten Beiträgen zur musikalischen Rezeption der Antike im 20. Jahrhundert. Ich folge Stefan Kunze im Gebrauch der Bezeichnung Tragödien-Bearbeitungen für die genannten Bühnenwerke, da „kein musi- kalisches Werk (Vertonung) auf der Grundlage eines Tragödientextes … das Ziel [ist] …, sondern die [interpretative, Anm. d. A.1 ] Darstellung der Tragödie mit musikalischen Mitteln“.2 Es handelt sich um eine Form des Musiktheaters ganz eigener Art – „gleich weit entfernt vom Sprechtheater herkömmlicher Prägung wie von der Oper und von der … Bühnenmusik“.3 Auch wenn der Musikhistoriker Werner Schubert vor einigen Jahren dia- gnostizierte: „Daß es [Orff] … nicht um eine Rekonstruktion antiker Aufführungspraxis ging, muß man heute nicht mehr eigens betonen“,4 so möchte ich anmerken, daß die Tragödien-Bearbeitungen Orffs von vielen Philologen wie Theaterwissenschaftlern, die die musikwissenschaftliche Diskussion nicht mitverfolgen, wohl noch immer – sei es zustimmend oder ablehnend – als Rekonstruktionsversuche rezipiert werden. Der Grund dafür liegt in der zum Teil euphorischen Reaktion von zeitgenössischen Philologen, durch die Orffs Werke den Stellenwert von authentischen Wie- dergaben der altgriechischen Tragödien erreichten. Jahrzehntelang widmete sich Carl Orff den Tragödien-Bearbeitungen, wobei nicht von einem Weg des Komponisten in die Geistes- oder Musik- welt der Antike gesprochen werden kann. DieAntike diente ihm in Form —————————— 1 Zum Interpretationscharakter dieser „Darstellung der Tragödie“ s.u. 2 Kunze 1998, 547. 3 Schubert 1998, 405. 4 Schubert 1998, 403. 122 Matthias Johannes Pernerstorfer ihrer Texte als Medium, das er im Sinne von Höl derlins Antikerezeption mit Blick auf eine abendländische Gegenwart – deshalb ‚hesperisch‘ – gestaltete. -

Brecht's Antigone in Performance
PERFORMANCE PHILOSOPHY RHYTHM AND STRUCTURE: BRECHT’S ANTIGONE IN PERFORMANCE BRUNO C. DUARTE FCSH UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA Brecht’s adaptation of Sophocles’ Antigone in 1948 was openly a political gesture that aspired to the complete rationalization of Greek Tragedy. From the beginning, Brecht made it his task to wrench ancient tragic poetry out of its ‘ideological haze’, and proceeded to dismantle and eliminate what he named the ‘element of fate’, the crucial substance of tragic myth itself. However, his encounter with Hölderlin's unorthodox translation of Antigone, the main source for his appropriation and rewriting of the play, led him to engage in a radical experiment in theatrical practice. From the isolated first performance of Antigone, a model was created—the Antigonemodell —that demanded a direct confrontation with the many obstacles brought about by the foreign structure of Greek tragedy as a whole. In turn, such difficulties brought to light the problem of rhythm in its relation to Brecht’s own ideas of how to perform ancient poetry in a modern setting, as exemplified by the originally alienating figure of the tragic chorus. More importantly, such obstacles put into question his ideas of performance in general, as well as the way they can still resonate in our own understanding of what performance is or might be in a broader sense. 1947–1948: Swabian inflections It is known that upon returning from his American exile, at the end of 1947, Bertolt Brecht began to work on Antigone, the tragic poem by Sophocles. Brecht’s own Antigone premiered in the Swiss city of Chur on February 1948. -

Kodály and Orff: a Comparison of Two Approaches in Early Music Education
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 KODÁLY AND ORFF: A COMPARISON OF TWO APPROACHES IN EARLY MUSIC EDUCATION Yrd.Doç.Dr. Dilek GÖKTÜRK CARY Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü [email protected] ABSTRACT The Hungarian composer and ethnomusicologist Zoltán Kodály (1882-1967) and the German composer Carl Orff (1895-1982) are considered two of the most influential personalities in the arena of music education during the twentieth-century due to two distinct teaching methods that they developed under their own names. Kodály developed a hand-sign method (movable Do) for children to sing and sight-read while Orff’s goal was to help creativity of children through the use of percussive instruments. Although both composers focused on young children’s musical training the main difference between them is that Kodály focused on vocal/choral training with the use of hand signs while Orff’s main approach was mainly on movement, speech and making music through playing (particularly percussive) instruments. Finally, musical creativity via improvisation is the main goal in the Orff Method; yet, Kodály’s focal point was to dictate written music. Key Words: Zoltán Kodály, Carl Orff, The Kodály Method, The Orff Method. KODÁLY VE ORFF: ERKEN MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN İKİ METODUN BİR KARŞILAŞTIRMASI ÖZET Macar besteci ve etnomüzikolog Zoltán Kodály (1882-1967) ve Alman besteci Carl Orff (1895-1982) geliştirmiş oldukları farklı 2 öğretim metodundan dolayı 20. yüzyılda müzik eğitimi alanında en etkili 2 kişi olarak anılmaktadırlar. Kodály çocukların şarkı söyleyebilmeleri ve deşifre yapabilmeleri için el işaretleri metodu (gezici Do) geliştirmiş, Orff ise vurmalı çalgıların kullanımı ile çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedef edinmiştir. -
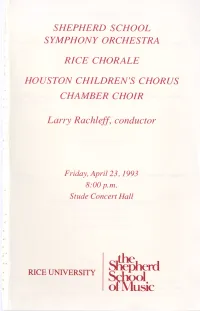
Of Music PROGRAM
SHEPHERD SCHOOL SYMPHONY ORCHESTRA RICE CHORALE HOUSTON CHILDREN'S CHORUS CHAMBER CHOIR Larry Rachleff, conductor Friday, April23, 1993 8:00p.m. Stude Concert Hall "-' sfkteherd RICE UNIVERSITY Sc~ol Of Music PROGRAM Fanfare for a Great City Arthur Gottschalk (b. 1952) Variations on a Theme of Joseph Haydn, Op. 56a Johannes Brahms (1833-1897) INTERMISSION Carmina Burana Carl Orff ( 1895-1982) Rice Chorale Houston Children's Chorus Chamber Choir Kelley Cooksey, soprano Francisco Almanza, tenor Robert Ames, baritone In consideration of the performers and members of the audience, please check audible paging devices with the ushers and silence audible timepieces. The taking of photographs and the use of recording equipment are prohibited. SHEPHERD SCHOOL SYMPHONY ORCHESTRA Violin I Viola (cont.) Oboe Trumpet (cont.) Julie Savignon, Erwin Foubert Margaret Butler Troy Rowley concertmaster Patrick Horn Kyle Bruckmann David Workman Claudia Harrison Stephanie Griffin Jeffrey Champion Trombone Barbara Wittenberg Bin Sun Dione Chandler Wade Demmert Jeanine Tiemeyer Andrew Weaver Karen Friedman David Ford Kristin Lacey Sharon Neufeld ~ Brent Phillips Mihaela Oancea English Horn Cello Kyle Bruckmann Inga Ingver Tuba Katherine de Bethune, Yenn Chwen Er Clarinet Jeffrey Tomberg principal Yoong-han Chan Benjamin Brady Danny Urban ~ Jeanne Jaubert Magdalena Villegas Joanne Court Scott Brady Timpani and Tanya Schreiber Kelly Cramm Mary Ellen Morris Percussion Rebecca Ansel Martin van Maanen Robin Creighton Douglas Cardwell Eitan Ornoy X in-Yang Zhou Amy -

Technology Fa Ct Or
Art.Id Artist Title Units Media Price Origin Label Genre Release 056030 V/A Soulshine's Soulful...2 1 Cd € 20 Nld Cstar 2st 8/01/2003 029148 Adler, Larry Great Larry Adler 1 Cd € 19 Eu Flapp A/R 26/02/1996 076013 Aurelie Desde Que Naci 1 Cd € 16 Eu Swim A/R 21/12/2004 076478 Catching Flies Just a Phase 1 Cd € 19 Eu Arts A/R 31/12/1999 070884 City City City Dawn and the Blue Light D 1 Cd € 25 Imp Senpr A/R 29/03/2004 010387 For.Mat Media Circus 1 Cd € 18 Usa Setan A/R 30/06/1990 045097 Half Hour To Go Items For the Full Outfit 1 Cd € 21 Usa Grass A/R 18/06/1996 028140 Hurlements D'leo Ouest Terne 1 Cd € 25 Nld Wagra A/R 12/09/2008 053085 La Crus Dentro Me 1 Cd € 21 Eu Warne A/R 10/02/2000 064901 La Crus Dentro Me 1 Cd € 22 Eu Wealo A/R 10/02/2000 064921 La Crus Dietro La Curva Del Cuore 1 Cd € 22 Eu Warne A/R 9/02/1999 056224 Lawn Backspace 1 Cd € 20 Nld My Fi A/R 23/10/2003 036508 Maple It's My Last Night 1 Cd € 20 Usa Slab A/R 26/02/1996 015227 Modest Mouse This is a Long Drive 1 Cd € 20 Usa Up Re A/R 26/03/1996 040539 More Dogs Never Let Them Catch 1 Cd € 20 Usa Monit A/R 3/05/2005 051289 Nein Wrath of Circuits 1 Cd € 19 Usa So.Un A/R 17/05/2005 075942 Pee Now More Charm and More. -

De Antigonae Exordio Sophooleae
DE ANTIGONAE EXORDIO SOPHOOLEAE <Da Antigonaa exordio Sophocleae? Nempe haec adsidue. <lUl~ 6evo" inquam.' At ego non in eis sumo qui tradita, quaa llullo pacto defendi possint, defendant inuita Minerua, neque heroie me persuasurum opinor, si nerba tradita disiecero ui niolentia uel muta,uero uel diruero. Sin nna littera addita cadent offensiones et difficultates grammatiea fauente, audire erit operae pretium, qua paeto reuera Oedipi filia me iudice elaram exorsa sit fabulam. Atque, sicuti in codice Lauren tiano hodie uersus iIIi exstaut soripti, ita il1m Cicerouis aetate legi fuisse eos solitos scholiasta auctor est. IIle enim da his uersibus: dJ ~ow6v, O:uu1.ösA!pOV 'Iop~V11r; 'Xaea de' olofl' ön Zsvr; TWV an' OUJlnov ~a'Xwv onolov ovxl vqJv lln 'waaw TslsI; suo iure adnotat: 81m31! oeotnwr;, neWTO'V f.1ev ätt, s:Tret7:a oe O:TrOtO'P, deXOVV7:0r; Da7:eeov. At istud Sn quod post olaDa positum nonnisi particulam polest significare una eum pro nomina relatiuo onolov iutellegi et tolerari posse, nemo de monstrabit nequß minor diffieultas erit, si ön pronomen re latiuum esse dicetur adiuncto altero relatiuo onolov. Sedem uara iniuriae recte soholiasta ilJe Graeeus indieat, est enim aut in 6n aut in ollolov: reliqua sana. Quod Ha esse etiam aHa ratione euineitur. Congrnit enim eum consuetudine poetae egregie ultimum uerhum .BA.BI: Zsv Zev .eA.etB Tar; lpa<; BvXa<; .eABt legitur AesehyL Agam. 973, imitatur enim in hoc ex ordio passim Aesehyli grande eloquium. Stat deinde nulli suspicioni obnoxium colon vi[>v sn (;woaw, item 'Z'Wv 'Ol 6tnov xauwv, siquidem Sophocles Philoct. 1087 nl1](!lora7fov aiflwv Avnar; -ci'i<; an' tpov. -

MODERN PERFORMANCES Marianne Mcdonald Sophocles Specializes in Heroism. His Heroes Will Stand up for What Th
SOPHOCLES MADE NEW: MODERN PERFORMANCES Marianne McDonald Sophocles specializes in heroism. His heroes will stand up for what they believe even if it costs their lives. This has made him a particular favourite of modern audiences. He was also popular in his own time. Tracking later productions is therefore an adventure in understanding modern cultures as well as that of ancient Greece.1 Performances began in Athens in 534bc with Thespis, and in the fth century they were given at dramatic festivals. The more popular plays were often revived in the following century. During these revivals they were vulnerable to adaptation and additions by actors and producers. After the Athenian Academy was closed in 529ad, classical texts and performance disappeared from sight for several centuries and did not re-emerge until the revival of learning in the early Byzantine period. Greek tragedy became known in the West mainly through Latin transla- tions, and often via Seneca (ca. 4bc–65ad). It is debatable whether Seneca’s dramas were ever actually performed in his lifetime. They always feature violence onstage, something that replicated the Rome of his time (he suf- fered under Nero’s excesses and was nally forced by him to commit sui- cide). The ancient Greeks did not relish this violence on their stage. This chapter will not list all modern productions; rather, a few will be selected as representative. A modern playwright should remember that the recent play is often compared with the original ancient play, and in many cases such comparisons show the modern version falling short. The ancient playwrights not only had profound themes, which remain relevant, but they were also poets. -

Propertius and Antigone: Innovation on the Theme of Eroticized Death
Brigham Young University BYU ScholarsArchive Theses and Dissertations 2020-03-27 Propertius and Antigone: Innovation on the Theme of Eroticized Death Chandler Richard Kendall Brigham Young University Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/etd Part of the Arts and Humanities Commons BYU ScholarsArchive Citation Kendall, Chandler Richard, "Propertius and Antigone: Innovation on the Theme of Eroticized Death" (2020). Theses and Dissertations. 8418. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/8418 This Thesis is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Propertius and Antigone: Innovation on the Theme of Eroticized Death Chandler Richard Kendall A thesis submitted to the faculty of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Arts Roger Macfarlane, Chair Seth Jeppesen Mike Pope Department of Comparative Arts and Letters Brigham Young University Copyright © 2020 Chandler Richard Kendall All Rights Reserved ABSTRACT Propertius and Antigone: Innovation on the Theme of Eroticized Death Chandler Richard Kendall Department of Comparative Arts and Letters, BYU Master of Arts This thesis looks closely at Propertius’ reception of the Antigone mythology in Propertius 2.8. First, I lay the groundwork to argue that Propertius is consciously receiving the Antigone mythology as found in Sophocles’ eponymous tragedy. I show through a close examination of language and themes that Propertius and Sophocles share semiotic markers of eroticized death that reveal Propertius’ intentional use of Sophocles’ tragedy, as opposed to other scholars who argue that Propertius is engaging with a later lost tradition of Haemon in Hellenistic poetry. -

Darmstadt Laudatio John Dew 03 03 12
LAUDATIO Sehr geehrter, lieber John Dew, meine sehr geehrten Premierengäste beim MOND von Carl Orff! Im vergangenen Jahrhundert gab es einige Regisseure, die sich kontinuierlich und intensiv mit dem Werk von Carl Orff auseinandergesetzt haben. Günther Rennert Oskar Fritz Schuh Rudolf Hartmann Wieland Wagner Heinz Arnold Gustav Rudolf Sellner August Everding Alle diese Regisseure haben in enger Zusammenarbeit mit Orff dessen Stücke entwickeln und aufführen können Wichtig ist aber, wie Orff immer wieder betonte, nicht nur, dass die Stücke uraufgeführt werden, sondern dass man sie nachspielt. Everding klagte oft, dass etwa 95% der Komponisten, deren Werke er inszenierte, tot waren und nicht mehr befragt werden konnten. Wieland Wagner hatte sogar geplant, PROMETHEUS im Rahmen der Bayreuther Festspiele uraufzuführen, was leider durch seinen frühen Tod 1966 vereitelt wurde. Hellmuth Matiasek hatte als künstlerischer Leiter von ORFF IN ANDECHS im dortigen Florianstadl die Märchenopern DER MOND, DIE KLUGE, den SOMMERNACHTSTRAUM, ASTUTULI und DIE BERNAUERIN herausgebracht. Marcus Everding setzt nun diese Tradition fort in Zusammenarbeit mit der Orchesterakademie des Münchner Rundfunkorchesters. Sie, lieber John Dew, sind der erste und einzige in diesem Jahrhundert, der es gewagt hat, als Intendant eines Opernhauses das Bühnenwerk von Carl Orff konsequent auf die Bühne zu bringen. Sie begannen gleich mit dem Schwierigsten: mit den Griechendramen OEDIPUS und ANTIGONAE, jenen Werken, in denen sich Orff am radikalsten vom Operntheater entfernt und sich mit dem traditionellen japanischen Theater auseinandergesetzt hat. Er sagte mir einmal nach dem Besuch einer No-Theater-Aufführung im Münchner Marstalltheater: “Selbst wenn es nicht so ist, i c h glaube an die Wiedergeburt der griechischen Tragödie durch das japanische Theater!“ Sie haben die beiden Sophoklesdramen in der deutschen Übertragung von Friedrich Hölderlin überzeugend auf die Bühne gestellt und damit gezeigt, wie aktuell diese Orffsche Sophoklesdeutung noch heute ist. -

Inhaltsverzeichnis
Carl Orff Zur Navigation springen Zur Suche springen Orff ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel. Weitere Bedeutungen sind unter Orff (Begriffsklärung) aufgeführt. Carl Orff (1956) Carl Orff um 1970 Carl Orff (* 10. Juli 1895 in München; † 29. März 1982 ebenda) war ein deutscher Komponist und Musikpädagoge. Sein bekanntestes Werk ist die szenische Kantate Carmina Burana, die zu einem der populärsten Chorwerke des 20. Jahrhunderts wurde. Inhaltsverzeichnis • 1 Leben o 1.1 Verhältnis zum NS-Staat o 1.2 Weitere Tätigkeiten o 1.3 Privatleben • 2 Werke o 2.1 Bühnenwerke o 2.2 Andere Werke • 3 Ehrungen (Auswahl) • 4 Nachwirken und Rezeption • 5 Schüler • 6 Siehe auch • 7 Literatur • 8 Weblinks • 9 Einzelnachweise Leben Carl Orff, 1895 in der Maillingerstraße 16 (heute: Hausnr. 30[1]) im Münchener Stadtteil Neuhausen geboren,[2] war der Sohn des Berufsoffiziers Heinrich Orff und erhielt ab 1900 Klavier-, Cello- und Orgelunterricht. In diesem Jahr erschien auch seine erste Komposition. Frühe Erfahrung im Musizieren in der Gruppe sammelte er als Schüler des Wittelsbacher- Gymnasiums, wo er das Schulorchester auf der Orgel, dem Klavier oder Harmonium begleitete und im Schulchor Solopartien als Sopran übernahm. Außerdem sang er sonntags im Kirchenchor, und zuhause, von seiner Mutter am Klavier begleitet, Opernpartien nach Klavierauszügen. Mit 14 Jahren war er nach dem Besuch der Oper Der Fliegende Holländer von Richard Wagner tagelang so erregt, dass er diese bald darauf mit einem Klavierauszug ausgestattet erneut besuchen musste, um wieder ansprechbar zu werden.[3] Nachdem Carl Orff 1911 unter anderem Gedichte von Hölderlin und Heine für Gesang und Klavier vertont hatte, studierte er von 1913 bis 1914 an der Königlichen Akademie der Tonkunst in München und widmete sich daneben der Musikpädagogik. -

Opera by the Book: Defining Music Theater in the Third Reich
Opera by the Book: Defining Music Theater in the Third Reich The MIT Faculty has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters. Citation Pollock, Emily Richmond. “Opera by the Book: Defining Music Theater in the Third Reich.” The Journal of musicology 35 (2018): 295-335 © 2018 The Author As Published https://dx.doi.org/10.1525/JM.2018.35.3.295 Publisher University of California Press Version Author's final manuscript Citable link https://hdl.handle.net/1721.1/125555 Terms of Use Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike Detailed Terms http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 1 Opera by the Book: Defining Music Theater in the Third Reich EMILY RICHMOND POLLOCK What was “Nazi opera”? Scholars have long critiqued the most common tropes regarding the aesthetics of opera during the Third Reich—Richard Wagner around the clock, enforced militaristic kitsch, neo-Romantic bombast—and rejected the idea that the Reich’s bureaucratic efforts to control culture had as homogenizing an effect on German music as historians once thought.1 These tropes, which strategically alienated “Nazi music” from the historical teleology of Classical music and our common sense of musical “quality,” further enabled other, more pernicious myths to flourish: that great music is always autonomous, not political; that “Nazi” art (debased, instrumentalized) was something obviously distinct from “German” art (great, A version of this essay was first presented at the MIT Works in Progress Series and at the annual meeting of the American Musicological Society in Pittsburgh (November 2013). -

14 August 2009 Page 1 of 21 SATURDAY 08 AUGUST 2009 Audrone Kisieliute (Piano) ERATO ECD88236 Tr 5
Radio 3 Listings for 8 – 14 August 2009 Page 1 of 21 SATURDAY 08 AUGUST 2009 Audrone Kisieliute (piano) ERATO ECD88236 tr 5 SAT 01:00 Through the Night (b00lxvf2) 5.26am 07.52 1.00am Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907): Holberg Suite, Op 40 Dvorak, Antonin (1841-1904): From the Bohemian Forest, Op Bergen Philharmonic Orchestra GRIEG 68 Andrew Litton (conductor) Four Psalms Op.74 Konstantin Lifschitz, Diana Ketler (pianos) – God’s Son hath set me free 5.46am David Wilson Johnson (baritone) 1.17am Handel, Georg Frideric (1685-1759): Organ Concerto No 1, Op Polyphony Brahms, Johannes (1833-1897): Quintet in B minor for clarinet 4, No 1 Stephen Layton and strings, Op 115 Concerto Copenhagen HYPERION CDA 66793 tr 10 Reto Bieri (clarinet) Lars Ulrich Mortensen (organ/director) Daishin Kashimoto, Corinne Chapelle (violins) 08.03 Razvan Popovici (viola) 6.02am Bernhard Naoki Hedenborg (cello) Brahms, Johannes (1833-1897): 25 Variations and fugue on a TCHAIKOVSKY theme by GF Handel for piano, Op 24 Piano Concerto No.1 in B Flat minor 1.54am Simon Trpceski (piano) final movt Sibelius, Jean (1865-1957): Hostkvall, Op 38, No 1 Martha Argerich (piano) Soile Isokoski (soprano) 6.27am Berlin Philharmonic Finnish Radio Symphony Orchestra Stanford, Charles Villiers (1852-1924): When Mary thro' the Claudio Abbado Jukka-Pekka Saraste (conductor) garden went, Op 127, No 3 DG 449 816-2 tr 3 BBC Singers 1.59am Bob Chilcott (conductor) 08.10 Schmitt, Matthias (b.1958): Ghanaia for solo percussion Colin Currie (marimba) 6.30am Mikis THEODORAKIS Hartmann, Johann Peter Emilius (1805-1900): Blomstre som en The Train leaves at eight 2.07am rosengard Agnes Baltsa (mezzo) Paganini, Niccolo (1782-1840): Concerto No 1 in D for violin Fionian Chamber Choir Athens Experimental Orchestra, and orchestra, Op 6 Alice Granum (director) Stavros Xarhakos (conductor) Jaap van Zweden (violin) DG 477 7428 tr 5 Netherlands Radio Symphony Orchestra 6.36am Kenneth Montgomery (conductor) Debussy, Claude (1862-1918): La mer 08.15 BBC Scottish Symphony Orchestra 2.34am Ilan Volkov (conductor).