Francia. Band 44
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LECTURE 5 the Origins of Feudalism
OUTLINE — LECTURE 5 The Origins of Feudalism A Brief Sketch of Political History from Clovis (d. 511) to Henry IV (d. 1106) 632 death of Mohammed The map above shows to the growth of the califate to roughly 750. The map above shows Europe and the East Roman Empire from 533 to roughly 600. – 2 – The map above shows the growth of Frankish power from 481 to 814. 486 – 511 Clovis, son of Merovich, king of the Franks 629 – 639 Dagobert, last effective Merovingian king of the Franks 680 – 714 Pepin of Heristal, mayor of the palace 714 – 741 Charles Martel, mayor (732(3), battle of Tours/Poitiers) 714 – 751 - 768 Pepin the Short, mayor then king 768 – 814 Charlemagne, king (emperor, 800 – 814) 814 – 840 Louis the Pious (emperor) – 3 – The map shows the Carolingian empire, the Byzantine empire, and the Califate in 814. – 4 – The map shows the breakup of the Carolingian empire from 843–888. West Middle East 840–77 Charles the Bald 840–55 Lothair, emp. 840–76 Louis the German 855–69 Lothair II – 5 – The map shows the routes of various Germanic invaders from 150 to 1066. Our focus here is on those in dark orange, whom Shepherd calls ‘Northmen: Danes and Normans’, popularly ‘Vikings’. – 6 – The map shows Europe and the Byzantine empire about the year 1000. France Germany 898–922 Charles the Simple 919–36 Henry the Fowler 936–62–73 Otto the Great, kg. emp. 973–83 Otto II 987–96 Hugh Capet 983–1002 Otto III 1002–1024 Henry II 996–1031 Robert II the Pious 1024–39 Conrad II 1031–1060 Henry I 1039–56 Henry III 1060–1108 Philip I 1056–1106 Henry IV – 7 – The map shows Europe and the Mediterranean lands in roughly the year 1097. -

Copyright by Cécile Hélène Christiane Rey 2010
Copyright by Cécile Hélène Christiane Rey 2010 The Dissertation Committee for Cécile Hélène Christiane Rey certifies that this is the approved version of the following dissertation: Planning language practices and representations of identity within the Gallo community in Brittany: A case of language maintenance Committee: _________________________________ Jean-Pierre Montreuil, Supervisor _________________________________ Cinzia Russi _________________________________ Carl Blyth _________________________________ Hans Boas _________________________________ Anthony Woodbury Planning language practices and representations of identity within the Gallo community in Brittany: A case of language maintenance by Cécile Hélène Christiane Rey, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin December, 2010 Acknowledgements I would like to thank my parents and my family for their patience and support, their belief in me, and their love. I would like to thank my supervisor Jean-Pierre Montreuil for his advice, his inspiration, and constant support. Thank you to my committee members Cinzia Russi, Carl Blyth, Hans Boas and Anthony Woodbury for their guidance in this project and their understanding. Special thanks to Christian Lefeuvre who let me stay with him during the summer 2009 in Langan and helped me realize this project. For their help and support, I would like to thank Rosalie Grot, Pierre Gardan, Christine Trochu, Shaun Nolan, Bruno Chemin, Chantal Hermann, the associations Bertaèyn Galeizz, Chubri, l’Association des Enseignants de Gallo, A-Demórr, and Gallo Tonic Liffré. For financial support, I would like to thank the Graduate School of the University of Texas at Austin for the David Bruton, Jr. -

Francia. Band 44
Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte. Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris (Institut historique allemand) Band 44 (2017) Nithard as a Military Historian of the Carolingian Empire, c 833–843 DOI: 10.11588/fr.2017.0.68995 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Bernard S. Bachrach – David S. Bachrach NITHARD AS A MILITARY HISTORIAN OF THE CAROLINGIAN EMPIRE, C 833–843 Introduction Despite the substantially greater volume of sources that provide information about the military affairs of the ninth century as compared to the eighth, the lion’s share of scholarly attention concerning Carolingian military history has been devoted to the reign of Charlemagne, particularly before his imperial coronation in 800, rather than to his descendants1. Indeed, much of the basic work on the sources, that is required to establish how they can be used to answer questions about military matters in the period after Charlemagne, remains to be done. An unfortunate side-effect of this rel- ative neglect of military affairs as well as source criticism for the ninth century has been considerable confusion about the nature and conduct of war in this period2. -

Mosel Fine Wines “The Independent Review of Mosel Riesling”
Mosel Fine Wines “The Independent Review of Mosel Riesling” By Jean Fisch and David Rayer Issue No 26 – October 2014 Mosel Fine Wines The aim of Mosel Fine Wines is to provide a comprehensive and independent review of Riesling wines produced in the Mosel, Saar and Ruwer region, and regularly offer a wider perspective on the wines produced in other parts of Germany. Mosel Fine Wines appears on a regular basis and covers: Reports on the current vintage (including the annual auctions held in Trier). Updates on how the wines mature. Perspectives on specific topics such as vineyards, Estates, vintages, etc. All wines reviewed in the Mosel Fine Wines issues are exclusively tasted by us (at the Estates, trade shows or private tastings) under our sole responsibility. Table of Contents Vintage Report 2014 (Part II) ………………..……………………………….………………………………….…………. 3 Review by Estate (Part II) ………………..……….…………………………………..…………………….… 3 Other Noteworthy Wines ……..……….……………..……..…………………………………………………….….. 47 Auctions 2014: A Look Back ……………………….………..…….……..…………………………………………. 59 Mosel Perspectives: The bumpy road to a Vineyard Classification ………………………………………………..…… 63 Contact Information For questions or comments, please contact us at: [email protected]. © Mosel Fine Wines. All rights reserved. Unauthorized copying, physical or electronic distribution of this document is strictly forbidden. Quotations allowed with mention of the source. www.moselfinewines.com page 1 Issue No 26 - October 2014 Mosel Fine Wines “The Independent Review of Mosel Riesling” By Jean Fisch and David Rayer Principles Drinking window The drinking window provided refers to the maturity period: Mosel Riesling has a long development cycle and can often be enjoyable for 20 years and more. Like great Bordeaux or Burgundy, the better Mosel Riesling generally goes through a muted phase before reaching its full maturity plateau. -

Albert Schweitzer: a Man Between Two Cultures
, .' UNIVERSITY OF HAWAI'I LIBRARY ALBERT SCHWEITZER: A MAN BETWEEN TWO CULTURES A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI'I IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN LANGUAGES AND LITERATURES OF • EUROPE AND THE AMERICAS (GERMAN) MAY 2007 By Marie-Therese, Lawen Thesis Committee: Niklaus Schweizer Maryann Overstreet David Stampe We certify that we have read this thesis and that, in our opinion, it is satisfactory in scope and quality as a thesis for the degree of Master of Arts in Languages and Literatures of Europe and the Americas (German). THESIS COMMITIEE --~ \ Ii \ n\.llm~~~il\I~lmll:i~~~10 004226205 ~. , L U::;~F H~' _'\ CB5 .H3 II no. 3Y 35 -- ,. Copyright 2007 by Marie-Therese Lawen 1II "..-. ACKNOWLEDGMENTS T I would like to express my deepest gratitude to a great number of people, without whose assistance, advice, and friendship this thesis w0l!'d not have been completed: Prof. Niklaus Schweizer has been an invaluable mentor and his constant support have contributed to the completion of this work; Prof. Maryann Overstreet made important suggestions about the form of the text and gave constructive criticism; Prof. David Stampe read the manuscript at different stages of its development and provided corrective feedback. 'My sincere gratitude to Prof. Jean-Paul Sorg for the the most interesting • conversations and the warmest welcome each time I visited him in Strasbourg. His advice and encouragement were highly appreciated. Further, I am deeply grateful for the help and advice of all who were of assistance along the way: Miriam Rappolt lent her editorial talents to finalize the text; Lynne Johnson made helpful suggestions about the chapter on Bach; John Holzman suggested beneficial clarifications. -

Selected Ancestors of the Chicago Rodger's
Selected Ancestors of the Chicago Rodger’s Volume I: Continental Ancestors Before Hastings David Anderson March 2016 Charlemagne’s Europe – 800 AD For additional information, please contact David Anderson at: [email protected] 508 409 8597 Stained glass window depicting Charles Martel at Strasbourg Cathedral. Pepin shown standing Pepin le Bref Baldwin II, Margrave of Flanders 2 Continental Ancestors Before Hastings Saints, nuns, bishops, brewers, dukes and even kings among them David Anderson March 12, 2016 Abstract Early on, our motivation for studying the ancestors of the Chicago Rodger’s was to determine if, according to rumor, they are descendants of any of the Scottish Earls of Bothwell. We relied mostly on two resources on the Internet: Ancestry.com and Scotlandspeople.gov.uk. We have been subscribers of both. Finding the ancestral lines connecting the Chicago Rodger’s to one or more of the Scottish Earls of Bothwell was the most time consuming and difficult undertaking in generating the results shown in a later book of this series of three books. It shouldn’t be very surprising that once we found Earls in Scotland we would also find Kings and Queens, which we did. The ancestral line that connects to the Earls of Bothwell goes through Helen Heath (1831-1902) who was the mother and/or grandmother of the Chicago Rodger’s She was the paternal grandmother of my grandfather, Alfred Heath Rodger. Within this Heath ancestral tree we found four lines of ancestry without any evident errors or ambiguities. Three of those four lines reach just one Earl of Bothwell, the 1st, and the fourth line reaches the 1st, 2nd and 3rd. -
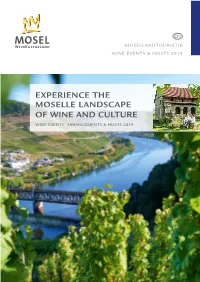
Experience the Moselle Landscape of Wine And
EN MOSELLANDTOURISTIK WINE EVENTS & HOSTS 2019 EXPERIENCE THE MOSELLE LANDSCAPE OF WINE AND CULTURE WINE EVENTS, ARRANGEMENTS & HOSTS 2019 Dear guests and friends of the Moselle region, UNIQUE ORIGINS, we are delighted by your interest in spending your For information on your SEDUCTIVE ENJOYMENT. holiday in our attractive landscape of wine and culture. Moselle vacation contact: This brochure starts off by providing you with a Mosellandtouristik GmbH comprehensive overview of the appealing package Kordelweg 1 · 54470 Bernkastel-Kues offers available for a care-free stay by the Moselle, Saar Telephone +49(0)6531/9733-0 and Ruwer rivers. Thereafter we will introduce our local Fax +49(0)6531/9733-33 hosts, who will gladly spoil you individually with the hospitality that is typical for the Moselle region. [email protected] www. mosellandtouristik.de/en Discover the Moselle region with us – be it on a www.facebook.com/mosellandtouristik short trip or an entire holiday, as a guest in a hotel, a boarding house, in a winery, or in a holiday apartment. Please don’t hesitate to contact us directly if you are Bookinghotline: +49 (0)6531 97330 seeking advice or would like to place a booking. eMail: [email protected] Web: www.mosellandtouristik.de/en, www.facebook.com/Mosellandtouristik Have fun planning your holidays! Your Moselland Tourism EXPERIENCE THE MOSELLE LANDSCAPE OF WINE AND CULTURE Map of the region 4 in the footsteps of the Romans 21 The Mosel – One of the most beautiful Exclusive short trip to the Saarburger Land 22 river landscapes in Europe 6 UNESCO World Heritage treasures in Trier 22 The most beautiful side of country life 8 Discover the city of Trier on the Roman Wine Road 22 Moselle, with body and soul 10 Girls on Tour – Discover. -

Inauguration and Images of Kingship in England, France and the Empire C.1050-C.1250
Christus Regnat: Inauguration and Images of Kingship in England, France and the Empire c.1050-c.1250 Johanna Mary Olivia Dale Submitted for examination for the degree of Doctor of Philosophy University of East Anglia School of History November 2013 This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that use of any information derived there from must be in accordance with current UK Copyright Law. In addition, any quotation or extract must include full attribution. Abstract This thesis challenges the traditional paradigm, which assumes that the period c.1050-c.1250 saw a move away from the ‘biblical’ or ‘liturgical’ kingship of the early Middle Ages towards ‘administrative’ or ‘law-centred’ interpretations of rulership. By taking an interdisciplinary and transnational approach, and by bringing together types of source material that have traditionally been studied in isolation, a continued flourishing of Christ-centred kingship in the twelfth and early thirteenth centuries is exposed. In demonstrating that Christological understandings of royal power were not incompatible with bureaucratic development, the shared liturgically inspired vocabulary deployed by monarchs in the three realms is made manifest. The practice of monarchical inauguration forms the focal point of the thesis, which is structured around three different types of source material: liturgical texts, narrative accounts and charters. Rather than attempting to trace the development of this ritual, an approach that has been taken many times before, this thesis is concerned with how royal inauguration was understood by contemporaries. Key insights include the importance of considering queens in the construction of images of royalty, the continued significance of unction despite papal attempts to lower the status of royal anointing, and the depth of symbolism inherent in the act of coronation, which enables a reinterpretation of this part of the inauguration rite. -

Minitour Eifel Moselle 2021 - 3 Days Services
Minitour Eifel Moselle 2021 - 3 Days services: Services included in this package:- 3 days with 2 nights in the same hotel Duration: 3 days 2 nights | Star tour: Bernkastel-Kues - 2 x rich breakfast - 1 x cup of coffee with a piece of cake or pralines Fitness level: medium | Experience: pleasure & wine, comfortable, for groups - 1 x passenger/bike transfer to Daun to the Start: daily | Execution: private unaccompanied Maare-Mosel-Radweg - 1 x homemade tarte flambée with cider Our relaxed short tour through the Eifel and along the Middle Moselle gives you an insight - 1 x Moselle cycling map and detailed tour description per room into our beautiful surroundings and certainly makes you want more... - Tips for travel preparation, restaurant recommendations, tips for refreshments DAY 1: ARRIVAL TO BERNKASTEL-KUES - Roadside assistance tips and a service hotline 7 days a week You travel on your own to Bernkastel-Kues, from where you can explore the Middle Moselle and the Vulkaneifel by bike. Visit the Wine Museum to learn how winemakers work. In the city center you can look at half-timbered houses and fountains while you stroll through the idyllic little streets. As a welcome, we invite you to the pastry chef fora cup of coffee and a piece of Moselle wine cake or homemade pralines. added options / discounts: DAY 2: CYCLING TOUR DAUN TO BERNKASTEL-KUES | 55 KM Pre-night Bernkastel-Kues single room 84 € standard In the morning a transfer bus takes you to Daun, where your bike tour through the Vulkaneifel begins. Cycle Pre-night Bernkastel-Kues double room 65 € comfortably down a disused railway line. -

Sailing the Scenic Moselle to Luxembourg 20Th September 2020 8 Days from £1699Pp*
Sailing the Scenic Moselle to Luxembourg 20th September 2020 8 Days from £1699pp* BRAND NEW RIVER CRUISE! Journey through three different sections of the subline Moselle River. Experience scenic, architectural and cultural delights. Exclusively Regent Itinerary & Ports of Call ms Brabant Sunday 20th September 2020 - Cologne, Germany This dedicated River Cruise boat Fully escorted by a Regent is an elegant vessel, with a classic Travel Tour Manager We depart Staffordshire for Manchester airport and our flight to style reminiscent of Fred. Olsen’s (subject to minimum numbers) Cologne, which is situated on the Rhine River - once the largest city in ocean-going cruise ships. Return flights from the Holy Roman Empire, it served as a major trade route in the middle Brabant’s 79 well-equipped rooms ages. Arriving in Germany, we board the ms Brabant this evening, our and suites, spread across four Manchester Airport to home for the next 7 nights. Free time to settle in. decks, provide a comfortable, Cologne Airport homely feel, whilst her spacious Monday 21st September 2020 - Cochem, Germany public areas give plenty of 7 nights full board stay on entertainment options. Fred. Olsen’s wonderful river This morning we cruise the narrow Lower Moselle Valley, sailing past Her smaller size offers an intimate beautiful ever-changing landscapes including vineyards, imposing cliffs, cruise vessel ms Brabant ambience and great access to steep hills and centuries old castles. We then make our way to Cochem smaller ports and the heart of each Four cabin grades which is a small fairy-tale like town in Germany. -

Bovine Epidemic Killing Virtually All the Cattle. That Created a Great Loss of Milk, Cheese and Meat for the People
bovine epidemic killing virtually all the cattle. That created a great loss of milk, cheese and meat for the people. His son Pepin also died that year followed in a few months by son Charles. That left Charlemagne’s least favorite son as heir. Charles began tidying his affairs to assure succession. At a major assembly in Aachen, he crowned his son Louis as joint emperor. Charles’ could only hope that Louis could control regional loyalties and rivalry between the aristocrats. Charles then focused on maintaining peace with the Danes and Byzantines. The following map shows his Empire, the inset is after it has been divided among threes grandsons, children of Louis the Pious. Emperor Charles was 71 when died on Jan 28th 814 and buried in Aachen’s church basilica. Charles’s son: Louis I8 the Pious was age 26 when his father died. Although well educated and very religious, he could not retain the loyalty of the aristocracy who were vital to his administration. He also lacked his father’s energy and personality that caused the beginning of the disintegration of an empire made up of a collection of tribes who wished to advance their own local positions. Louis I divided the empire among his sons in 817 who were caught up in a family conflict. To resolve that issue, Louis I put his own sisters and half brothers in religious houses and murdered his nephew, Bernard, King of Italy. His father’s large domain was now filled with ruffians and pirates rummaging its waterways. Its lands run by tribal groups headed by aristocratic warrior leaders. -

The Venetian Conspiracy
The Venetian Conspiracy « Against Oligarchy – Table of Contents Address delivered to the ICLC Conference near Wiesbaden, Germany, Easter Sunday, 1981; (appeared in Campaigner, September, 1981) Periods of history marked, like the one we are living through, by the convulsive instability of human institutions pose a special challenge for those who seek to base their actions on adequate and authentic knowledge of historical process. Such knowledge can come only through viewing history as the lawful interplay of contending conspiracies pitting Platonists against their epistemological and political adversaries. There is no better way to gain insight into such matters than through the study of the history of the Venetian oligarchy, the classic example of oligarchical despotism and evil outside of the Far East. Venice called itself the Serenissima Republica (Serene Republic), but it was no republic in any sense comprehensible to an American, as James Fenimore Cooper points out in the preface to his novel The Bravo. But its sinister institutions do provide an unmatched continuity of the most hideous oligarchical rule for fifteen centuries and more, from the years of the moribund Roman Empire in the West to the Napoleonic Wars, only yesterday in historical terms. Venice can best be thought of as a kind of conveyor belt, transporting the Babylonian contagions of decadent antiquity smack dab into the world of modern states. The more than one and one-half millennia of Venetian continuity is first of all that of the oligarchical families and the government that was their stooge, but it is even more the relentless application of a characteristic method of statecraft and political intelligence.