Wilhelm Karczag 3 1.2 Hubert Marischka 5 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Eberhard Waechter“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Eberhard Waechter“ Verfasserin Mayr Nicoletta angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl: A 317 Studienrichtung: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof.Dr. Hilde Haider-Pregler Dank Ich danke vor allem meiner Betreuerin Frau Professor Haider, dass Sie mir mein Thema bewilligt hat und mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich danke der Familie Waechter und Frau Anneliese Sch. für die Bereitstellung des Materials. Ich danke meiner Schwester Romy und meiner „Seelenverwandten“ Sheila und all meinen Freunden für ihre emotionale Unterstützung und die zahlreichen motivierenden Gespräche. Ich danke meinem Bruder Florian für die Hilfe im Bereich der Computertechnik. Ein großer Dank gilt meiner Tante Edith, einfach dafür, dass es dich gibt. Außerdem danke ich meinen Großeltern, dass sie meine Liebe zur Musik und zur Oper stets enthusiastisch aufgenommen haben und mit mir Jahr für Jahr die Operettenfestspiele in Bad Ischl besucht haben. Ich widme meine Diplomarbeit meinen lieben Eltern. Sie haben mich in den letzten Jahren immer wieder finanziell unterstützt und mir daher eine schöne Studienzeit ermöglicht haben. Außerdem haben sie meine Liebe und Leidenschaft für die Oper stets unterstützt, mich mit Büchern, Videos und CD-Aufnahmen belohnt. Ich danke euch für eure Geduld und euer Verständnis für eure oft komplizierte und theaterbessene Tochter. Ich bin glücklich und froh, so tolle Eltern zu haben. Inhalt 1 Einleitung .......................................................................................... -

Podium Operette: Du Mein Schönbrunn
Podium Operette: Du mein Schönbrunn Kaiserin, Kaiser und Imperiales als Topoi der Wiener Operette Zum 300. Geburtstag Maria Theresias Universitätslehrgang Klassische Operette (Leitung: Wolfgang Dosch) Donnerstag, 11. Mai 2017 18.00 Uhr Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien MUK.podium Johannesgasse 4a, 1010 Wien PROGRAMM Leo Fall (1873, Olmütz – 1925, Wien) aus Die Kaiserin (Text: Julius Brammer/ Alfred Grünwald), 1915, Berlin Metropoltheater Wenn die Wiener Edelknaben Michiko Fujikawa, Sopran Nataliia Ulasevych, Sopran Jantus Philaretou, Bariton Wir sind drei feine Diplomaten Seungmo Jung, Tenor Wonbae Cho, Tenor Jantus Philaretou, Bariton Die Kaiserin: Original Klavierauszug Du mein Schönbrunn Adriana Hernandez Flores, Sopran Mir hat heute Nacht von ein’ Tanzerl geträumt Adriana Hernandes Flores, Sopran Jantus Philaretou, Bariton Ja, so singt man und tanzt man in Wien Nataliia Ulasevych, Sopran Seungmo Jeong, Tenor Fritzi Massary als Maria Theresia, UA Berlin 1915 2 Nico Dostal (1895, Korneuburg – 1981, Salzburg) aus Die ungarische Hochzeit (Text: Hermann Hermecke), 1939, Stuttgart Märchentraum der Liebe Wonbae Cho, Tenor Bruno Granichstaedten (1879, Wien – 1944, New York) aus Auf Befehl der Kaiserin (Text: Leopold Jacobson/ Robert Bodanzky), 1915, Wien Wann die Musik spielt Michiko Fujikawa, Sopran Nataliia Ulasevych, Sopran Seungmo Jeong, Tenor Dolores Schmidinger als Maria Theresia, Komm’, die Kaiserin will tanzen Die Ungarische Hochzeit, Lehár Festival Bad Ischl, 2015 © Foto Hofer Sonja Gebert, Sopran Branimir Agovi, Bariton -

German Operetta on Broadway and in the West End, 1900–1940
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.202.58, on 26 Sep 2021 at 08:28:39, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://www.cambridge.org/core/product/2CC6B5497775D1B3DC60C36C9801E6B4 Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.202.58, on 26 Sep 2021 at 08:28:39, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://www.cambridge.org/core/product/2CC6B5497775D1B3DC60C36C9801E6B4 German Operetta on Broadway and in the West End, 1900–1940 Academic attention has focused on America’sinfluence on European stage works, and yet dozens of operettas from Austria and Germany were produced on Broadway and in the West End, and their impact on the musical life of the early twentieth century is undeniable. In this ground-breaking book, Derek B. Scott examines the cultural transfer of operetta from the German stage to Britain and the USA and offers a historical and critical survey of these operettas and their music. In the period 1900–1940, over sixty operettas were produced in the West End, and over seventy on Broadway. A study of these stage works is important for the light they shine on a variety of social topics of the period – from modernity and gender relations to new technology and new media – and these are investigated in the individual chapters. This book is also available as Open Access on Cambridge Core at doi.org/10.1017/9781108614306. derek b. scott is Professor of Critical Musicology at the University of Leeds. -

PROGRAM NOTES Ludwig Van Beethoven Overture to Fidelio
PROGRAM NOTES by Phillip Huscher Ludwig van Beethoven Born December 16, 1770, Bonn, Germany. Died March 26, 1827, Vienna, Austria. Overture to Fidelio Beethoven began to compose Fidelio in 1804, and he completed the score the following year. The first performance was given on November 20, 1805, at the Theater an der Wien in Vienna. Beethoven revised the score in preparation for a revival that opened there on March 29, 1806. For a new production in 1814, he made substantial revisions and wrote the overture performed at these concerts. The overture wasn’t ready in time for the premiere on May 23, 1814, in Vienna’s Kärntnertor Theater, but it was played at the second performance. The overture calls for an orchestra consisting of two flutes, two oboes, two clarinets, two bassoons, four horns, two trumpets, two trombones, timpani, and strings. Performance time is approximately six minutes. The Chicago Symphony Orchestra’s first subscription concert performances of Beethoven’s Overture to Fidelio were given at the Auditorium Theatre on December 14 and 15, 1894, with Theodore Thomas conducting. Our most recent subscription concert performances of the overture (and the complete opera) were given at Orchestra Hall on May 26, 28, and 31, 1998, with Daniel Barenboim conducting. The Orchestra first performed this overture at the Ravinia Festival on July 16, 1938, with Willem van Hoogstraten conducting, and most recently on July 30, 2008, with Sir Andrew Davis conducting. Nothing else in Beethoven’s career caused as much effort and heartbreak as the composition of his only opera, which took ten years, inspired four different overtures, and underwent two major revisions and a name change before convincing Beethoven that he was not a man of the theater. -

Nachlass Victor Léon
Nachlass Victor Léon Wienbibliothek im Rathaus Handschriftensammlung ZPH 906, ZPH 924, ZPH 925 Bestandssystematik Wienbibliothek im Rathaus / Handschriftensammlung - Nachlass Victor Léon / ZPH 906, ZPH 924, ZPH 925 Biographische Informationen Léon, Victor (eigentlich: Hirschfeld, Victor Leon): 4. 1. 1856 (laut Österreich Lexikon) - 23. 2. 1940 Wien; Dramatiker, Regisseur, Dramaturg. Provenienz des Bestands Der Nachlass Victor Léon wurde von der Wienbibliothek im Rathaus in den Jahren 1995 (ZPH 906, ZPH 924) und 1996 (ZPH 925) von einem Antiquariat gekauft. Wenn nicht anders angegeben, stammen die in der Systematik verzeichneten Stücke aus ZPH 906. Umfang 47 Archivboxen, 1 Foliobox. Der Bestand ist unter ZPH 906 aufgestellt. 2 Wienbibliothek im Rathaus / Handschriftensammlung - Nachlass Victor Léon / ZPH 906, ZPH 924, ZPH 925 Abkürzungsverzeichnis Anm. Anmerkung Beil. Beilage Bl. Blatt Br. Brief eh. eigenhändig Einf. Einfügungen Ex. Exemplar(e) hs. handschriftlich Korr. Korrektur Kt. Karte Ms. Manuskript o.D. ohne Datum o.T. ohne Titel (x x) Streichung ZPH Zuwachsprotokoll Handschriftensammlung 3 Wienbibliothek im Rathaus / Handschriftensammlung - Nachlass Victor Léon / ZPH 906, ZPH 924, ZPH 925 Archivbox 1 1 Werke 1.1 Bühnenmanuskripte 1.1.1 Die Königin von Arragon 1.1.2 Blinde Liebe. Oper in 1 Akt 1.1.3 Firilette. Vaudeville in 3 Akten (Zensurmanuskript) 1.1.4 Das Fürstenkind. Operette in 1 Vorspiel und 2 Akten. Teilweise nach einer Erzählung von Edmond About. Musik von Franz Lehár. (Soufflierbuch) 1.1.5 Der Cognac-König. Operette in 3 Akten. Nach einer Idee Bayards von Victor Léon und Ludwig Held. Musik von Franz Wagner 1.1.6 Wiener Lieb und Wiener Treu (in 2 Bildern) 1.1.7 Die Doppelhochzeit. -

„Wien Prägt Mich Bis Heute“
DAS MAGAZIN 2016 GESCHICHTSTRÄCHTIG Wissenswertes rund um den ÖMTP PREISVERDÄCHTIG Nominierte und Preisträger im Überblick „Wien prägt mich Der Lebenswerkpreis 2016 bis heute“ geht an Zubin Mehta In Kooperation mit Tiroler Festspiele Erl Sommer . bis . Juli Rossini: Guglielmo Tell - Wagner: Der Ring des Nibelungen - Mozart: Die Zauberlöte - Konzerte, Kammermusik und mehr IJasminka WANT Stančul I Davide Cabassi I Julia Malischnig I Franui YOU I Alma I Signum Quartett I u.vm. * I wui Di! (Gustav Kuhn) Publikums-Rekrutierung bei den Tiroler Festspielen Erl Tickets unter + - - www.tiroler-festspiele.at Mit den Zügen der ÖBB pünktlich und staufrei direkt bis nach Kufstein reisen. Anschließender Taxi Transfer zum Festspielzentrum. Weitere Infos unter www.kultur-tirol.at Tiroler Festspiele Erl Informationen zu Unterkünften und Angeboten: www.tiroler-festspiele.at + oder www.kultur-tirol.at Editorial Tiroler Festspiele Erl Sommer . bis . Juli Wenn es den „Österreichischen Musiktheaterpreis“ noch nicht gäbe ... Rossini: Guglielmo Tell - Wagner: Der Ring des Nibelungen - Mozart: Die Zauberlöte - Konzerte, Kammermusik und mehr … man müßte ihn glatt erfinden! Davon sind wir – spätestens nach der Arbeit an diesem Heft – zutiefst überzeugt. Im vierten Jahr seines Bestehens wird die wachsende Erfolgsgeschichte des ÖMTP zum ersten Mal dokumentiert – als Magazin mit allen Nominierten und Preisträgern. Im Ergebnis ist eine beeindruckende Demonstration der reichhaltigen Musiktheaterlandschaft Österreichs ent- standen – und ein Beweis, daß die zunächst unkonventionelle Idee von Karl Michael Ebner Foto Alexander Kohler voll ins Schwarze getroffen und das Durchhaltevermögen der Macher sich gelohnt hat. Wir haben in den vergangenen Wochen mit vielen Theaterschaffenden und Künstlern in ganz Österreich gesprochen und von Innsbruck bis Klagenfurt ausnahmslos engagierte, begeisterte Menschen kennengelernt. -

Die VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN Präsentieren
Die VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN präsentieren ÖSTERREICHISCHE ERSTAUFFÜHRUNG 27. Jänner 2017 Ronacher DON CAMILLO & PEPPONE ALS MUSICAL IM WIENER RONACHER! Die Vereinigten Bühnen Wien bringen Anfang 2017 die österreichische Erstaufführung auf die Bühne. Wien, 17. November 2016: Die Vereinigten Bühnen Wien präsentieren das Musical DON CAMILLO & PEPPONE, bekannt durch die legendären Verfilmungen, basierend auf den Romanen „Il Mondo Piccolo“ von Giovanni Guareschi, nun endlich als Musical in Wien. Die VBW entwickelten die Weltpremiere der Bühnenfassung dieses Klassikers in Koproduktion mit dem Theater St. Gallen und zeigen das Stück ab 27. Jänner 2017 im Ronacher erstmals auch in Österreich (UA am 30. April 2016 in der Schweiz). VBW-Musical Intendant Christian Struppeck stellte heute im Rahmen einer Pressekonferenz Team, Produktion und Hauptdarsteller vor. Poetisch, rührend, klug – ein Wiedersehen mit liebgewonnenen Charakteren DON CAMILLO & PEPPONE erzählt liebevoll die Geschichten um den streitbaren katholischen Pfarrer Don Camillo und seinen nicht minder schlagkräftigen Kontrahenten Peppone als heiteres, unbeschwertes Musical. Es verspricht ein Wiedersehen mit charmanten, liebgewonnenen Charakteren. Eine fröhliche Geschichte über das ländliche Italien der 50er Jahre, gesellschaftliche Aufbruchsstimmung, menschliches Miteinander, Toleranz und die Kraft der Versöhnung. Ein Klassiker umgesetzt durch internationale Kreative Michael Kunze, erfolgreichster deutschsprachiger Musicalautor, Buchautor, Liedtexter und Übersetzer, dessen Werke mit 79 Goldenen und Platin-Schallplatten ausgezeichnet wurden, schrieb das Buch und die Liedtexte zum Musical. Zusammen mit einem der prominentesten italienischen Komponisten Dario Farina – vielen bekannt durch seine Kult-Pop-Songs wie „Felicità“ oder durch seine viel beachteten Filmmusiken („Rossini“) – ist ein unterhaltsames, kurzweiliges Stück Musiktheater entstanden, in das der Komponist südländische Leichtigkeit und Romantik einfließen ließ. Musical Supervision und Orchestration steuert VBW-Musikdirektor Koen Schoots bei. -

Così Fan Tutte Cast Biography
Così fan tutte Cast Biography (Cahir, Ireland) Jennifer Davis is an alumna of the Jette Parker Young Artist Programme and has appeared at the Royal Opera, Covent Garden as Adina in L’Elisir d’Amore; Erste Dame in Die Zauberflöte; Ifigenia in Oreste; Arbate in Mitridate, re di Ponto; and Ines in Il Trovatore, among other roles. Following her sensational 2018 role debut as Elsa von Brabant in a new production of Lohengrin conducted by Andris Nelsons at the Royal Opera House, Davis has been propelled to international attention, winning praise for her gleaming, silvery tone, and dramatic characterisation of remarkable immediacy. (Sacramento, California) American Mezzo-soprano Irene Roberts continues to enjoy international acclaim as a singer of exceptional versatility and vocal suppleness. Following her “stunning and dramatically compelling” (SF Classical Voice) performances as Carmen at the San Francisco Opera in June, Roberts begins the 2016/2017 season in San Francisco as Bao Chai in the world premiere of Bright Sheng’s Dream of the Red Chamber. Currently in her second season with the Deutsche Oper Berlin, her upcoming assignments include four role debuts, beginning in November with her debut as Urbain in David Alden’s new production of Les Huguenots led by Michele Mariotti. She performs in her first Ring cycle in 2017 singing Waltraute in Die Walküre and the Second Norn in Götterdämmerung under the baton of Music Director Donald Runnicles, who also conducts her role debut as Hänsel in Hänsel und Gretel. Additional roles for Roberts this season include Rosina in Il barbiere di Siviglia, Fenena in Nabucco, Siebel in Faust, and the title role of Carmen at Deutsche Oper Berlin. -

Operetta After the Habsburg Empire by Ulrike Petersen a Dissertation
Operetta after the Habsburg Empire by Ulrike Petersen A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge: Professor Richard Taruskin, Chair Professor Mary Ann Smart Professor Elaine Tennant Spring 2013 © 2013 Ulrike Petersen All Rights Reserved Abstract Operetta after the Habsburg Empire by Ulrike Petersen Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Richard Taruskin, Chair This thesis discusses the political, social, and cultural impact of operetta in Vienna after the collapse of the Habsburg Empire. As an alternative to the prevailing literature, which has approached this form of musical theater mostly through broad surveys and detailed studies of a handful of well‐known masterpieces, my dissertation presents a montage of loosely connected, previously unconsidered case studies. Each chapter examines one or two highly significant, but radically unfamiliar, moments in the history of operetta during Austria’s five successive political eras in the first half of the twentieth century. Exploring operetta’s importance for the image of Vienna, these vignettes aim to supply new glimpses not only of a seemingly obsolete art form but also of the urban and cultural life of which it was a part. My stories evolve around the following works: Der Millionenonkel (1913), Austria’s first feature‐length motion picture, a collage of the most successful stage roles of a celebrated -

Biographic Details Regarding the Operetta the Land of Smiles by Franz Lehár
BIOGRAPHIC DETAILS REGARDING THE OPERETTA THE LAND OF SMILES BY FRANZ LEHÁR Katja Claudia Nadler Abstract This essay on biographic details regarding the operetta The Land of Smiles by Franz Lehár is entirely dedicated to facts found in literature and repositories of performance organisers. It does not aim at discussing importance or consequences this operetta might have on current musical life neither in central Europe nor in Asia. Being aware of this, here are only details mentioned that are helpful for further studies and do not mislead into speculation. Also, this essay is just a first access to the materials from the viewpoint of recent experiences with operettas. Keywords: operetta, exoticism, Franz Lehár, Vienna Franz Lehár was born on 30th April, 1870 in Komárno, a town then belonging to Hungary. His father was Franz Lehár (senior) the military capellmeister from Habsburg; province of Moravian Silesia. His mother was Christine Lehár of Hungarian origin (Linke, 2001: 7). Due to the father’s profession, Lehár frequently moved from place to place in his early childhood. Hence, in 1871 the Lehárs were ordered to Bratislava, 1875 to Sopron, 1877 to Cluj and in 1879 to Carlsberg. The family became larger from one station to the next. Three of Lehár’s siblings died shortly after birth, whereas Maria Anna was only 11 years old when she passed away. A long life was only granted to Lehár and his 1876 born brother Anton and to his 1890 born sister Emilie Christine (ibid: 13). In Lehár’s parents’ house music played a crucial role. For the parents, it was obvious that one day their eldest son would overtake the father’s profession (ibid: 14). -

Diplomarbeit
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit Die „Sissi“-Trilogie von Ernst Marischka Verfasserin Saskia Lugmayr angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 10. April 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuer: Ao. Prof. Dr. Walter Krause Danksagung Ein großer Dank geht an die Institutionen, die mir Informationen, Unterlagen und Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben: Pfarramt Wieden, Pfarramt Chur, Handelsgericht Wien, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Filmmuseum Wien, Film Archiv Austria, Hofmobiliendepot Möbel Museum Wien und Sisi Museum Wien. Besonders dankbar bin ich meinem Betreuer Ao. Prof. Dr. Walter Krause. Meiner Familie danke ich für den moralischen und finanziellen Beistand. Bei meinen Freunden bedanke ich mich für die Motivation, die maßgeblich zur Realisierung dieser Diplomarbeit beigetragen hat. Vielen Dank. II Inhaltsverzeichnis Danksagung ....................................................................................................................... II Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................. III Vorwort ............................................................................................................................. VI 1 Leben und Werk von Ernst Marischka ..................................................................... 1 2 Ernst Marischkas Stil innerhalb der „Sissi“-Trilogie .............................................. 5 2.1 -
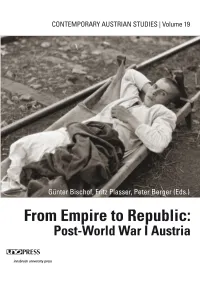
Post-World War I Austria
From Empire to Republic: Post-World War I Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) Peter Berger, Guest Editor CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 19 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. Printed in Germany. Cover photo: A severely wounded soldier from the battle on the Isonzo front awaits transport to the hospital on 23 August 1917. (Photo courtesy of Picture Archives of the Austrian National Library) Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010257 ISBN: 9783902719768 ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌLJƵƐƚƌŝĂŶ^ƚƵĚŝĞƐ ^ƉŽŶƐŽƌĞĚďLJƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚLJŽĨEĞǁKƌůĞĂŶƐ ĂŶĚhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ/ŶŶƐďƌƵĐŬ Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Bill Lavender Lindsay Maples Alexander Smith University of University of UNO/Universität New Orleans New Orleans Innsbruck Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität Wien Universität Innsbruck John Boyer Peter Pulzer University of Chicago Oxford University Gary Cohen (ex officio) Oliver Rathkolb Center for Austrian Studies Universität Wien University of Minnesota Sieglinde Rosenberger Christine Day Universität Wien University of New Orleans Alan Scott Oscar Gabriel Universität