Die Offiziumskompositionen Von Alessandro Scarlatti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Handel's Sacred Music
The Cambridge Companion to HANDEL Edited byD oNAtD BURROWS Professor of Music, The Open University, Milton Keynes CATvTNnIDGE UNTVERSITY PRESS 165 Ha; strings, a 1708 fbr 1l Handel's sacred music extended written to Graydon Beeks quake on sary of th; The m< Jesus rath Handel was involved in the composition of sacred music throughout his strings. Tl career, although it was rarely the focal point of his activities. Only during compositi the brief period in 1702-3 when he was organist for the Cathedral in Cardinal ( Halle did he hold a church job which required regular weekly duties and, one of FIi since the cathedral congregation was Calvinist, these duties did not Several m include composing much (if any) concerted music. Virtually all of his Esther (H\ sacred music was written for specific events and liturgies, and the choice moYemenr of Handel to compose these works was dictated by his connections with The Ror specific patrons. Handel's sacred music falls into groups of works which of Vespers were written for similar forces and occasions, and will be discussed in followed b terms of those groups in this chapter. or feast, ar During his period of study with Zachow in Halle Handel must have followed b written some music for services at the Marktkirche or the Cathedral, but porarl, Ro no examples survive.l His earliest extant work is the F major setting of chanted, br Psalm 113, Laudate pueri (H\41/ 236),2 for solo soprano and strings. The tradition o autograph is on a type of paper that was available in Hamburg, and he up-to-date may have -

Evirati Cantori E Mondo Nobiliare: Un Contributo Allo Studio Delle Dinamiche Sociali Dell'italia Barocca
Alessandro Cont EVIRATI CANTORI E MONDO NOBILIARE: UN CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLE DINAMICHE SOCIALI DELL’ITALIA BAROCCA Abstract - In the late 17th century, the Castrati are a familiar presence for the aristocrats of the Italian Peninsula, who usually enjoy their singing and in various circumstances exercise the functions of playwrights and organizers of musical events. However, the ability as singers and the ‘self-promotional’ talent can raise the status of some «musici» and introduce then into the same noble class, although the social ascent is not entirely undisputed and free of any risk for a Castrato of the Baroque period. Key words - Castrati; Nobility; Italy; Baroque Age. Riassunto - Nel tardo XVII secolo, i castrati sono una presenza familiare per gli aristo- cratici della Penisola italiana, che abitualmente fruiscono il loro canto e in varie circostanze esercitano le funzioni di drammaturghi e di organizzatori di eventi musicali. Tuttavia, l’abilità canora e il talento ‘autopromozionale’ possono elevare lo status di alcuni «musici» e introdurli nello stesso ceto nobiliare, sebbene l’ascesa sociale non sia del tutto incontrastata ed esente da rischi per un castrato del periodo barocco. Parole chiave - Castrati; Nobiltà; Italia; Età barocca. Ringrazio sentitamente Paologiovanni Maione, Anna Manfron, Isabel M. Rodríguez- Marco, Diana Tura e Vera Laura Verona per la generosa assistenza prestata alla mia ricerca. Abbreviazioni: AP = Archivio Pepoli; ASB = Archivio di Stato di Bologna; ASE = Archivio Segreto Estense; ASF = Archivio di Stato di Firenze; AG = Archivio Gonzaga; AMP = Archivio Mediceo del Principato; I-Bc = Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna; ASMn = Archivio di Stato di Mantova; ASMo = Archivio di Stato di Modena; ASP = Archivio di Stato di Parma; CFBE = Carteggio farnesiano e borbonico estero; DBI = Dizionario Biografi co degli Italiani. -

Scholarly Program Notes of Selected Trumpet Repertoire Jeanne Millikin Jeanne Millikin, [email protected]
Southern Illinois University Carbondale OpenSIUC Research Papers Graduate School 2011 Scholarly Program Notes of Selected Trumpet Repertoire Jeanne Millikin Jeanne Millikin, [email protected] Follow this and additional works at: http://opensiuc.lib.siu.edu/gs_rp Recommended Citation Millikin, Jeanne, "Scholarly Program Notes of Selected Trumpet Repertoire" (2011). Research Papers. Paper 157. http://opensiuc.lib.siu.edu/gs_rp/157 This Article is brought to you for free and open access by the Graduate School at OpenSIUC. It has been accepted for inclusion in Research Papers by an authorized administrator of OpenSIUC. For more information, please contact [email protected]. SCHOLARLY PROGRAM NOTES OF SELECTED TRUMPET REPERTOIRE BY Jeanne Millikin B.M., Southern Illinois University Carbondale, 2008 Research Submitted in Partial Fulfillment for MASTER OF MUSIC Department of Music in the Graduate School Southern Illinois University Carbondale August 2011 RESEARCH PAPER APPROVAL SCHOLARLY PROGRAM NOTES ON SELECTED TRUMPET REPERTOIRE By Jeanne Millikin A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Masters of Music in the field of Music Performance Approved by: Dr. Robert Allison, Chair Mr. Edward Benyas Dr. Richard Kelley Graduate School Southern Illinois University Carbondale July 11, 2011 AN ABSTRACT OF THE RESEARCH PAPER OF JEANNE MILLIKIN, for the Master of Music degree in TRUMPET PERFORMANCE, presented on APRIL 7, 2011, at Southern Illinois University Carbondale. TITLE: SCHOLARLY PROGRAM NOTES FOR SELECTED TRUMPET REPERTOIRE MAJOR PROFESSOR: Dr. Robert Allison The purpose of this research paper is to provide insight and research to five selected compositions in which the trumpet plays a soloistic or significant role. -

Musicaperlasalute2014 Musica Musicasalute Musica Musica Musica
Concerti da chiesa ni fasti del barocco romano, e si scioglie infi ne in rosa seconda aria, mentre per certo di Perti è il Ritorno a Roma. Pochi mottetti per voce sola una struggente Pastorale; per maggior stupore, lì festoso Alleluia. Una storia amichevole e avvin- raggiungono la complessità strutturale, la pretesa Bologna 17 dicembre 2014 e mottetti virtuosistici si uniscono la grandiosa concezione musicale e il cente per uno tra i più spumeggianti mottetti di virtuosistica e la levatura artistica di Sæviat tellus Convegno Concerto canto dei pastori al presepe. scuola bolognese. inter rigores: il giovane GEORG FRIEDRICH HÄN- lo compose nel 1707 per la festa della Madon- Oratorio Santa Maria della Vita Cappella Farnese, Palazzo d’Accursio Due raffi nati generi musicali sacri del Sei-Set- Ugualmente cullante è l’avvio del mottetto Allievo di Perti e maestro di Zavateri, anche DEL na del Carmine. La prima aria esorta alla fortezza tecento formano il programma qui presentato, at- Nulla in mundo pax sincera di ANTONIO VIVALDI, GIUSEPPE TORELLI ricevette la pubblicazione po- d’animo l’ordine religioso carmelitano, protetto traverso sei (anzi: sette) compositori tra i massimi partitura all’incirca coeva (e tornata di recente stuma, nel 1709, dei suoi dodici Concerti grossi: la dalla Beata Vergine come lo era stata Roma tutta dell’epoca. Qualche parola sui due generi musi- alla ribalta per la sua inclusione nella colonna loro struttura è, per la verità, più prossima a quel- nel terremoto del 1703: il soprano balza al Re so- cali. Il concerto da chiesa differisce da quello da sonora del fi lm Shine). -

Breathtaking-Program-Notes
PROGRAM NOTES In the 16th and 17th centuries, the cornetto was fabled for its remarkable ability to imitate the human voice. This concert is a celebration of the affinity of the cornetto and the human voice—an exploration of how they combine, converse, and complement each other, whether responding in the manner of a dialogue, or entwining as two equal partners in a musical texture. The cornetto’s bright timbre, its agility, expressive range, dynamic flexibility, and its affinity for crisp articulation seem to mimic a player speaking through his instrument. Our program, which puts voice and cornetto center stage, is called “breathtaking” because both of them make music with the breath, and because we hope the uncanny imitation will take the listener’s breath away. The Bolognese organist Maurizio Cazzati was an important, though controversial and sometimes polemical, figure in the musical life of his city. When he was appointed to the post of maestro di cappella at the basilica of San Petronio in the 1650s, he undertook a sweeping and brutal reform of the chapel, firing en masse all of the cornettists and trombonists, many of whom had given thirty or forty years of faithful service, and replacing them with violinists and cellists. He was able, however, to attract excellent singers as well as string players to the basilica. His Regina coeli, from a collection of Marian antiphons published in 1667, alternates arioso-like sections with expressive accompanied recitatives, and demonstrates a virtuosity of vocal writing that is nearly instrumental in character. We could almost say that the imitation of the voice by the cornetto and the violin alternates with an imitation of instruments by the voice. -

Download Booklet
Orchestra of the Age of Enlightenment Monteverdi Vespers oae released and really cemented my path on the road towards Monteverdi often sets the text in that way. I took ‘early music’. Ever since then I have wanted to the decision therefore to blend low tenors with direct performances of it and play it as many times high baritones, low baritones with basses, high as possible. It is a work of such beauty and depth tenors with countertenors etc to create more of that such a wide variety of interpretations can be the sound of a choir that can sing both high and Claudio Monteverdi made of it. I would like to explain briefly some of low within its partbooks. Vespers of the Blessed Virgin, 1610 the choices that I made in preparing for this: When we performed this as a concert, Monteverdi’s publication appears as part- I added in liturgical plainchant as I strongly ROBERT HOWARTH Director books and not as a full score. Many editors believe that Monteverdi never conceived these have undertaken the task of putting together as concert pieces but only ever to be heard in the a performing edition and I’m sure they will all church as part of a service, therefore the Psalms acknowledge that none of them are perfect. What would have been preceded by antiphons relevant lies within these books are dark mysterious codes to the day. These do affect the Psalm and the about how to interpret the music. Once an editor context in which they are heard. As we are now has made decisions on your behalf, it is difficult removing ourselves by one step and presenting not to do their version. -

"Lucca Città Della Musica" Di Sara Matteucci
SARA MATTEUCCI Lions Club Lucca Host CLuccaITTÀ DELLA MUSICA Questo volume è un’espressione del progetto “Lucca città della musica” che il Lions Club Lucca Host sta portando avanti negli ultimi anni al fine di far entrare Lucca fra le città UNESCO creative della musica. Il Comitato Cultura del Lions Club Lucca Host, presieduto da Leonardo Odoguardi e com- posto da Riccardo Benvenuti, Michele Bianchi, Francesco Cipriano, Giuliano Marchetti, Cristiano Meossi, Enrico Ragghianti, Antonio Sargenti, è stato supportato dai presidenti del Club Umberto Stefani, Adalberto Saviozzi, Maria Carla Giambastiani e dai soci Cesare Rocchi, Gualberto Del Roso. Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa pubblicazione ed in particolare l’autrice del lavoro Sara Matteucci e Manifatture Sigaro Toscano. SARA MATTEUCCI CLuccaITTÀ DELLA MUSICA Lions Club Lucca Host Si ringrazia per il contributo CLuccaITTÀ DELLA MUSICA Referenze fotografiche Foto Ghilardi, Lucca; Foto Arnaldo Fazzi, Archivio Maria Pacini Fazzi Editore © Copyright 2010: Lions Club Lucca Host Cura grafica e impaginazione Gabriele Moriconi per Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca www.pacinifazzi.it ISBN 978-88-6550-026-2 Lions Club Lucca Host Negli Scopi del lionismo è previsto di «prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e mo- rale della comunità», mentre nel Codice dell’etica lionistica si chiede di «dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servizio». Questo desiderio di incidere positiva- mente nel tessuto cittadino è stato ed è una vocazione congenita al Lions Club Lucca Host. Dalla sua istituzione nel 1955, esso si è impegnato per la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico di una città dalla lunga storia. -

The Italian Double Concerto: a Study of the Italian Double Concerto for Trumpet at the Basilica of San Petronio in Bologna, Italy
The Italian Double Concerto: A study of the Italian Double Concerto for Trumpet at the Basilica of San Petronio in Bologna, Italy a document submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts Performance Studies Division – The University of Cincinnati College-Conservatory of Music 2013 by Jason A. Orsen M.M., Kent State University, 2003 B.M., S.U.N.Y Fredonia, 2001 Committee Chair: Dr. Vivian Montgomery Prof. Alan Siebert Dr. Mark Ostoich © 2013 Jason A. Orsen All Rights Reserved 2 Table of Contents Chapter I. Introduction: The Italian Double Concerto………………………………………5 II. The Basilica of San Petronio……………………………………………………11 III. Maestri di Cappella at San Petronio…………………………………………….18 IV. Composers and musicians at San Petronio……………………………………...29 V. Italian Double Concerto…………………………………………………………34 VI. Performance practice issues……………………………………………………..37 Bibliography……………………………………………………………………………………..48 3 Outline I. Introduction: The Italian Double Concerto A. Background of Bologna, Italy B. Italian Baroque II. The Basilica of San Petronio A. Background information on the church B. Explanation of physical dimensions, interior and effect it had on a composer’s style III. Maestri di Cappella at San Petronio A. Maurizio Cazzati B. Giovanni Paolo Colonna C. Giacomo Antonio Perti IV. Composers and musicians at San Petronio A. Giuseppe Torelli B. Petronio Franceschini C. Francesco Onofrio Manfredini V. Italian Double Concerto A. Description of style and use B. Harmonic and compositional tendencies C. Compare and contrast with other double concerti D. Progression and development VI. Performance practice issues A. Ornamentation B. Orchestration 4 I. -

La Grande-Duchesse De Gérolstein De Grande-Duchesse La Offenbach Jacques Jacques Offenbach La Grande-Duchesse De Gérolstein TITOLO
1 FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA XXIII STAGIONE LIRICA DI PADOVA Jacques Offenbach La Grande-Duchesse de Gérolstein Jacques Offenbach La Grande-Duchesse de Gérolstein TITOLO COMUNE DI PADOVA Assessorato alla Cultura FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA REGIONE DEL VENETO La Grande-Duchesse de Gérolstein 1 TITOLO La Grande-Duchesse de Gérolstein Opéra-Bouffe in tre atti Henri Meilhac e Ludovic Halévy musica di Jaques Offenbach Padova - Teatro Verdi venerdì 10 settembre 2004 ore 20.45 turno A domenica 12 settembre 2004 ore 16.00 turno B martedì 14 settembre 2004 ore 20.45 turno C 3 AUTORE Jacques Offenbach in una caricatura di Et. Carjat (Milano, Civica Raccolta Bertarelli). 4 TITOLO Sommario 7 La locandina 11 Il libretto 83 La Grande-Duchesse de Gérolstein in breve 85 Argomento 89 Andrea Merli Ah! Qui j’aime les militaires 97 Giuseppe Pugliese Omaggio a Lucia Valentini Terrani 99 Biografie a cura di Cecilia Palandri 5 Hortense Schneider, la grande interprete di Offenbach nel costume de La Granduchessa di Gérolstein. 6 La locandina Omaggio a Lucia Valentini Terrani La Grande-Duchesse de Gérolstein Opéra-Bouffe in tre atti libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy musica di Jacques Offenbach Edizione critica OEK, versione Parigi Edizioni Bote & Bock, Berlino Rappresentante per l’Italia Casa Ricordi Milano prima rappresentazione italiana della edizione critica definitiva personaggi e interpreti La Grande-Duchesse Elena Zilio Wanda Patrizia Cigna Fritz Massimiliano Tonsini Il barone Puck Thomas Morris Il principe Paul Enrico Paro -
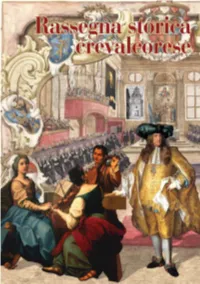
Rassegna Storica Crevalcorese È Stata Realizzata Con Il Contributo Di: 2 3
3 2 1 Rassegna storica crevalcorese è stata realizzata con il contributo di: 2 3 Comune di Crevalcore Rassegna storica crevalcorese 4 dicembre 2006 Giacomo Antonio Perti numero monografico k Istituzione dei Servizi Culturali Paolo Borsellino 4 Rassegna storica crevalcorese Rivista dell’Istituzione dei Servizi Culturali Paolo Borsellino di Crevalcore COMITATO DI REDAZIONE Magda Abbati, Massimo Balboni, Gabriele Boiani, Paolo Cassoli, Nicoletta Ferriani, Barbara Mattioli, Yuri Pozzetti, Carla Righi, Roberto Tommasini. Direttore resp. Paolo Cassoli Progetto Grafico Paolo Cassoli Informazioni e comunicazioni Istituzione dei Servizi Culturali Paolo Borsellino Via Persicetana 226 - 40014 Crevalcore (Bo); tel. 051.981594, fax 051.6803580 e mail: [email protected] Quarto numero, distribuzione gratuita 5 SOMMARIO In questo numero (a cura della redazione) 7 STUDI E RICERCHE Marc Vanscheeuwijck Giacomo Antonio Perti (Bologna, 1661-1756) “oriundo di Crevalcore” 11 Francesco Lora Mottetti grossi di Perti per le chiese di Bologna 27 Michele Vannelli La Messa à 12 (1687) di Giacomo Antonio Perti: alcune considerazioni all’indomani della prima ripresa moderna 59 Piero Mioli PERMARMO. Perti, Martini e Mozart celebrati nel 2006 dall’Accademia Filarmonica di Bologna. 79 Rodolfo Zitellini Le opere a stampa di Giacomo Antonio Perti: l’opera seconda 87 Elisabetta Pasquini Un Esemplare di contrappunto per due autori 95 6 7 In questo numero Per concludere degnamente le celebrazioni pertiane la redazione ha deciso di dedicare per intero il quarto numero della rivista al musicista “oriundo di Crevalcore”, come scriveva Padre Martini nella biografia del proprio maestro. Ne è risultato un numero monografico di alto profilo che, crediamo, sarà consi- derato, nel campo degli studi su Giacomo Antonio Perti, come una delle opere di riferimento, anche perché i saggi qui contenuti sono tutti opera di valenti studiosi, specialisti della musica barocca. -

AMS/SMT Indianapolis 2010: Abstracts
AMS_2010_full.pdf 1 9/11/2010 5:08:41 PM ASHGATE New Music Titles from Ashgate Publishing… Adrian Willaert and the Theory Music, Sound, and Silence of Interval Affect in Buffy the Vampire Slayer The Musica nova Madrigals and the Edited by Paul Attinello, Janet K. Halfyard Novel Theories of Zarlino and Vicentino and Vanessa Knights Timothy R. McKinney Ashgate Popular and Folk Music Series Includes 69 music examples Includes 20 b&w illustrations Aug 2010. 336 pgs. Hbk. 978-0-7546-6509-0 Feb 2010. 304 pgs. Pbk. 978-0-7546-6042-2 Changing the System: The Musical Ear: The Music of Christian Wolff Oral Tradition in the USA Edited by Stephen Chase and Philip Thomas Anne Dhu McLucas Includes 1 b&w illustration and 49 musical examples SEMPRE Studies in The Psychology of Music Aug 2010. 284 pgs. Hbk. 978-0-7546-6680-6 Includes 1 b&w illustration, 2 music examples and a CD Mar 2010. 218 pgs. Hbk. 978-0-7546-6396-6 Shostakovich in Dialogue Form, Imagery and Ideas in Quartets 1–7 Music and the Modern Judith Kuhn Condition: Investigating Includes 32 b&w illustrations and 99 musical examples Feb 2010. 314 pgs. Hbk. 978-0-7546-6406-2 the Boundaries Ljubica Ilic Harrison Birtwistle: Oct 2010. 140 pgs. Hbk. 978-1-4094-0761-4 C The Mask of Orpheus New Perspectives M Jonathan Cross Landmarks in Music Since 1950 on Marc-Antoine Charpentier Includes 10 b&w illustrations and 12 music examples Edited by Shirley Thompson Y Dec 2009. 196 pgs. Hbk. 978-0-7546-5383-7 Includes 2 color and 20 b&w illustrations and 37 music examples Apr 2010. -

Romance in the Music of Obradors, Schubert, Gordon and Scarlatti by Kayla Gonzales B.F.A., New Mexico Highlands University
Romance in the music of Obradors, Schubert, Gordon and Scarlatti by Kayla Gonzales B.F.A., New Mexico Highlands University, 2016 A REPORT submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree MASTER OF MUSIC School of Music, Theatre, and Dance College of Arts and Sciences KANSAS STATE UNIVERSITY Manhattan, Kansas 2018 Approved by: Major Professor Dr. Amy Rosine-Underwood Copyright © Kayla Gonzales 2018. Abstract This report is extended program notes that focus on romantic selections from four composers, prepared for a graduate vocal recital, completed in partial fulfillment of the requirement for the Master of Music degree. The recital was held April 25, 2017 at seven-thirty in the evening at Kirmser Hall on the campus of Kansas State University. The selections for this recital were chosen for their portrayal of the theme romance. The four composers selected for this report are Fernando Obradors, Franz Schubert, Ricky Ian Gordon and Alessandro Scarlatti. Each chapter will include biographical information on each composer, a textual analysis, as well as stylistic and technical considerations one must consider for the songs researched in this document. Romance is a topic that has often inspired composers and writers. This paper focuses on “romance” as a topic, which has been the focus of music for centuries. In vocal literature, a theme of romance can create an immediate connection to the listener as it is a topic that all genders can relate to. Table of Contents List of Figures ................................................................................................................................