Tradition - Imagination - Legitimation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nachruf Prof. Dr. Eugen Ewig
322 Nachrufe Eugen Ewig 18.5.1913 – 1.3.2006 Im hohen Alter, im 93. Lebensjahr, starb Eugen Ewig am 1. März 2006, einer der international angesehensten Mediävisten; er war seit 1979 korrespondierendes Mit- glied der Bayerischen Akademie der Wis- senschaften. 1913 in Bonn geboren, besuchte er das humanistische Beethoven-Gymnasium und studierte in seiner Heimatstadt von 1931– 1937 Geschichte und zuletzt Romanistik, vornehmlich bei Wilhelm Levison und Ernst Robert Curtius. Mit Curtius hat bereits viel zu tun, was Ewigs späteres Wirken nachhaltig kennzeichnete: „Eine auf- keimende Neigung zu Frankreich hat er gefestigt, mein Frankreichbild hat er geprägt und durch die Schärfung des Blicks für Zusammenhänge mit der geistigen Tradition der Antike und der lateinischen Literatur vertieft“ (Ewig in seiner Erwiderung auf seine Wahl in die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften 1978; die Laudatio hielt Theodor Schief- fer: Jahrbuch 1978 der Akademie, S. 63). Von Levison, seinem jüdischen, 1935 aus dem Amt gedrängten Lehrer, erhielt Ewig als sein letzter Schüler noch sein Dissertationsthema, wurde von ihm auch betreut, doch für die Prüfungsformalien musste Anfang 1936 bereits der Neuhistoriker Max Braubach einspringen. Ewig hatte Levison stets die Treue gehalten und ihn auch bei seiner späten Ausreise nach England in mutiger, für ihn selbst gefährlicher Weise unterstützt. Das Dissertationsthema, das der Altmeister Levison Ewig anvertraute, handelte über einen Autor des 15. Jahrhunderts: „Die Anschauungen des Karthäusers Dionysius von Roermond über den christlichen Ordo in Staat und Kirche“, erschienen 1936. Aus gesundheitlichen Gründen vom Militär freigestellt, als liberaler Geist, als überzeugter Katholik und ohne jede Bindung an die NSDAP waren etwaige Gedanken an eine Hochschullaufbahn obsolet. -

Pariser Historische Studien Bd. 86 2007
Pariser Historische Studien Bd. 86 2007 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hi- nausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Eugen Ewig REINHOLD KAISER EUGENEWIG Vom Rheinland zum Abendland Eugen Ewig ist am 18. März 1913 in Bonn geboren und in Bonn am 1. März 2006 mit fast 93 Jahren gestorben. Er gehört zu jenen rheinischen und katholi schen Historikern, die durch ihr Wirken in Universität, Forschung, Politik und Öffentlichkeit die Frühmittelalterforschung in Deutschland nachhaltig be stimmt haben. Sein wissenschaftliches CEuvre ist in einem Zeitraum von 70 Jahren zwischen 1936 und 2006 entstanden '. Er zählt angesichts seines um- I Eine kurze Würdigung von Leben und Werk Eugen Ewigs findet sich im Geleitwort von Karl Ferdinand WERNER zu den beiden vom Deutschen Historischen Institut Paris publi zierten Sammelbänden von Hartmut ATSMA (Hg.), Eugen Ewig, Spätantikes und fränki• sches Gallien. Gesammelte Schriften (1952-1973), 2 Bde., Zürich, München 1976-1979 (Beihefte der Francia, 3/1-2), Bd. 1, S. IX-XII; knapp ist das Vorwort von Rudolf SCHIEFFER in: DERS. (Hg.), Beiträge zur Geschichte des Regnum Francorum. Referate beim Wissenschaftlichen Colloquium zum 75. Geburtstag von Eugen Ewig am 28. -

Bulletin Du Centre D'études Médiévales
Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA 22.1 | 2018 Varia Alsace and Burgundy : Spatial Patterns in the Early Middle Ages, c. 600-900 Karl Weber Electronic version URL: http://journals.openedition.org/cem/14838 DOI: 10.4000/cem.14838 ISSN: 1954-3093 Publisher Centre d'études médiévales Saint-Germain d'Auxerre Electronic reference Karl Weber, « Alsace and Burgundy : Spatial Patterns in the Early Middle Ages, c. 600-900 », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [Online], 22.1 | 2018, Online since 03 September 2018, connection on 19 April 2019. URL : http://journals.openedition.org/cem/14838 ; DOI : 10.4000/ cem.14838 This text was automatically generated on 19 April 2019. Les contenus du Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre (BUCEMA) sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Alsace and Burgundy : Spatial Patterns in the Early Middle Ages, c. 600-900 1 Alsace and Burgundy : Spatial Patterns in the Early Middle Ages, c. 600-900 Karl Weber EDITOR'S NOTE Cet article fait référence aux cartes 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 10 du dossier cartographique. Ces cartes sont réinsérées dans le corps du texte et les liens vers le dossier cartographique sont donnés en documents annexes. Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA, 22.1 | 2018 Alsace and Burgundy : Spatial Patterns in the Early Middle Ages, c. 600-900 2 1 The following overview concerns the question of whether forms of spatial organisation below the kingdom level are discernible in the areas corresponding to present-day Western Switzerland and Western France during the early Middle Ages. -

Chronik Des Akademischen Jahres 2005/2006
CHRONIK DES AKADEMISCHEN JAHRES 2005/2006 Chronik des Akademischen Jahres 2005/2006 herausgegeben vom Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn, Prof. Dr. Matthias Winiger, Bonn 2006. Redaktion: Jens Müller, Archiv der Universität Bonn Herstellung: Druckerei der Universität Bonn MATTHIAS WINIGER RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN Chronik des Akademischen Jahres 2005/06 Bonn 2006 Jahrgang 121 Neue Folge Jahrgang 110 INHALTSVERZEICHNIS Rede des Rektors zur Eröffnung des Akademischen Jahres Rückblick auf das Akademische Jahr 2005/06 .....S. 9 Preisverleihungen und Ehrungen Preisverleihungen und Ehrungen im Akademischen Jahr 2005/06 ...........................S. 23 Akademischer Festvortrag Wilhelm Barthlott, Biodiversität als Herausforderung und Chance.................................S. 25 Chronik des Akademischen Jahres Das Akademische Jahr 2005/06 in Pressemeldungen..............................................S. 40 Nachrufe ......................................................................S. 54 Berichte aus den Fakultäten Evangelisch-Theologische Fakultät ....................S. 67 Katholisch-Theologische Fakultät ......................S. 74 Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät S. 83 Medizinische Fakultät ............................................S. 103 Philosophische Fakultät .........................................S. 134 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät.......S. 170 Landwirtschaftliche Fakultät ..................................S. 206 Beitrag zur Universitätsgeschichte Thomas Becker, -

Das Gebiet Des Nördlichen Mittelrheins Als Teil Der Germania Prima in Spätrömischer Und Frühmittelalterlicher Zeit
Das Gebiet des nördlichen Mittelrheins als Teil der Germania prima in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit VON FRANZ-JOSEF HEYEN Mein Part in den Verhandlungen bestand darin, die Umrisse des Geschehens am nördli chen Mittelrhein in der Spätantike und im frühen Mittelalter zu schildern. Selbstver ständlich kann das auch zwischen dem vorangegangenen großen Überblick von Eu gen Ewig und den nachfolgenden, speziell einzelnen Orten gewidmeten Referaten nur ein weitestgehend auf der vorhandenen Literatur 0 aufbauendes grobes Raster sein, in dem lediglich in einigen Feldern Akzente oder Fragezeichen gesetzt oder auch neue An sätze zur Diskussion gestellt werden können. Schon die räumliche Umschreibung des Untersuchungsgebietes als »nördlicher Mit telrhein« ist umständlich, weil ein umfassender Landschaftsname fehlt. Aber offensicht lich ist dies schon eine, auch für die historische Betrachtung wichtige Beobachtung, macht sie doch deutlich, daß dem Raum einerseits ein beherrschendes, namengebendes Oberzentrum oder Landschaftsgefüge fehlt, er aber anderseits von den Nachbarräumen nicht abgedeckt, sondern ausgespart wird, sozusagen übrig bleibt. Zumindest bietet sich auf den ersten Blick dieses Bild, und auch bei der Durchmusterung der Literatur wird man bald feststellen, daß dieser Raum meist nur »am Rande« behandelt wurde. Wir werden die Frage präsent zu halten haben, ob dies eine Feststellung ist, die zur Charak terisierung des Raumes als historisches Gebilde geeignet ist und zwar kontinuierlich oder nur in bestimmten Epochen und welche Folgerungen dies für den Ablauf des hi storischen Geschehens haben müßte und hatte. Angesprochen ist das Rheintal mit den beidseits angrenzenden Gebieten zwischen Andernach/Sinzig im Norden und Oberwesel/Bingen im Süden bzw. zwischen den Mündungen von Ahr und Nahe, das unmittelbare Einzugsgebiet beider Flüsse jeweils ausgeschlossen. -
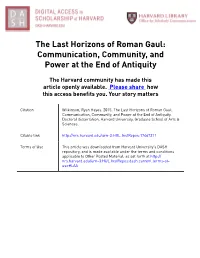
The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity
The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Wilkinson, Ryan Hayes. 2015. The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:17467211 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity A dissertation presented by Ryan Hayes Wilkinson to The Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2015 © 2015 Ryan Hayes Wilkinson All rights reserved. Dissertation Advisor: Professor Michael McCormick Ryan Hayes Wilkinson The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity Abstract In the fifth and sixth centuries CE, the Roman Empire fragmented, along with its network of political, cultural, and socio-economic connections. How did that network’s collapse reshape the social and mental horizons of communities in one part of the Roman world, now eastern France? Did new political frontiers between barbarian kingdoms redirect those communities’ external connections, and if so, how? To address these questions, this dissertation focuses on the cities of two Gallo-Roman tribal groups. -

Rezension Über: Heike Pöppelmann, Das Spätantik-Frühmittelalterliche Gräberfeld Von Jülich, Kr
Zitierhinweis Gottschalk, Raymund: Rezension über: Heike Pöppelmann, Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich, Kr. Düren, Bonn : Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univ, 2010, in: Jülicher Geschichtsblätter. Jahrbuch des Jülicher Geschichtsvereins, 85/86 (2017/2018), S. 376-394, https://www.recensio-regio.net/r/225136b04562479a952ea77d3eef2935 First published: Jülicher Geschichtsblätter. Jahrbuch des Jülicher Geschichtsvereins, 85/86 (2017/2018) copyright Dieser Beitrag kann vom Nutzer zu eigenen nicht-kommerziellen Zwecken heruntergeladen und/oder ausgedruckt werden. Darüber hinaus gehende Nutzungen sind ohne weitere Genehmigung der Rechteinhaber nur im Rahmen der gesetzlichen Schrankenbestimmungen (§§ 44a-63a UrhG) zulässig. Rezensionen Jülich über das aus Sicht der archäologischen Quellenbasis nun nicht mehr so dunkle 5. Jahrhundert hinaus erbringen konnten. In einer abschließenden Zusammenstel- lung des archäologischen und historischen Forschungsstandes bringt es die Autorin vereinfacht dargestellt auf den Punkt, dass die im Kastell Iuliacum mit zumindest für die umgebende Bördenlandschaft zentralörtlicher Funktion stationierten Soldaten, die bis 476 am Ende einer von Ravenna über die Föderatenkönige von Lyon und Köln laufenden Befehlskette standen, dieses als die »letzten Römer« im frühen 6. Jahr- hundert der fränkischen Merowingerherrschaft übergaben (S. 276–293). Nach Listen wie der zentralen der datierbaren Gräber des Kastellfriedhofs und einem imposanten Literaturverzeichnis (S. 294–346) schließt ein vorbildlicher kritischer Befund- und Fundkatalog (S. 347–422) mit 94 Fundtafeln dieses für die frühe Geschichte des spät fränkisch gewordenen Rheinlandes so wichtige Werk ab. Jörg Kleemann Heike Pöppelmann, Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich, Kr. Düren (= Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, Bd. 11), Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Institut für Vor- und Frühge- schichtliche Archäologie 2010. -

Francia – Forschungen Zur Westeuropäischen Geschichte
Francia – Forschungen zur westeuropäischen Geschichte Bd. 34/1 2007 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online- Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. f34/1 09 Nekrologe 17.08.2007 14:43 Uhr Seite 237 Nekrolog Eugen Ewig 237 Schriftenverzeichnis Eugen Ewig 1936 Die Anschauungen des Karthäusers Dionysius von Roermond über den christlichen Ordo in Staat und Kirche, Bonn 1936 [Dissertation]. 1939 Die Wahl des Kurfürsten Josef Clemens von Köln zum Fürstbischof von Lüttich, 1694, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 135 (1939), S. 41–79. 1943 Die Deutschordenskommende Saarburg, in: Elsaß-Lothringisches Jahrbuch 21 (1943), S. 81–126. 1947 L’avenir rhénan, in: Le Rhin. Nil de l’Occident, hg. von Jean Dumont, Paris 1947, S. 315–324. 1950 Landschaft und Stamm in der deutschen Geschichte, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 1 (1950), S. 154–168. 1952 Civitas, Gau und Territorium in den Trierischen Mosellanden, in: Rheinische Vier- teljahrsblätter 17 (1952; Festschrift Theodor Frings), S. 120–137 [ND in: Spätantikes und Fränkisches Gallien, Bd. 1, 1976, S. 504–522]. 1952 Erbe des Abendlandes. Lehrbuch der Geschichte für Höhere Schulen. Oberstufe, Teil 1: Urzeit und Altertum. Die Entstehung des Abendlandes, 2. -
Francia. Band 42
Yaniv Fox: Image of Kings Past. The Gibichung Legacy in Post-Conquest Burgundy, in: Francia 42 (2015), S. 1-26 . DOI: 10.11588/fr.2015.4.44567 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Yaniv Fox IMAGE OF KINGS PAST The Gibichung Legacy in Post-Conquest Burgundy In the fnal chapter of the Chronicle of Fredegar, we read of an incident involving a patrician named Willebad. This was a convoluted affair, which concluded – the best Merovingian stories usually do – with a dramatic bloodletting1. As the story goes, in 643 Floachad, the newly appointed mayor of Burgundy decided to orchestrate the downfall of Willebad. The chronicler, who, we gather, was somewhat hostile to the Burgundian patrician, reasoned that Willebad had become »very rich by seizing the properties of a great many people by one means or another. Seemingly overcome with pride because of his position of patrician and his huge possessions, he was puffed up against Floachad and tried to belittle him«2. The logic behind this enmity seems quite straightforward, and not very different in fact from any of the other episodes that fll the pages of the Chronicle of Fredegar. -

Francia – Forschungen Zur Westeuropäischen Geschichte Bd
Francia – Forschungen zur westeuropäischen Geschichte Bd. 34/1 2007 DOI: 10.11588/fr.2007.1.45038 Cop right !as !igita"isat wird #hnen $on perspecti$ia.net% der &n"ine' (u)"ikationsp"att+or, der -ti+tung !eutsche Geisteswissenscha+t"iche #nstitute i, .usland /!G#.0% zur 1er+2gung geste""t. Bitte )eachten -ie% dass das !igita"isat urhe)errecht"ich gesch2tzt ist. 3r"au)t ist a)er das 4esen% das .usdrucken des Te6tes% das 7erunter"aden% das -peichern der !aten au+ eine, eigenen !atenträger soweit die $orgenannten 7and"ungen aussch"ie8"ich zu pri$aten und nicht'*o,,erzie""en Zwecken er+o"gen. 3ine dar2)er hinausgehende uner"au)te 1erwendung% :eproduktion oder ;eiterga)e einze"ner #nha"te oder Bi"der *<nnen sowoh" zi$i"' a"s auch stra+recht"ich $er+o"gt werden. f34/1 09 Nekrologe 17.08.2007 14:43 Uhr Seite 228 228 Nekrolog Eugen Ewig Eugen Ewig – der Gründer Was damals, am 21. November 1958 geschah, die feierliche Eröffnung unter Leitung Eugen Ewigs des »Centre allemand de recherches historiques«, aus dem einmal das Deutsche Historische Institut in Paris werden sollte, in Gegenwart der Spitzen der französischen Historikerschaft und des Archivwesens, war keineswegs selbstverständlich. Gut vierzig Jahre nach dem Elysée-Vertrag von 1963 können wir uns kaum noch vorstellen, was es hieß, in den Fünfziger Jahren ein Deutscher in Frankreich zu sein. Die großen Vermittler, Joseph Rovan, Alfred Grosser waren die Ausnahme, nicht die Regel. Viele der maßgeblichen Leute hatten unter der deutschen Besatzung gelitten, waren deportiert worden, hatten in Konzen- trationslagern gesessen. -

Pariser Historische Studien Bd. 86 2007
Pariser Historische Studien Bd. 86 2007 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hi- nausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. ULRICH PFEIL EUGENEWIG »Creer un ordre transnational« Von einem Mittler zwischen Deutschland und Frankreich Eugen Ewig (1913-2006), ehemaliger Direktor und Vorsitzender des wissen schaftlichen Beirats des Deutschen Historischen Instituts Paris', gehört nach Meinung seines Schülers und heutigen Präsidenten der Monumenta Germaniae Historica (MGH), Rudolf Schieffer, im Bereich der frühmittelalterlichen Ge schichte zu denjenigen, die das »neue Bild entscheidend mitgestaltet [haben], das sich seit 1945 durchgesetzt hat und die gemeinsamen Wurzeln der euro päischen Völker in den Vordergrund treten läßt«l. Ewig wäre jedoch nicht der einzige, so zeigen neuere Forschungen zum Verhalten deutscher Historiker in der Nachkriegszeit2, der die europäische Zusammenarbeit nach 1945 neu ent deckte und auch zur Grundlage seines wissenschaftlichen Arbeitens machte. Nicht wenige hatten dabei im Konkurrenzkampf um neue Ressourcen eine kapitale Kehrtwendung vollzogen, nachdem sie sich in den vorangegangenen Jahren z.T. dem historiographischen Grenz- und Abwehrkampf verschrieben hatten3. So wird auch für Ewig neben dem prägenden soziokulturellen Kontext • Dieser Beitrag ist eine erweiterte Fassung von: Ulrich PFEIL, Eugen Ewig. -

(IA Bookplates00hardiala).Pdf
^^\^. ^^' THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES u r I Digitized by the Internet Archive in 2007 with funding from IVIicrosoft Corporation http://www.archive.org/details/bookplatesOOhardiala Book-Plates By Hardy, f.s.a. W. J. SECOND EDITION London Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd. MDCCCXCVH First Edition published 1893 as Vol. II. (f ' Books about Books.' College Library 995 H22,b 1897 Preface Having vindicated in my introductory chapter the practice of collecting book-plates from the charge of flagrant immorality, I do not think it necessary to spend many words in demonstrating that it is in every way a worthy and reasonable pursuit, and one which fully deserves to be made the subject of a special treatise in a series of Books about Books. If need were, the Editor of the series, who asked me to write this little hand-book, would perhaps kindly accept his share of responsibility, but in the face of the existence of a flourishing ' Ex Libris' Society, the importance of the book-plate as an object of collection may almost be taken as axiomatic. My own interest in this particular hobby is of long standing, and happily the appearance, when my manuscript was already at the printer's, of Mr. Egerton Castle's pleasantly written and profusely illustrated work on English Book-Plates has relieved me of the dreaded necessity of writing an additional chapter on those modern examples, in treating of ' vi Book-plates which neither my knowledge nor my enthusiasm would have equalled his. The desire to possess a book-plate of one's own is in itself commendable enough, for in fixing the first copy into the first book the owner may surely be assumed to have registered a vow that he or she at least will not join the great army of book-perse- cutors—men and women who cannot touch a volume without maltreating it, and who, though they are often ready to describe the removal of a book- plate, even from a worthless volume, as an act of vandalism, do infinitely more harm to books in general by their ruthless handling of them.