Chronik Des Akademischen Jahres 2005/2006
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nachruf Prof. Dr. Eugen Ewig
322 Nachrufe Eugen Ewig 18.5.1913 – 1.3.2006 Im hohen Alter, im 93. Lebensjahr, starb Eugen Ewig am 1. März 2006, einer der international angesehensten Mediävisten; er war seit 1979 korrespondierendes Mit- glied der Bayerischen Akademie der Wis- senschaften. 1913 in Bonn geboren, besuchte er das humanistische Beethoven-Gymnasium und studierte in seiner Heimatstadt von 1931– 1937 Geschichte und zuletzt Romanistik, vornehmlich bei Wilhelm Levison und Ernst Robert Curtius. Mit Curtius hat bereits viel zu tun, was Ewigs späteres Wirken nachhaltig kennzeichnete: „Eine auf- keimende Neigung zu Frankreich hat er gefestigt, mein Frankreichbild hat er geprägt und durch die Schärfung des Blicks für Zusammenhänge mit der geistigen Tradition der Antike und der lateinischen Literatur vertieft“ (Ewig in seiner Erwiderung auf seine Wahl in die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften 1978; die Laudatio hielt Theodor Schief- fer: Jahrbuch 1978 der Akademie, S. 63). Von Levison, seinem jüdischen, 1935 aus dem Amt gedrängten Lehrer, erhielt Ewig als sein letzter Schüler noch sein Dissertationsthema, wurde von ihm auch betreut, doch für die Prüfungsformalien musste Anfang 1936 bereits der Neuhistoriker Max Braubach einspringen. Ewig hatte Levison stets die Treue gehalten und ihn auch bei seiner späten Ausreise nach England in mutiger, für ihn selbst gefährlicher Weise unterstützt. Das Dissertationsthema, das der Altmeister Levison Ewig anvertraute, handelte über einen Autor des 15. Jahrhunderts: „Die Anschauungen des Karthäusers Dionysius von Roermond über den christlichen Ordo in Staat und Kirche“, erschienen 1936. Aus gesundheitlichen Gründen vom Militär freigestellt, als liberaler Geist, als überzeugter Katholik und ohne jede Bindung an die NSDAP waren etwaige Gedanken an eine Hochschullaufbahn obsolet. -
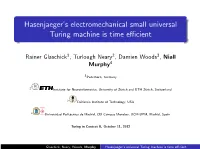
Hasenjaeger's Electromechanical Small Universal Turing Machine Is
Hasenjaeger's electromechanical small universal Turing machine is time efficient Rainer Glaschick1, Turlough Neary2, Damien Woods3, Niall Murphy4 1Paderborn, Germany 2 Institute for Neuroinformatics, University of Z¨urichand ETH Z¨urich,Switzerland 3 California Institute of Technology, USA c a m p u s 4 MONCLOA Universidad Polit´ecnicade Madrid, CEI Campus Moncloa, UCM-UPM, Madrid, Spain Turing in Context II, October 11, 2012 Glaschick, Neary, Woods, Murphy Hasenjaeger's universal Turing machine is time efficient Summary Hasenjaeger, a (near) contemporary of Turing's Built electromechanical universal Turing machine that was remarkably small Simulated Wang's B-machine (non-erasing machine) We prove that Wang B-machines are a time efficient model of computation (an exponential improvement) As an immediate corollary we find that Hasenjaeger's small machine is efficiently universal Glaschick, Neary, Woods, Murphy Hasenjaeger's universal Turing machine is time efficient Some context 1936 \On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungs problem" Scholz in M¨unsterand Braithwaite in Cambridge requested preprints Scholz was founding a mathematical logic group in M¨unster Undergraduate Hasenjaeger Copyright MFO/CC BY-SA 2.0 Glaschick, Neary, Woods, Murphy Hasenjaeger's universal Turing machine is time efficient Gisbert Hasenjaeger Scholz got him a place in the High Command cryptography group 1942 Hasenjaeger looked for weaknesses in the Enigma machine After the war Hasenjaeger became Scholz's PhD student Became professor of Mathematical logic -

Pariser Historische Studien Bd. 86 2007
Pariser Historische Studien Bd. 86 2007 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hi- nausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Eugen Ewig REINHOLD KAISER EUGENEWIG Vom Rheinland zum Abendland Eugen Ewig ist am 18. März 1913 in Bonn geboren und in Bonn am 1. März 2006 mit fast 93 Jahren gestorben. Er gehört zu jenen rheinischen und katholi schen Historikern, die durch ihr Wirken in Universität, Forschung, Politik und Öffentlichkeit die Frühmittelalterforschung in Deutschland nachhaltig be stimmt haben. Sein wissenschaftliches CEuvre ist in einem Zeitraum von 70 Jahren zwischen 1936 und 2006 entstanden '. Er zählt angesichts seines um- I Eine kurze Würdigung von Leben und Werk Eugen Ewigs findet sich im Geleitwort von Karl Ferdinand WERNER zu den beiden vom Deutschen Historischen Institut Paris publi zierten Sammelbänden von Hartmut ATSMA (Hg.), Eugen Ewig, Spätantikes und fränki• sches Gallien. Gesammelte Schriften (1952-1973), 2 Bde., Zürich, München 1976-1979 (Beihefte der Francia, 3/1-2), Bd. 1, S. IX-XII; knapp ist das Vorwort von Rudolf SCHIEFFER in: DERS. (Hg.), Beiträge zur Geschichte des Regnum Francorum. Referate beim Wissenschaftlichen Colloquium zum 75. Geburtstag von Eugen Ewig am 28. -

Bulletin Du Centre D'études Médiévales
Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA 22.1 | 2018 Varia Alsace and Burgundy : Spatial Patterns in the Early Middle Ages, c. 600-900 Karl Weber Electronic version URL: http://journals.openedition.org/cem/14838 DOI: 10.4000/cem.14838 ISSN: 1954-3093 Publisher Centre d'études médiévales Saint-Germain d'Auxerre Electronic reference Karl Weber, « Alsace and Burgundy : Spatial Patterns in the Early Middle Ages, c. 600-900 », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [Online], 22.1 | 2018, Online since 03 September 2018, connection on 19 April 2019. URL : http://journals.openedition.org/cem/14838 ; DOI : 10.4000/ cem.14838 This text was automatically generated on 19 April 2019. Les contenus du Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre (BUCEMA) sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Alsace and Burgundy : Spatial Patterns in the Early Middle Ages, c. 600-900 1 Alsace and Burgundy : Spatial Patterns in the Early Middle Ages, c. 600-900 Karl Weber EDITOR'S NOTE Cet article fait référence aux cartes 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 10 du dossier cartographique. Ces cartes sont réinsérées dans le corps du texte et les liens vers le dossier cartographique sont donnés en documents annexes. Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA, 22.1 | 2018 Alsace and Burgundy : Spatial Patterns in the Early Middle Ages, c. 600-900 2 1 The following overview concerns the question of whether forms of spatial organisation below the kingdom level are discernible in the areas corresponding to present-day Western Switzerland and Western France during the early Middle Ages. -

Addenda to the Insect Fauna of Al-Baha Province, Kingdom of Saudi Arabia with Zoogeographical Notes Magdi S
JOURNAL OF NATURAL HISTORY, 2016 VOL. 50, NOS. 19–20, 1209–1236 http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2015.1103913 Addenda to the insect fauna of Al-Baha Province, Kingdom of Saudi Arabia with zoogeographical notes Magdi S. El-Hawagrya,c, Mostafa R. Sharafb, Hathal M. Al Dhaferb, Hassan H. Fadlb and Abdulrahman S. Aldawoodb aEntomology Department, Faculty of Science, Cairo University, Giza, Egypt; bPlant Protection Department, College of Food and Agriculture Sciences, King Saud University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; cSurvey and Classification of Agricultural and Medical Insects in Al-Baha Province, Al-Baha University, Al-Baha, Saudi Arabia ABSTRACT ARTICLE HISTORY The first list of insects (Arthropoda: Hexapoda) of Al-Baha Received 1 April 2015 Province, Kingdom of Saudi Arabia (KSA) was published in 2013 Accepted 30 September 2015 and contained a total of 582 species. In the present study, 142 Online 9 December 2015 species belonging to 51 families and representing seven orders KEYWORDS are added to the fauna of Al-Baha Province, bringing the total Palaearctic; Afrotropical; number of species now recorded from the province to 724. The Eremic; insect species; reported species are assigned to recognized regional zoogeogra- Arabian Peninsula; Tihama; phical regions. Seventeen of the species are recorded for the first Al-Sarah; Al-Sarawat time for KSA, namely: Platypleura arabica Myers [Cicadidae, Mountains Hemiptera]; Cletomorpha sp.; Gonocerus juniperi Herrich-Schäffer [Coreidae, Hemiptera]; Coranus lateritius (Stål); Rhynocoris bipus- tulatus (Fieber) [Reduviidae, Hemiptera]; Cantacader iranicus Lis; Dictyla poecilla Drake & Hill [Tingidae, Hemiptera]; Mantispa scab- ricollis McLachlan [Mantispidae, Neuroptera]; Cerocoma schreberi Fabricius [Meloidae, Coleoptera]; Platypus parallelus (Fabricius) [Curculionidae, Coleoptera]; Zodion cinereum (Fabricius) [Conopidae, Diptera]; Ulidia ?ruficeps Becker [Ulidiidae, Diptera]; Atherigona reversura Villeneuve [Muscidae, Diptera]; Aplomya metallica (Wiedemann); Cylindromyia sp. -

Das Gebiet Des Nördlichen Mittelrheins Als Teil Der Germania Prima in Spätrömischer Und Frühmittelalterlicher Zeit
Das Gebiet des nördlichen Mittelrheins als Teil der Germania prima in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit VON FRANZ-JOSEF HEYEN Mein Part in den Verhandlungen bestand darin, die Umrisse des Geschehens am nördli chen Mittelrhein in der Spätantike und im frühen Mittelalter zu schildern. Selbstver ständlich kann das auch zwischen dem vorangegangenen großen Überblick von Eu gen Ewig und den nachfolgenden, speziell einzelnen Orten gewidmeten Referaten nur ein weitestgehend auf der vorhandenen Literatur 0 aufbauendes grobes Raster sein, in dem lediglich in einigen Feldern Akzente oder Fragezeichen gesetzt oder auch neue An sätze zur Diskussion gestellt werden können. Schon die räumliche Umschreibung des Untersuchungsgebietes als »nördlicher Mit telrhein« ist umständlich, weil ein umfassender Landschaftsname fehlt. Aber offensicht lich ist dies schon eine, auch für die historische Betrachtung wichtige Beobachtung, macht sie doch deutlich, daß dem Raum einerseits ein beherrschendes, namengebendes Oberzentrum oder Landschaftsgefüge fehlt, er aber anderseits von den Nachbarräumen nicht abgedeckt, sondern ausgespart wird, sozusagen übrig bleibt. Zumindest bietet sich auf den ersten Blick dieses Bild, und auch bei der Durchmusterung der Literatur wird man bald feststellen, daß dieser Raum meist nur »am Rande« behandelt wurde. Wir werden die Frage präsent zu halten haben, ob dies eine Feststellung ist, die zur Charak terisierung des Raumes als historisches Gebilde geeignet ist und zwar kontinuierlich oder nur in bestimmten Epochen und welche Folgerungen dies für den Ablauf des hi storischen Geschehens haben müßte und hatte. Angesprochen ist das Rheintal mit den beidseits angrenzenden Gebieten zwischen Andernach/Sinzig im Norden und Oberwesel/Bingen im Süden bzw. zwischen den Mündungen von Ahr und Nahe, das unmittelbare Einzugsgebiet beider Flüsse jeweils ausgeschlossen. -
![Arxiv:1803.01386V4 [Math.HO] 25 Jun 2021](https://docslib.b-cdn.net/cover/2691/arxiv-1803-01386v4-math-ho-25-jun-2021-712691.webp)
Arxiv:1803.01386V4 [Math.HO] 25 Jun 2021
2009 SEKI http://wirth.bplaced.net/seki.html ISSN 1860-5931 arXiv:1803.01386v4 [math.HO] 25 Jun 2021 A Most Interesting Draft for Hilbert and Bernays’ “Grundlagen der Mathematik” that never found its way into any publi- Working-Paper cation, and 2 CVof Gisbert Hasenjaeger Claus-Peter Wirth Dept. of Computer Sci., Saarland Univ., 66123 Saarbrücken, Germany [email protected] SEKI Working-Paper SWP–2017–01 SEKI SEKI is published by the following institutions: German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI GmbH), Germany • Robert Hooke Str.5, D–28359 Bremen • Trippstadter Str. 122, D–67663 Kaiserslautern • Campus D 3 2, D–66123 Saarbrücken Jacobs University Bremen, School of Engineering & Science, Campus Ring 1, D–28759 Bremen, Germany Universität des Saarlandes, FR 6.2 Informatik, Campus, D–66123 Saarbrücken, Germany SEKI Editor: Claus-Peter Wirth E-mail: [email protected] WWW: http://wirth.bplaced.net Please send surface mail exclusively to: DFKI Bremen GmbH Safe and Secure Cognitive Systems Cartesium Enrique Schmidt Str. 5 D–28359 Bremen Germany This SEKI Working-Paper was internally reviewed by: Wilfried Sieg, Carnegie Mellon Univ., Dept. of Philosophy Baker Hall 161, 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA 15213 E-mail: [email protected] WWW: https://www.cmu.edu/dietrich/philosophy/people/faculty/sieg.html A Most Interesting Draft for Hilbert and Bernays’ “Grundlagen der Mathematik” that never found its way into any publication, and two CV of Gisbert Hasenjaeger Claus-Peter Wirth Dept. of Computer Sci., Saarland Univ., 66123 Saarbrücken, Germany [email protected] First Published: March 4, 2018 Thoroughly rev. & largely extd. (title, §§ 2, 3, and 4, CV, Bibliography, &c.): Jan. -
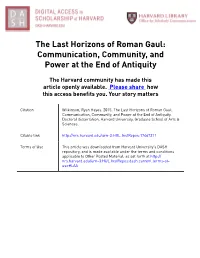
The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity
The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Wilkinson, Ryan Hayes. 2015. The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:17467211 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity A dissertation presented by Ryan Hayes Wilkinson to The Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2015 © 2015 Ryan Hayes Wilkinson All rights reserved. Dissertation Advisor: Professor Michael McCormick Ryan Hayes Wilkinson The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity Abstract In the fifth and sixth centuries CE, the Roman Empire fragmented, along with its network of political, cultural, and socio-economic connections. How did that network’s collapse reshape the social and mental horizons of communities in one part of the Roman world, now eastern France? Did new political frontiers between barbarian kingdoms redirect those communities’ external connections, and if so, how? To address these questions, this dissertation focuses on the cities of two Gallo-Roman tribal groups. -

Rezension Über: Heike Pöppelmann, Das Spätantik-Frühmittelalterliche Gräberfeld Von Jülich, Kr
Zitierhinweis Gottschalk, Raymund: Rezension über: Heike Pöppelmann, Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich, Kr. Düren, Bonn : Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univ, 2010, in: Jülicher Geschichtsblätter. Jahrbuch des Jülicher Geschichtsvereins, 85/86 (2017/2018), S. 376-394, https://www.recensio-regio.net/r/225136b04562479a952ea77d3eef2935 First published: Jülicher Geschichtsblätter. Jahrbuch des Jülicher Geschichtsvereins, 85/86 (2017/2018) copyright Dieser Beitrag kann vom Nutzer zu eigenen nicht-kommerziellen Zwecken heruntergeladen und/oder ausgedruckt werden. Darüber hinaus gehende Nutzungen sind ohne weitere Genehmigung der Rechteinhaber nur im Rahmen der gesetzlichen Schrankenbestimmungen (§§ 44a-63a UrhG) zulässig. Rezensionen Jülich über das aus Sicht der archäologischen Quellenbasis nun nicht mehr so dunkle 5. Jahrhundert hinaus erbringen konnten. In einer abschließenden Zusammenstel- lung des archäologischen und historischen Forschungsstandes bringt es die Autorin vereinfacht dargestellt auf den Punkt, dass die im Kastell Iuliacum mit zumindest für die umgebende Bördenlandschaft zentralörtlicher Funktion stationierten Soldaten, die bis 476 am Ende einer von Ravenna über die Föderatenkönige von Lyon und Köln laufenden Befehlskette standen, dieses als die »letzten Römer« im frühen 6. Jahr- hundert der fränkischen Merowingerherrschaft übergaben (S. 276–293). Nach Listen wie der zentralen der datierbaren Gräber des Kastellfriedhofs und einem imposanten Literaturverzeichnis (S. 294–346) schließt ein vorbildlicher kritischer Befund- und Fundkatalog (S. 347–422) mit 94 Fundtafeln dieses für die frühe Geschichte des spät fränkisch gewordenen Rheinlandes so wichtige Werk ab. Jörg Kleemann Heike Pöppelmann, Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich, Kr. Düren (= Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, Bd. 11), Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Institut für Vor- und Frühge- schichtliche Archäologie 2010. -

Francia – Forschungen Zur Westeuropäischen Geschichte
Francia – Forschungen zur westeuropäischen Geschichte Bd. 34/1 2007 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online- Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. f34/1 09 Nekrologe 17.08.2007 14:43 Uhr Seite 237 Nekrolog Eugen Ewig 237 Schriftenverzeichnis Eugen Ewig 1936 Die Anschauungen des Karthäusers Dionysius von Roermond über den christlichen Ordo in Staat und Kirche, Bonn 1936 [Dissertation]. 1939 Die Wahl des Kurfürsten Josef Clemens von Köln zum Fürstbischof von Lüttich, 1694, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 135 (1939), S. 41–79. 1943 Die Deutschordenskommende Saarburg, in: Elsaß-Lothringisches Jahrbuch 21 (1943), S. 81–126. 1947 L’avenir rhénan, in: Le Rhin. Nil de l’Occident, hg. von Jean Dumont, Paris 1947, S. 315–324. 1950 Landschaft und Stamm in der deutschen Geschichte, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 1 (1950), S. 154–168. 1952 Civitas, Gau und Territorium in den Trierischen Mosellanden, in: Rheinische Vier- teljahrsblätter 17 (1952; Festschrift Theodor Frings), S. 120–137 [ND in: Spätantikes und Fränkisches Gallien, Bd. 1, 1976, S. 504–522]. 1952 Erbe des Abendlandes. Lehrbuch der Geschichte für Höhere Schulen. Oberstufe, Teil 1: Urzeit und Altertum. Die Entstehung des Abendlandes, 2. -

Unser Die Welt – Trotz Alledem 169
WilhelmK.Essler UnserdieWelt WilhelmK.Essler UnserdieWelt SprachphilosophischeGrundlegungen derErkenntnistheorie AusgewählteArtikel HerausgegebenvonGerhardPreyer ©2001WilhelmK.Essler ©2001HumanitiesOnline FrankfurtamMain,Germany http://www.humanities-online.de DiesesWerkstehtunterderCreativeCommonsLizenz Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung2.0Deutschland. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/deed.de ThisworkislicensedunderaCreativeCommonsAttribution- NonCommercial-NoDerivs2.0GermanyLicense. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/deed.en ISBN978-3-934157-06-4 INHALTSVERZEICHNIS 5 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung:ZurStrukturvonErfahrung 7 Fundamentalsofa Semi-Kantian MétaphysicsofKnowledge 21 Kantnowadays................................ 21 Kantianpointsofview. 21 Onempiricalconcepts. 22 Relativizing Kant’s distinctions . .. 23 Levelsofapriority .............................. 24 Kant’smainquestion. 25 JustifyingbeyondKant. 26 Transcendentalbasesforostensions . 27 Fromtranscendentalto objective knowledge . .. 28 Kant und kein Ende 31 Erkenntnisphilosophie und Erkenntnispsychologie . ...... 31 Eine kantische Wissenschaftsphilosophie der Gegenwart . ....... 32 Von der Wissenschaftsphilosophie zur Erkenntnisphilosophie ...... 36 DerInhaltdesUniversums . 37 DieFormdesUniversums. 41 DasWahrnehmenvonObjektenimRaum . 44 DasWahrnehmenvonObjekteninderZeit . 50 Waskönnenwirwissen?. 52 Tarski on Language and Truth 57 Was ist Wahrheit? 73 Am Anfang war die Tat 81 Gorgias -

Notices of the American Mathematical Society
OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY VOLUME 16, NUMBER 3 ISSUE NO. 113 APRIL, 1969 OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Edited by Everett Pitcher and Gordon L. Walker CONTENTS MEETINGS Calendar of Meetings ..................................... 454 Program for the April Meeting in New York ..................... 455 Abstracts for the Meeting - Pages 500-531 Program for the April Meeting in Cincinnati, Ohio ................. 466 Abstracts for the Meeting -Pages 532-550 Program for the April Meeting in Santa Cruz . ......... 4 73 Abstracts for the Meeting- Pages 551-559 PRELIMINARY ANNOUNCEMENT OF MEETING ....................•.. 477 NATIONAL REGISTER REPORT .............. .. 478 SPECIAL REPORT ON THE BUSINESS MEETING AT THE ANNUAL MEETING IN NEW ORLEANS ............•................... 480 INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS ................... 482 LETTERS TO THE EDITOR ..................................... 483 APRIL MEETING IN THE WEST: Some Reactions of the Membership to the Change in Location ....................................... 485 PERSONAL ITEMS ........................................... 488 MEMORANDA TO MEMBERS Memoirs ............................................. 489 Seminar of Mathematical Problems in the Geographical Sciences ....... 489 ACTIVITIES OF OTHER ASSOCIATIONS . 490 SUMMER INSTITUTES AND GRADUATE COURSES ..................... 491 NEWS ITEMS AND ANNOUNCEMENTS ..... 496 ABSTRACTS OF CONTRIBUTED PAPERS .................•... 472, 481, 500 ERRATA . • . 589 INDEX TO ADVERTISERS . 608 MEETINGS Calendar of Meetings NOn:: This Calendar lists all of the meetings which have been approved by the Council up to the date at which this issue of the c;Noticei) was sent to press. The summer and annual meetings are joint meetings of the Mathematical Association of America and the American Mathematical Society. The meeting dates which fall rather far in the future are subject to change. This is particularly true of the meetings to which no numbers have yet been assigned.