Unser Die Welt – Trotz Alledem 169
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
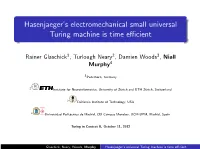
Hasenjaeger's Electromechanical Small Universal Turing Machine Is
Hasenjaeger's electromechanical small universal Turing machine is time efficient Rainer Glaschick1, Turlough Neary2, Damien Woods3, Niall Murphy4 1Paderborn, Germany 2 Institute for Neuroinformatics, University of Z¨urichand ETH Z¨urich,Switzerland 3 California Institute of Technology, USA c a m p u s 4 MONCLOA Universidad Polit´ecnicade Madrid, CEI Campus Moncloa, UCM-UPM, Madrid, Spain Turing in Context II, October 11, 2012 Glaschick, Neary, Woods, Murphy Hasenjaeger's universal Turing machine is time efficient Summary Hasenjaeger, a (near) contemporary of Turing's Built electromechanical universal Turing machine that was remarkably small Simulated Wang's B-machine (non-erasing machine) We prove that Wang B-machines are a time efficient model of computation (an exponential improvement) As an immediate corollary we find that Hasenjaeger's small machine is efficiently universal Glaschick, Neary, Woods, Murphy Hasenjaeger's universal Turing machine is time efficient Some context 1936 \On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungs problem" Scholz in M¨unsterand Braithwaite in Cambridge requested preprints Scholz was founding a mathematical logic group in M¨unster Undergraduate Hasenjaeger Copyright MFO/CC BY-SA 2.0 Glaschick, Neary, Woods, Murphy Hasenjaeger's universal Turing machine is time efficient Gisbert Hasenjaeger Scholz got him a place in the High Command cryptography group 1942 Hasenjaeger looked for weaknesses in the Enigma machine After the war Hasenjaeger became Scholz's PhD student Became professor of Mathematical logic -

Chronik Des Akademischen Jahres 2005/2006
CHRONIK DES AKADEMISCHEN JAHRES 2005/2006 Chronik des Akademischen Jahres 2005/2006 herausgegeben vom Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn, Prof. Dr. Matthias Winiger, Bonn 2006. Redaktion: Jens Müller, Archiv der Universität Bonn Herstellung: Druckerei der Universität Bonn MATTHIAS WINIGER RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN Chronik des Akademischen Jahres 2005/06 Bonn 2006 Jahrgang 121 Neue Folge Jahrgang 110 INHALTSVERZEICHNIS Rede des Rektors zur Eröffnung des Akademischen Jahres Rückblick auf das Akademische Jahr 2005/06 .....S. 9 Preisverleihungen und Ehrungen Preisverleihungen und Ehrungen im Akademischen Jahr 2005/06 ...........................S. 23 Akademischer Festvortrag Wilhelm Barthlott, Biodiversität als Herausforderung und Chance.................................S. 25 Chronik des Akademischen Jahres Das Akademische Jahr 2005/06 in Pressemeldungen..............................................S. 40 Nachrufe ......................................................................S. 54 Berichte aus den Fakultäten Evangelisch-Theologische Fakultät ....................S. 67 Katholisch-Theologische Fakultät ......................S. 74 Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät S. 83 Medizinische Fakultät ............................................S. 103 Philosophische Fakultät .........................................S. 134 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät.......S. 170 Landwirtschaftliche Fakultät ..................................S. 206 Beitrag zur Universitätsgeschichte Thomas Becker, -
![Arxiv:1803.01386V4 [Math.HO] 25 Jun 2021](https://docslib.b-cdn.net/cover/2691/arxiv-1803-01386v4-math-ho-25-jun-2021-712691.webp)
Arxiv:1803.01386V4 [Math.HO] 25 Jun 2021
2009 SEKI http://wirth.bplaced.net/seki.html ISSN 1860-5931 arXiv:1803.01386v4 [math.HO] 25 Jun 2021 A Most Interesting Draft for Hilbert and Bernays’ “Grundlagen der Mathematik” that never found its way into any publi- Working-Paper cation, and 2 CVof Gisbert Hasenjaeger Claus-Peter Wirth Dept. of Computer Sci., Saarland Univ., 66123 Saarbrücken, Germany [email protected] SEKI Working-Paper SWP–2017–01 SEKI SEKI is published by the following institutions: German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI GmbH), Germany • Robert Hooke Str.5, D–28359 Bremen • Trippstadter Str. 122, D–67663 Kaiserslautern • Campus D 3 2, D–66123 Saarbrücken Jacobs University Bremen, School of Engineering & Science, Campus Ring 1, D–28759 Bremen, Germany Universität des Saarlandes, FR 6.2 Informatik, Campus, D–66123 Saarbrücken, Germany SEKI Editor: Claus-Peter Wirth E-mail: [email protected] WWW: http://wirth.bplaced.net Please send surface mail exclusively to: DFKI Bremen GmbH Safe and Secure Cognitive Systems Cartesium Enrique Schmidt Str. 5 D–28359 Bremen Germany This SEKI Working-Paper was internally reviewed by: Wilfried Sieg, Carnegie Mellon Univ., Dept. of Philosophy Baker Hall 161, 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA 15213 E-mail: [email protected] WWW: https://www.cmu.edu/dietrich/philosophy/people/faculty/sieg.html A Most Interesting Draft for Hilbert and Bernays’ “Grundlagen der Mathematik” that never found its way into any publication, and two CV of Gisbert Hasenjaeger Claus-Peter Wirth Dept. of Computer Sci., Saarland Univ., 66123 Saarbrücken, Germany [email protected] First Published: March 4, 2018 Thoroughly rev. & largely extd. (title, §§ 2, 3, and 4, CV, Bibliography, &c.): Jan. -

Notices of the American Mathematical Society
OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY VOLUME 16, NUMBER 3 ISSUE NO. 113 APRIL, 1969 OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Edited by Everett Pitcher and Gordon L. Walker CONTENTS MEETINGS Calendar of Meetings ..................................... 454 Program for the April Meeting in New York ..................... 455 Abstracts for the Meeting - Pages 500-531 Program for the April Meeting in Cincinnati, Ohio ................. 466 Abstracts for the Meeting -Pages 532-550 Program for the April Meeting in Santa Cruz . ......... 4 73 Abstracts for the Meeting- Pages 551-559 PRELIMINARY ANNOUNCEMENT OF MEETING ....................•.. 477 NATIONAL REGISTER REPORT .............. .. 478 SPECIAL REPORT ON THE BUSINESS MEETING AT THE ANNUAL MEETING IN NEW ORLEANS ............•................... 480 INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS ................... 482 LETTERS TO THE EDITOR ..................................... 483 APRIL MEETING IN THE WEST: Some Reactions of the Membership to the Change in Location ....................................... 485 PERSONAL ITEMS ........................................... 488 MEMORANDA TO MEMBERS Memoirs ............................................. 489 Seminar of Mathematical Problems in the Geographical Sciences ....... 489 ACTIVITIES OF OTHER ASSOCIATIONS . 490 SUMMER INSTITUTES AND GRADUATE COURSES ..................... 491 NEWS ITEMS AND ANNOUNCEMENTS ..... 496 ABSTRACTS OF CONTRIBUTED PAPERS .................•... 472, 481, 500 ERRATA . • . 589 INDEX TO ADVERTISERS . 608 MEETINGS Calendar of Meetings NOn:: This Calendar lists all of the meetings which have been approved by the Council up to the date at which this issue of the c;Noticei) was sent to press. The summer and annual meetings are joint meetings of the Mathematical Association of America and the American Mathematical Society. The meeting dates which fall rather far in the future are subject to change. This is particularly true of the meetings to which no numbers have yet been assigned. -

A Complete Bibliography of Publications in Cryptologia
A Complete Bibliography of Publications in Cryptologia Nelson H. F. Beebe University of Utah Department of Mathematics, 110 LCB 155 S 1400 E RM 233 Salt Lake City, UT 84112-0090 USA Tel: +1 801 581 5254 FAX: +1 801 581 4148 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] (Internet) WWW URL: http://www.math.utah.edu/~beebe/ 04 September 2021 Version 3.64 Title word cross-reference 10016-8810 [?, ?]. 1221 [?]. 125 [?]. 15.00/$23.60.0 [?]. 15th [?, ?]. 16th [?]. 17-18 [?]. 18 [?]. 180-4 [?]. 1812 [?]. 18th (t; m)[?]. (t; n)[?, ?]. $10.00 [?]. $12.00 [?, ?, ?, ?, ?]. 18th-Century [?]. 1930s [?]. [?]. 128 [?]. $139.99 [?]. $15.00 [?]. $16.95 1939 [?]. 1940 [?, ?]. 1940s [?]. 1941 [?]. [?]. $16.96 [?]. $18.95 [?]. $24.00 [?]. 1942 [?]. 1943 [?]. 1945 [?, ?, ?, ?, ?]. $24.00/$34 [?]. $24.95 [?, ?]. $26.95 [?]. 1946 [?, ?]. 1950s [?]. 1970s [?]. 1980s [?]. $29.95 [?]. $30.95 [?]. $39 [?]. $43.39 [?]. 1989 [?]. 19th [?, ?]. $45.00 [?]. $5.95 [?]. $54.00 [?]. $54.95 [?]. $54.99 [?]. $6.50 [?]. $6.95 [?]. $69.00 2 [?, ?]. 200/220 [?]. 2000 [?]. 2004 [?, ?]. [?]. $69.95 [?]. $75.00 [?]. $89.95 [?]. th 2008 [?]. 2009 [?]. 2011 [?]. 2013 [?, ?]. [?]. A [?]. A3 [?, ?]. χ [?]. H [?]. k [?, ?]. M 2014 [?]. 2017 [?]. 2019 [?]. 20755-6886 [?, ?]. M 3 [?]. n [?, ?, ?]. [?]. 209 [?, ?, ?, ?, ?, ?]. 20th [?]. 21 [?]. 22 [?]. 220 [?]. 24-Hour [?, ?, ?]. 25 [?, ?]. -Bit [?]. -out-of- [?, ?]. -tests [?]. 25.00/$39.30 [?]. 25.00/839.30 [?]. 25A1 [?]. 25B [?]. 26 [?, ?]. 28147 [?]. 28147-89 000 [?]. 01Q [?, ?]. [?]. 285 [?]. 294 [?]. 2in [?, ?]. 2nd [?, ?, ?, ?]. 1 [?, ?, ?, ?]. 1-4398-1763-4 [?]. 1/2in [?, ?]. 10 [?]. 100 [?]. 10011-4211 [?]. 3 [?, ?, ?, ?]. 3/4in [?, ?]. 30 [?]. 310 1 2 [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]. 312 [?]. 325 [?]. 3336 [?, ?, ?, ?, ?, ?]. affine [?]. [?]. 35 [?]. 36 [?]. 3rd [?]. Afluisterstation [?, ?]. After [?]. Aftermath [?]. Again [?, ?]. Against 4 [?]. 40 [?]. 44 [?]. 45 [?]. 45th [?]. 47 [?]. [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]. Age 4in [?, ?]. [?, ?]. Agencies [?]. Agency [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]. -
A Iberoamericana Del Siglo XX. Volumen 1: Filosof?A
E N CICLOPEDIA E NCICLOPEDIA 33 33 Con el volumen dedicado a la «Filosofía iberoamericana del siglo XX » I BERO A M ERICANA concluye el proyecto editorial de la Enciclopedia Iberoamericana de Fi- I BEROA MERICANA DE F ILOSOFÍA losofía. Obedeciendo a una doble pretensión, práctica y teórica, pone en DE F ILOSOFIA E manos del lector un recorrido por los temas y autores hispano- y lusopar- I A lantes de ese periodo, reflexionando al mismo tiempo sobre la peculiaridad F de su contribución al lenguaje filosófico. El tratamiento riguroso de estas cuestiones ha obligado a dividir la obra en dos partes. Esta primera entrega, sobre Filosofía teórica e historia de la filosofía, se ocupa del cultivo de campos como la metafísica, la lógica, Filosofía iberoamericana la filosofía de la ciencia, la teoría del conocimiento, la filosofía del lenguaje Plan general del siglo XX I y de la mente, además de los relativos a la historia de la filosofía en sus diferentes etapas. La segunda, de próxima aparición, sobre Filosofía práctica Lógica* Filosofía teórica y filosofía de la cultura, trata de materias como la filosofía de la historia, la Filosofía de la lógica* e historia de la filosofía filosofía de la religión, la ética, la filosofía política y la filosofía del derecho, la Filosofía del lenguaje I. Semántica* estética, la filosofía de la cultura, la literatura y el ensayo. Se articula así una Filosofía del lenguaje II. Pragmática* útil visión de conjunto de la producción filosófica en los países de habla La mente humana* española y portuguesa, una comunidad con un creciente grado de origina- El conocimiento* lidad, autonomía y nivel científico. -
The Prehistory of the Subsystems of Second-Order Arithmetic
The Prehistory of the Subsystems of Second-Order Arithmetic Walter Dean* and Sean Walsh** December 19, 2016 Abstract This paper presents a systematic study of the prehistory of the traditional subsys- tems of second-order arithmetic that feature prominently in the reverse mathematics program of Friedman and Simpson. We look in particular at: (i) the long arc from Poincar´eto Feferman as concerns arithmetic definability and provability, (ii) the in- terplay between finitism and the formalization of analysis in the lecture notes and publications of Hilbert and Bernays, (iii) the uncertainty as to the constructive status of principles equivalent to Weak K¨onig'sLemma, and (iv) the large-scale intellectual backdrop to arithmetical transfinite recursion in descriptive set theory and its effec- tivization by Borel, Lusin, Addison, and others. * Department of Philosophy, University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, United Kingdom, E-mail: [email protected] **Department of Logic and Philosophy of Science, 5100 Social Science Plaza, University of California, Irvine, Irvine, CA 92697-5100, U.S.A., E-mail: [email protected] or [email protected] 1 Contents 1 Introduction3 2 Arithmetical comprehension and related systems5 2.1 Russell, Poincar´e,Zermelo, and Weyl on set existence . .5 2.2 Grzegorczyk, Mostowski, and Kond^oon effective analysis . .7 2.3 Kreisel on predicative definability . .9 2.4 Kreisel, Wang, and Feferman on predicative provability . 10 2.5 ACA0 as a formal system . 11 3 Hilbert and Bernays, the Grundlagen der Mathematik, and recursive com- prehension 13 3.1 From the Axiom of Reducibility to second-order arithmetic . -
S Small Universal Electromechanical Toy✩
Journal of Complexity 30 (2014) 634–646 Contents lists available at ScienceDirect Journal of Complexity journal homepage: www.elsevier.com/locate/jco Wang's B machines are efficiently universal, as is Hasenjaeger's small universal electromechanical toyI Turlough Neary a, Damien Woods b, Niall Murphy c,d,∗, Rainer Glaschick e a Institute for Neuroinformatics, University of Zürich & ETH Zürich, Switzerland b California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA c Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid & CEI-Moncloa UPM-UCM, Spain d Microsoft Research, Cambridge, CB1 2FB, UK1 e Paderborn, Germany article info a b s t r a c t Article history: In the 1960s Gisbert Hasenjaeger built Turing Machines from elec- Received 29 September 2013 tromechanical relays and uniselectors. Recently, Glaschick reverse Accepted 31 January 2014 engineered the program of one of these machines and found that Available online 14 February 2014 it is a universal Turing machine. In fact, its program uses only four states and two symbols, making it a very small universal Turing ma- Keywords: chine. (The machine has three tapes and a number of other features Polynomial time that are important to keep in mind when comparing it to other Computational complexity Small universal Turing machines small universal machines.) Hasenjaeger's machine simulates Hao Wang's B machine Wang's B machines, which were proved universal by Wang. Un- Non-erasing Turing machines fortunately, Wang's original simulation algorithm suffers from an Models of computation exponential slowdown when simulating Turing machines. Hence, via this simulation, Hasenjaeger's machine also has an exponen- tial slowdown when simulating Turing machines. -

Airy, George Biddell
Historyofscience.com Jeremy Norman & Co., Inc. Historyofinformation.com History of Science, Medicine & Technology History of Media Rare Books, Manuscripts, Appraisals P. O. Box 867, Novato, California 94948–0867 Email: [email protected] Telephone: 415–892–3181 Mobile: 415–225–3954 Quine, Willard Van Orman (1908-2000). Collection of 24 offprints and one journal article, as listed below. 1932-1969. In original printed wrappers or without wrappers as issued. One offprint with presentation inscription from Quine to Roderick Firth (1917-87), Quine’s fellow professor of philosophy at Harvard University. Five of the offprints are from the library of German mathematical logician Gisbert Hasenjaeger (1919-2006), with his signature or ownership stamp. Very good to fine overall; see below for condition details.$2750 First Editions, Offprint Issues of all but one of the papers listed below, representative of the work of the American mathematical logician Willard Quine, one of the most influential philosophers of the twentieth century. “Quine was a teacher of logic and set theory. Quine was famous for his position that first order logic is the only kind worthy of the name, and developed his own system of mathematics and set theory, known as New Foundations. In philosophy of mathematics, he and his Harvard colleague Hilary Putnam developed the ‘Quine–Putnam indispensability thesis,’ an argument for the reality of mathematical entities. However, he was the main proponent of the view that philosophy is not conceptual analysis, but continuous with science; the abstract branch of the empirical sciences. This led to his famous quip that ‘philosophy of science is philosophy enough.’ He led a ‘systematic attempt to understand science from within the resources of science itself’ and developed an influential naturalized epistemology that tried to provide ‘an improved scientific explanation of how we have developed elaborate scientific theories on the basis of meager sensory input.’ He also advocated ontological relativity in science, known as the Duhem–Quine thesis . -

Mathematik in Der Philosophischen Und Naturwissenschaftlichen Fakult¨At Der Universit¨At Munster:¨ 1902 – 1945
4 Von der Wiedererhebung zur Universit¨at bis zur Zerst¨orung – Mathematik in der Philosophischen und Naturwissenschaftlichen Fakult¨at der Universit¨at Munster:¨ 1902 – 1945 Mit der 1902 erfolgten Wiedererhebung der Akademie zur Volluniversit¨at begann ein deut- licher Aufschwung: Durch die (Wieder-) Errichtung der Rechts- und Staatswissenschaft- lichen Fakult¨at als dritter Fakult¨at war die Erhebung zur Universit¨at erst m¨oglich ge- worden. Die Philosophische Fakult¨at wurde in Philosophische und Naturwissenschaftliche Fakult¨at umbenannt – das manifestierte eine wichtige Erweiterung/Neuorientierung: Im Rahmen dieser Fakult¨at konnten z. B. Studenten ab 1902 pharmazeutisch-prop¨adeutische Lehrveranstaltungen besuchen, und es wurde eine medizinisch-prop¨adeutische Abteilung eingerichtet, die 1905 die vorklinische Ausbildung aufnahm. Die Mathematik war in dieser neu orientierten Fakult¨at gut vertreten: 1902 wurde das Extraordinariat von Reinhold von Lilienthal in ein Ordinariat umgewandelt. Damit gab es mit Killing und von Lilienthal wieder zwei Ordinarien fur¨ Mathematik; beide entstamm- ten der fruchtbaren “Schule” von Karl Weierstraß und Ernst Eduard Kummer an der renommierten Universit¨at Berlin, vertraten jedoch sehr unterschiedliche Forschungsgebie- te. Außerdem wirkte Max Dehn ab 1902 als Privatdozent am Mathematischen Seminar. Max Dehn (im Jahre 1950) In einem Vortrag aus Anlass der 50-Jahr-Feier der Johann-Wolfgang-Goethe-Universit¨at Frankfurt53 urteilte Carl Ludwig Siegel am 13.06.1964: “Dehns wissenschaftliche Leis- tungen geh¨oren meines Erachtens zu dem Bedeutendsten, was seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts in der Mathematik geschaffen worden ist. Durch seine tiefen und originellen Ideen hat er auf drei verschiedene Gebiete befruchtend gewirkt, n¨amlich die Grundlagen der Geometrie, die Topologie und die Gruppentheorie.” 53C. -

1 1 EIN STANDFESTER MENSCH Bemerkungen
1 EIN STANDFESTER MENSCH Bemerkungen zum Werdegang von Heinrich Scholz [Hans-Christoph Schmidt am Busch & Kai F. Wehmeier, eds, Heinrich Scholz. Logiker, Philosoph, Theologe , Paderborn: Mentis, 2005, pp. 13-45] "Der standfeste Mensch ist im Durchhalten groß. Er will nicht wer weiß wie viel zugleich. Aber er weiß, was er will; und was er will, will er ganz". 1 Arie L. Molendijk, Groningen Vor fünfzehn Jahren hat das von Heinrich Scholz gegründete Institut für Mathematische Logik und Grundlagenforschung der Universität Münster ein Symposion zu seinem 100. Geburtstag veranstaltet. Die Referenten waren damals überwiegend "Scholz-Schüler der ersten, zweiten und dritten Generation". 2 Zudem hielt Scholz' alter Freund Carl Friedrich von Weizsäcker einen Festvortrag am Vorabend des Kolloquiums. Dieser begann seine Rede mit einigen persönlichen Erinnerungen an diesen "hagere[n], magenleidende[n] Mann" mit seinen eigentümlichen Fingerbewegungen. Nach einer Skizze von Scholz' seltener Laufbahn - von der Theologie über die Philosophie zur mathematischen Logik - zitierte Von Weizsäcker aus einem späten Brief, in dem Scholz ihm geschrieben hatte: "Mein Leben hat sich nach und nach ganz auf die Ellipse zusammengezogen, deren beide Brennpunkte die Mathematik und das Christentum sind". 3 Lakonisch kommentierte Von Weizsäcker, daß es vermutlich nicht viele Menschen gibt, die man durch diese Formel beschreiben könnte, aber 1 Scholz, Von grossen Menschen und Dingen (1946), S. 35; vgl. S. 32-48. 2 [J. Diller], Logik und Grundlagenforschung, S. 7. 3 Von Weizsäcker, Die Logik, S. 13. 1 2 "er hat sich damit gut beschrieben". 4 In diesem Beitrag wird der Akzent auf dem ersten Brennpunkt liegen, ohne damit die wichtigen Verbindungen zwischen beiden leugnen zu wollen. -

Pdfvom 16.2.2008
ANNEX A. Archive National Archives Washington D.C. und Maryland (NARA) NSA Historical Collection, RG 457 • NR 554 CBBI23 6212A 19370621 SWISS CODE D TELEGRAMS LETTER TRAFFIC • NR 3820 ZEMA100 37007A 19441000 CRYPTOGRAPHIC CODES AND CIPHERS: SWISS DIPLOMATie MACHINE CI PHERSZD • NR 3821 ZEMA100 37008A 19420800 CRYPTOGRAPHIC CODESAND CIPHERS: SWISS RANDOM LETTER TRAFFIC • NR 4224 ZEMA170 6173A 19391126 CODED SWISS DIPLO MA TIC CABLEGRAMS SHOWING DECODING Die konsultierten Unterlagen befinden sich nicht in der Hauptstadt Wa shington D.C. sondern in der Aussenstelle College Park im Staat Mary land, etwa 20 km ausserhalb von Washington.Die Unterlagen sind ge ordnet und werden im Internet kurz vorgestellt:www.archives.gov/ research/holocaust/finding-aid/ civilian/rg-457 .html vom 16.2.2008 Auf den Seiten der National Security Agency (NSA) findet sich ausser dem eine Liste mit Titeln und Signaturen aller rund 5000 Dokumente aus den beiden Weltkriegen. www.nsa.gov/public/publi00004.cfm vom 16.2.2008 Informationen zu ähnlich gelagerten Deklassifzierungsaktionen finden sich hier: www.nsa.gov/public/publi00003.cfm vom 16.2.2008 229 MYTHOS ENIGMA Schweizerisches Bundesarchiv in Bern Bestände E27/19007- 19009 (Akten zum Thema Enigma und Chiffrie rung im Allgemeinen) Schweizer Regierung: Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) Bern (nicht öffentlich zugänglich) • Bruno Kröger: Bericht über allgemeine Erfahrungen bei der Entziffe rung von Geheimschriften im Hinblick auf die Sicherheitsanforde rungen, die an Geheimschriftverfahren gestellt werden müssen. Kautbeuren 1948. Typoskript. Nicht veröffentlicht. • Bruno Kröger: Analyse der Chiffriermaschine ENIGMA Type K. Kautbeuren 1948. Typoskript. Nicht veröffentlicht. Diese Dokumente wurden dem Autor 2003 durch den Verantwortlichen für Kryptologie, dem Matheamtiker Peter Nyffeler, zur Verfügung ge stellt.