Die Geschichte Der HAGELIN
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
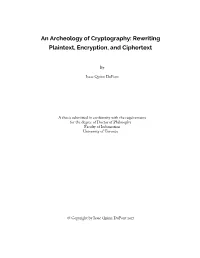
An Archeology of Cryptography: Rewriting Plaintext, Encryption, and Ciphertext
An Archeology of Cryptography: Rewriting Plaintext, Encryption, and Ciphertext By Isaac Quinn DuPont A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Faculty of Information University of Toronto © Copyright by Isaac Quinn DuPont 2017 ii An Archeology of Cryptography: Rewriting Plaintext, Encryption, and Ciphertext Isaac Quinn DuPont Doctor of Philosophy Faculty of Information University of Toronto 2017 Abstract Tis dissertation is an archeological study of cryptography. It questions the validity of thinking about cryptography in familiar, instrumentalist terms, and instead reveals the ways that cryptography can been understood as writing, media, and computation. In this dissertation, I ofer a critique of the prevailing views of cryptography by tracing a number of long overlooked themes in its history, including the development of artifcial languages, machine translation, media, code, notation, silence, and order. Using an archeological method, I detail historical conditions of possibility and the technical a priori of cryptography. Te conditions of possibility are explored in three parts, where I rhetorically rewrite the conventional terms of art, namely, plaintext, encryption, and ciphertext. I argue that plaintext has historically been understood as kind of inscription or form of writing, and has been associated with the development of artifcial languages, and used to analyze and investigate the natural world. I argue that the technical a priori of plaintext, encryption, and ciphertext is constitutive of the syntactic iii and semantic properties detailed in Nelson Goodman’s theory of notation, as described in his Languages of Art. I argue that encryption (and its reverse, decryption) are deterministic modes of transcription, which have historically been thought of as the medium between plaintext and ciphertext. -

Taschenchiffriergerat CD-57 Seite 1
s Taschenchiffriergerat CD-57 Seite 1 Ubung zu Angewandter Systemtheorie Kryptog raph ie SS 1997 - Ubungsleiter^ Dr. Josef Scharinger Taschenchiffriergerat CD-57 Michael Topf, Matr.Nr. 9155665, Kennz. 880 <?- Cm Johannes Kepler Universitat Linz Institut fur Systemwissenschaften Abteilung fur Systemtheorie und Informationstechnik Michael Topf Ubung zu Angewandter Systemtheorie: Kryptographic Seite 2 Taschenchiffriergerat CD-57 I n ha I ts verzei c h n i s I n h a l t s v e r z e i c h n i s 2 Einleitung 3 B o r i s H a g e l i n 3 Die Hagelin M-209 Rotormaschine 3 Das Taschenchiffriergerat CD-57 4 Die Crypto AG 5 Funktionsweise 6 Kryptographisches Prinzip 6 Mechanische Realisierung 7 Black-Box-Betrachtung 7 S c h i e b e r e g i s t e r 8 Ausgangsgewichtung und Summierung. 8 Daten 9 Anfangszustand der Schieberegister (Stiftposition) 9 Gewichtung der Schieberegister-Ausgange (Position der Anschlage) 9 Softwaremodell \\ Quelltext «CD-57.C » \\ Beispiel 12 Schliisseleinstellungen « Schluessel.txt » 12 Primartext « Klartext.txt » 13 Programmaufruf 13 Sekundartext « Geheimtext.txt » 13 Abbildungsverzeichnis 14 Tabellenverzeichnis 14 Quellenverzeichnis , 14 Ubung zu Angewandter Systemtheorie: Kryptographie Michael Topf Taschenchiffriergerat CD-57 Seite 3 Ei nleitu ng Der geistige Vater des betrachtelen Chiffriergerats sowie einer Reihe verwandter Gerate ist der Schwede Boris Hagelin. Daher sollen einleitend er, die Familie der Rotor-Kryptographierer sowie die von ihm gegriindete Schweizer Firma Crypto AG, vorgestellt werden. B o r i s H a g e l i n Boris Hagelin war ein Visionar, der bereits zu seiner Zeit die Probleme der Informationstechnologie erkannte. -
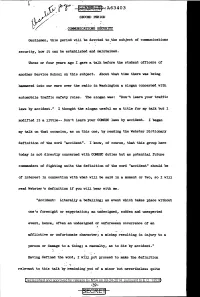
William F. Friedman, Notes and Lectures
f?~~A63403 SECOND PERIOD _ COMMUNICATIONS SECURITY Gentl.emen, this period will be devoted to_the subject of communications security, how it can be establ.ished and maintained. Three or four years ago I gave a talk before the student officers of another Service School. on this subject. About that time there was being hammered into our ears over the radio in Washington a sl.ogan concerned with automobil.e traffic safety rul.es. The sl.oga.n was: "Don't l.earn your traffic l.aws by accident." I thought the sl.ogan useful. as a titl.e for my tal.k but I modified it a l.ittl.e-- Don't l.earn your COMSEC l.aws by accident. I began my tal.k on that occasion, as on this one, by reading the Webster Dictionary definition of the word "accident". I know, of course, that this group here today is not directl.y concerned with COMSEC duties but as potential. future cQJD17!8nders of fighting units the definition of' the word "accident11 shoul.d be of' interest in connection with what wil.l. be said in a moment or two, so I wil.l. read Webster's definition if' you wil.l. bear with me. "Accident: Literally a befal.l.ing,; an event which takes pl.ace without one •s foresight or 7x~ctation,; an undesigned, sudden and unexpected ' event, hence, often an undesigned or unforeseen occurrence of an " affl.ictive or unfortunate character; a mishap resul.ting in injury to a person or damage to a thing; a casual.ty, as to die by accident." . -

SIS and Cipher Machines: 1930 – 1940
SIS and Cipher Machines: 1930 – 1940 John F Dooley Knox College Presented at the 14th Biennial NSA CCH History Symposium, October 2013 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States License. 1 Thursday, November 7, 2013 1 The Results of Friedman’s Training • The initial training regimen as it related to cipher machines was cryptanalytic • But this detailed analysis of the different machine types informed the team’s cryptographic imaginations when it came to creating their own machines 2 Thursday, November 7, 2013 2 The Machines • Wheatstone/Plett Machine • M-94 • AT&T machine • M-138 and M-138-A • Hebern cipher machine • M-209 • Kryha • Red • IT&T (Parker Hitt) • Purple • Engima • SIGABA (M-134 and M-134-C) • B-211(and B-21) 3 Thursday, November 7, 2013 3 The Wheatstone/Plett Machine • polyalphabetic cipher disk with gearing mechanism rotates the inner alphabet. • Plett’s improvement is to add a second key and mixed alphabet to the inner ring. • Friedman broke this in 1918 Principles: (a) The inner workings of a mechanical cryptographic device can be worked out using a paper and pencil analog of the device. (b) if there is a cycle in the mechanical device (say for particular cipher alphabets), then that cycle can be discovered by analysis of the paper and pencil analog. 4 Thursday, November 7, 2013 4 The Army M-94 • Traces its roots back to Jefferson and Bazieres • Used by US Army from 1922 to circa 1942 • 25 mixed alphabets. Disk order is the key. -

A Complete Bibliography of Publications in Cryptologia
A Complete Bibliography of Publications in Cryptologia Nelson H. F. Beebe University of Utah Department of Mathematics, 110 LCB 155 S 1400 E RM 233 Salt Lake City, UT 84112-0090 USA Tel: +1 801 581 5254 FAX: +1 801 581 4148 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] (Internet) WWW URL: http://www.math.utah.edu/~beebe/ 04 September 2021 Version 3.64 Title word cross-reference 10016-8810 [?, ?]. 1221 [?]. 125 [?]. 15.00/$23.60.0 [?]. 15th [?, ?]. 16th [?]. 17-18 [?]. 18 [?]. 180-4 [?]. 1812 [?]. 18th (t; m)[?]. (t; n)[?, ?]. $10.00 [?]. $12.00 [?, ?, ?, ?, ?]. 18th-Century [?]. 1930s [?]. [?]. 128 [?]. $139.99 [?]. $15.00 [?]. $16.95 1939 [?]. 1940 [?, ?]. 1940s [?]. 1941 [?]. [?]. $16.96 [?]. $18.95 [?]. $24.00 [?]. 1942 [?]. 1943 [?]. 1945 [?, ?, ?, ?, ?]. $24.00/$34 [?]. $24.95 [?, ?]. $26.95 [?]. 1946 [?, ?]. 1950s [?]. 1970s [?]. 1980s [?]. $29.95 [?]. $30.95 [?]. $39 [?]. $43.39 [?]. 1989 [?]. 19th [?, ?]. $45.00 [?]. $5.95 [?]. $54.00 [?]. $54.95 [?]. $54.99 [?]. $6.50 [?]. $6.95 [?]. $69.00 2 [?, ?]. 200/220 [?]. 2000 [?]. 2004 [?, ?]. [?]. $69.95 [?]. $75.00 [?]. $89.95 [?]. th 2008 [?]. 2009 [?]. 2011 [?]. 2013 [?, ?]. [?]. A [?]. A3 [?, ?]. χ [?]. H [?]. k [?, ?]. M 2014 [?]. 2017 [?]. 2019 [?]. 20755-6886 [?, ?]. M 3 [?]. n [?, ?, ?]. [?]. 209 [?, ?, ?, ?, ?, ?]. 20th [?]. 21 [?]. 22 [?]. 220 [?]. 24-Hour [?, ?, ?]. 25 [?, ?]. -Bit [?]. -out-of- [?, ?]. -tests [?]. 25.00/$39.30 [?]. 25.00/839.30 [?]. 25A1 [?]. 25B [?]. 26 [?, ?]. 28147 [?]. 28147-89 000 [?]. 01Q [?, ?]. [?]. 285 [?]. 294 [?]. 2in [?, ?]. 2nd [?, ?, ?, ?]. 1 [?, ?, ?, ?]. 1-4398-1763-4 [?]. 1/2in [?, ?]. 10 [?]. 100 [?]. 10011-4211 [?]. 3 [?, ?, ?, ?]. 3/4in [?, ?]. 30 [?]. 310 1 2 [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]. 312 [?]. 325 [?]. 3336 [?, ?, ?, ?, ?, ?]. affine [?]. [?]. 35 [?]. 36 [?]. 3rd [?]. Afluisterstation [?, ?]. After [?]. Aftermath [?]. Again [?, ?]. Against 4 [?]. 40 [?]. 44 [?]. 45 [?]. 45th [?]. 47 [?]. [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]. Age 4in [?, ?]. [?, ?]. Agencies [?]. Agency [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]. -
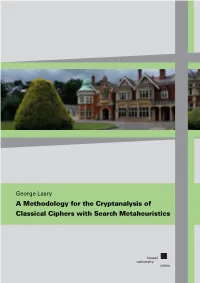
A Methodology for the Cryptanalysis of Classical Ciphers with Search
phers with Search Metaheuristics George Lasry A Methodology for the Cryptanalysis of A Methodology for the Cryptanalysis of Classical Ci Classical Ciphers with Search Metaheuristics ISBN 978-3-7376-0458-1 kassel university 9 783737 604581 George Lasry press kassel kassel university press !"# $ % !&' (&)) )*) # + ,)&) - .# +,)/ & + 0123405 / ! & ' & ' & ' 6 # 7 + ))) 8)+$ 9"#)9& )3405 7/':5;.<.5<51.4=>;.0(* 7/':5;.<.5<51.4=>:.;(.* &27++ ?)! ) 04)0:300 $",:5;<5<514=>:; "@'++ . #) +++4443.=4=>:3 '340;9 # !B9$ ) ). ) ,! “After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.” Nelson Mandela Abstract Cryptography, the art and science of creating secret codes, and cryptanalysis, the art and science of breaking secret codes, underwent a similar and parallel course during history. Both fields evolved from manual encryption methods and manual codebreaking techniques, to cipher ma- chines and codebreaking machines in the first half of the 20th century, and finally to computer- based encryption and cryptanalysis from the second half of the 20th century. However, despite the advent of modern computing technology, some of the more challenging classical cipher systems and machines have not yet been successfully cryptanalyzed. For others, cryptanalytic methods exist, but only for special and advantageous cases, such as when large amounts of ciphertext are available. Starting from the 1990s, local search metaheuristics such as hill climbing, genetic algorithms, and simulated annealing have been employed, and in some cases, successfully, for the cryptanal- ysis of several classical ciphers. In most cases, however, results were mixed, and the application of such methods rather limited in their scope and performance. In this work, a robust framework and methodology for the cryptanalysis of classical ciphers using local search metaheuristics, mainly hill climbing and simulated annealing, is described. -

Ciphertext-Only Cryptanalysis of Hagelin M-209 Pins and Lugs
Ciphertext-Only Cryptanalysis of Hagelin M-209 Pins and Lugs George Lasry Nils Kopal Mishmar Hayarden 5 University of Kassel Givataim, 5358205 Israel Pfannkuchstr. 1 [email protected] 34121 Kassel, Germany [email protected] Arno Wacker University of Kassel Pfannkuchstr. 1 34121 Kassel, Germany [email protected] Abstract The Hagelin M-209 was a mechanical encryption device used by the US Army during World War 2 and the Korean War, as well as by other armies and in embassy settings. In this paper, we present a 4-stage hillclimbing algorithm for recovering the full key settings from ciphertext only. The two first stages are based on a divide-and-conquer approach developed by Geoff Sullivan. In our performance evaluation, we show that our method is able to recover key settings from messages as short as 750 letters, compared to 2 000 − 2 500 letters with prior methods. With this method, we solved several M-209 ciphertext-only challenges, including the final exercises in W. Barker's 1977 book, Cryptanalysis of the Hagelin Cryptograph. Keywords: Hagelin, M-209, Hillclimbing, Ciphertext-Only Attack, Cryptanalysis, Crypto- graphic Challenge, NSA 1 Introduction The trigger for our research was an intriguing story published by Dennis Ritchie in 2000 [19]. The story also appeared in Cyberpunk, Outlaws and Hackers on The Computer Frontier by Katie Hafner and John Markoff in 1991 [9]. Dennis Ritchie (1941-2011) is best known as the inventor of the UNIX operating system (together with Ken Thomson), and of the C programming language. According to his account, in the late 1970s, James Reeds, Robert Morris and Dennis Ritchie developed a ciphertext- only method for recovering keys from Hagelin M-209 messages. -

Docid: 4235233 Unclassified
DOCID: 4235233 UNCLASSIFIED OHNR: OH-2013-86 DOI: Summer 1966 TRSID: rkkunde//ragenti DTR: 19 November 2013 QCSID: dpcoole Text Review: 23 Jan 2014 Text w/Tape: INAME: CALLIMAHOS, Lambros D. IPLACE: NSA, Fort Meade, Maryland IVIEWER: Unidentified Moderator Moderator: This lecture is part of the 1966 Summer Institute for Mathematics and ... Mathematicians and Linguists. These people are not the only ones who are here this summer. But these are, for the most part, people who have come to NSA for the first summer and are either juniors or have just graduated. Some of them are graduate students. Some of them have their master's degree. Other interested persons have been invited so that we won't let any of this cryptologic knowledge go to waste. I expect that this gathering this morning reminds Cal((limahos)) of his days back in the '30s when he used to pack them in with his flute. ((Audience chuckles.)) To get back to the Summer Institute, we have 24 mathematicians, 17 linguists from 24 different colleges and universities. We have four from Harvard; one from Maryland; three from Michigan State; four from Middlebury; one from Hampton Institute; two from Wisconsin and two from Vermont; one from Michigan Tech; four from Mary Washington; two from Yale; one from Southern California; one from Cal Tech; one from Brown; one from MIT; one from Mount Holyoke; one from Lehigh; one from Georgetown, two from Indiana; one from Arizona-and you will notice the Dr. Sinkov influence there; one from Pennsylvania; one from Eastern Illinois; one from Iowa; two from Connecticut; and one from Smith. -

Cryptanalysis of Typex
San Jose State University SJSU ScholarWorks Master's Projects Master's Theses and Graduate Research Spring 2012 CRYPTANALYSIS OF TYPEX Kelly Chang San Jose State University Follow this and additional works at: https://scholarworks.sjsu.edu/etd_projects Part of the Computer Sciences Commons Recommended Citation Chang, Kelly, "CRYPTANALYSIS OF TYPEX" (2012). Master's Projects. 235. DOI: https://doi.org/10.31979/etd.nak3-5avq https://scholarworks.sjsu.edu/etd_projects/235 This Master's Project is brought to you for free and open access by the Master's Theses and Graduate Research at SJSU ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Master's Projects by an authorized administrator of SJSU ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. CRYPTANALYSIS OF TYPEX A Project Presented to The Faculty of the Department of Computer Science San Jose State University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science by Kelly Chang May 2012 c 2012 Kelly Chang ALL RIGHTS RESERVED The Designated Project Committee Approves the Project Titled CRYPTANALYSIS OF TYPEX by Kelly Chang APPROVED FOR THE DEPARTMENTS OF COMPUTER SCIENCE SAN JOSE STATE UNIVERSITY May 2012 Dr. Mark Stamp Department of Computer Science Dr. Christopher Pollett Department of Computer Science Dr. Richard M. Low Department of Mathematics ABSTRACT Cryptanalysis of Typex by Kelly Chang Rotor cipher machines played a large role in World War II: Germany used Enigma; America created Sigaba; Britain developed Typex. The breaking of Enigma by Polish and (later) British cryptanalysts had a huge impact on the war. Despite be- ing based on the commercial version of the Enigma, there is no documented successful attack on Typex during its time in service. -

Bart Wessel, the Hagelin Cryptographers C-52 and CX-52
February 24, 2021 The Hagelin Cryptographers C-52 and CX-52 V1.01 Update March 12, 2021 The Hagelin Cryptographers C‐52 and CX‐52 Bart Wessel Keywords: Hagelin; Crypto AG; Cryptoteknik; C-52; CX-52 Abstract While the C-52 and CX-52 devices enter the open market and are exhibited in museums, it is hard to the untrained eye tell the differences. There is a lot of confusion, and half-truths muddle the waters even further. It turns out that there is only a limited number of standard configurations of C-52 and CX-52 machines. These ‘models’ are described in detail, to enable the reader to identify machines he/she comes across. All the configurable components are described to aid in the understanding of their differences and of the way the devices work. The C-52 is usually cryptographically limited compared to the CX-52 – although an equally limited CX-52 is entirely possible! It all seems to come down to marketing and willingness of Hagelin to sell a certain cryptologic complexity to a particular customer – with the NSA looking over his shoulder. The cryptologic quality of the various models is not explained here in mathematical detail. The author hopes to have presented a defining framework of configurable variables which can be built upon by a more crypto-analytical minded author. Introduction The Hagelin C-52 and CX-52 are deceivingly simple looking mechanical cryptographic machines that date from the early 1950’s and are familiar to many cryptography enthusiasts, collectors and museums. Crypto AG, owned by Boris Hagelin1, secretly created machines that differ in internal configuration without the customer being aware. -
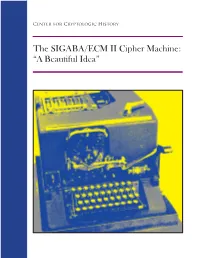
The SIGABA / ECM II Cipher Machine : “A Beautiful Idea”
Center for Cryptologic History The SIGABA / ECM II Cipher Machine : “A Beautiful Idea” This publication presents a historical perspective for informational and educational purposes, is the result of independent research, and does not necessarily reflect a position of NSA/CSS or any other U.S. government entity. This publication is distributed free by the National Security Agency. If you would like additional copies, please e-mail [email protected] or write to: Center for Cryptologic History National Security Agency 9800 Savage Road, Suite 6886 Fort George G. Meade, MD 20755 Timothy Mucklow was a senior historian on the staff of the Center for Cryptologic History fol- lowing a long career in information assurance at NSA and with the Air Force. After a decade in aca- demia, he served as a military historian at the wing, division, and major command levels and produced a series of monographs and articles on such topics as information assurance, telecommunications and computers, and national defense issues, and has offered IA seminars at military facilities around the world. He received his Ph.D. in 1982. He retired from the CCH in 2013. Acknowledgments. The Center for Cryptologic History is grateful to Dr. Craig Bauer, professor of mathematics at York College of Pennsylvania and editor-in-chief of the journal Cryptologia, for his assistance with this project, and to LeeAnn Tallman for earlier research. The SIGABA / ECM II Cipher Machine: “A Beautiful Idea” Timothy J. Mucklow National Security Agency Center for Cryptologic History 2015 Contents Introduction ....................................................................................... 1 And Hebern Saw the Wheel .................................................................... 2 Deus ex Machine ................................................................................. 5 Rowlett’s Epiphany ............................................................................. -

Privacy and Authentication: an Introduction to Cryptography
PROCEEDINGS OF THE IEEE, VOL. 67, NO. 3, MARCH 1979 397 Privacy and Authentication: An Introduction to Cryptography Invited Paper Akmct-This paper plesenfs a tutorial introductionto contempomy Data communications are even more vulnerable than voice ayptography. The basic information li~eoreticand computational telephony because, with voice the eavesdropper lacks the properties of dadd and modern cryptographic systemsare presented, ability to discern the content of a spoken message, unless a fobwed by uyptanalytic examination of seved importantsystems costly humanmonitor is employed,but if theintercepted and an exlminrtion of the apptiation of uyptography to the security of timeduring systems and computer networks. The paper concludes material is in computer readable form (e.g., Telex), no such with I guide to the cryptographic literature. limitation is imposed. It has been reported [3, p. 7651 that for some years the National Security Agency (NSA), inits operation I.INTRODUCTION Shamrock, scanned all telegraph and Telex messages passing NTIL RECENTLY, cryptography has been of interest in and outof the United States for keywords. primarily to the military and diplomatic communities. The cost of eavesdropping should continue to decline with Private individuals and even commercialorganizations time. There is at present extensive research into speech recog- uhave rarely considered it necessary to resort to encryption for nition [4], [5], and many communications will soon be carried the protection of their communications, and those that have, on digitized packet-switched networks[6]. Electronic mail have seldom done so withparticular care. Today, however, and Electronic Funds Transfer (EFT) are being developed to several factors have combined to stimulate great interest in replace their present day counterparts, and telephone verifi- commercial applications.