SB-135-2018-Gesamtdatei.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cybernetique D'une Theorie De La Connaissance
Trivium Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales - Deutsch-französische Zeitschrift für Geistes- und Sozialwissenschaften 20 | 2015 Réflexivité et Système. Le débat sur l'ordre et l'auto- organisation dans les années 1970 Cybernetique d’une theorie de la connaissance Heinz von Foerster Traducteur : Didier Renault Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/trivium/5178 ISSN : 1963-1820 Éditeur Les éditions de la Maison des sciences de l’Homme Référence électronique Heinz von Foerster, « Cybernetique d’une theorie de la connaissance », Trivium [En ligne], 20 | 2015, mis en ligne le 11 juin 2015, consulté le 08 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/ trivium/5178 Ce document a été généré automatiquement le 8 septembre 2020. Les contenus des la revue Trivium sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Cybernetique d’une theorie de la connaissance 1 Cybernetique d’une theorie de la connaissance Heinz von Foerster Traduction : Didier Renault NOTE DE L’ÉDITEUR Nous remercions la maison d’édition Suhrkamp de nous avoir accordé l’autorisation de traduire ce texte pour le présent numéro. Wir danken dem Suhrkamp Verlag für die freundliche Genehmigung, diesen Artikel in französischer Übersetzung zu publizieren. 1 Lorsque j’ai accepté de prononcer ici ma conférence1 en allemand, je ne soupçonnais pas les difficultés auxquelles je me verrais confronté. Au cours des vingt dernières années, dans mon activité scientifique, j’ai exclusivement pensé et parlé en anglais. Nombre de concepts et de résultats de recherches ont été baptisés en anglais lors de leur naissance, et se montrent rétifs à toute traduction. -
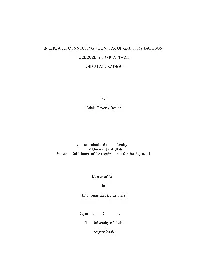
Connecting the Work of Gregory Bateson, Deleuze And
INTERFACEINTERFACE:: CONNECTINGCONNECTING THETHE WORKWORK OOFF GREGORYGREGORY BATESON,BATESON, DELEUZDELEUZEE ANANDD GUATTARI,GUATTARI, ANANDD ALAIALAINN BADIOUBADIOU bbyy AdeleAdele HavertyHaverty BealerBealer A thesithesiss submittedsubmitted ttoo ththee facultyfaculty ofof TheThe UniversitUniversityy ooff UtahUtah iinn partialpartial fulfillmentfulfillment ofof thethe requirementrequirementss forfor ththee degreedegree ofof MasteMasterr ooff ArtsArts IIIin EnvironmentaEnvironmentall HumanitiesHumanities DepartmenDepartmentt ooff CommunicationCommunication TheThe UniversitUniversityy ooff UtahUtah AugustAugust 20082008 CopyrighCopyrightt © AdelAdelee HavertHavertyy BealeBealerr 20082008 AlAlll RightRightss ReservedReserved THE UNIVERSITY OF UTAH GRADUATE SCHOOL SUPERVISORY COMMITTEE APPROVAL of a thesis submitted by Adele Haverty Bealer This thesis has been read by each member of the following supervisory committee and by majority vote has been found to be satisfactory. inJbw&& --------:=:---.... '"'" ceHeonard C. Hawes r 7 �__ __-7) THE UNIVERSITY OF UTAH GRADUATE SCHOOL FINAL READING APPROVAL To the GraduateCouncil of the University of Utah: [ have read the thesis of Adele Haverty Bealer in its final form and have found that (1) its format, citations, and bibliographic style are consistent and acceptable; (2) its illustrative materials including figures, tables, and charts are in place; and (3) the final manuscript is satisfactory to the supervisory committee and is ready for submission toThe Graduate School. �--- pate , Chair: SupervisoryCommittee -

There Is No Interface (Without a User). a Cybernetic Perspective on Interaction
INTERFACE CRITIQUE JOURNAL – VOL. I – 2018 THERE IS NO INTERFACE (WITHOUT A USER). A CYBERNETIC PERSPECTIVE ON INTERACTION By Lasse Scherffig “Interaction is seen as a one-way street, conveying a design model to a user, who is acting by that model either because they adapted to it, or because the model replicates their given structure. This is the cognitivist heritage of the HCI discourse responsible for the idea that interfaces can actually be designed.” Suggested citation: Scherffig, Lasse (2018). “There is no Interface (without a User). A cybernetic Perspective on Interaction.” In: Interface Critique Journal Vol.1. Eds. Florian Hadler, Alice Soiné, Daniel Irrgang DOI: 10.11588/ic.2018.0.44739 This article is released under a Creative Commons license (CC BY 4.0). 58 SCHERFFIG: THERE IS NO INTERFACE The interface in itself does not exist. rected development from the compu- This is not to say that any phenome- ting machinery of the past towards a non must be perceived in order to ex- future of interaction. ist, but rather that interfaces quite This trajectory constitutes the literally only come into being if they standard account of the history of in- are used. They are effects of interac- teraction. Often the field is seen as tion and thus they are ultimately cre- following a teleological development ated by their users. of progress, during which computers Of course, academic and pro- became more and more interactive, fessional disciplines like human- and interaction became more intui- computer interaction and interaction tive, rich, and natural. This develop- design assume the opposite: namely ment is often explicated as a that interfaces are designed (and ex- genealogy. -

Metatemas Libros Para Pensar La Ciencia Colección Dirigida Por Jorge Wagensberg
Metatemas Libros para pensar la ciencia Colección dirigida por Jorge Wagensberg Al cuidado del equipo científico del Museu de la Ciencia de la Fundació "la Caixa" * Alef, símbolo de los números transfinitos de Cantor Richard Dawkins DESTEJIENDO EL ARCO IRIS Ciencia, ilusión, y el deseo de asombro Traducción de Joandoménec Ros Título original: Unweaving the Rainbow 1." edición: enero 2000 © Richard Dawkins, 1998 © de la traducción: Joandoménec Ros, 2000 Diseño de la cubierta: BM Reservados todos los derechos de esta edición para Tusquets Editores, S.A. - Cesare Cantü, 8 - 08023 Barcelona ISBN: 84-8310-669-8 Depósito legal: B. 710-2000 Fotocomposición: David Pablo Impreso sobre papel Offset-F Crudo de Papelera del Leizarán, S.A. Liberdúplex, S.L. - Constitución, 19 - 08014 Barcelona Impreso en España 9 Prefacio 17 1. La anestesia de la familiaridad 31 2. El salón de los duques 55 3. Códigos de barras en las estrellas 83 4. Códigos de barras en el aire 99 5. Códigos de barras en el estrado 131 6. Embaucados por la fantasía de las hadas 163 7. Destejiendo lo sobrenatural 197 8. Enormes símbolos nebulosos de un romance elevado 227 9. El cooperador egoísta 251 10. El libro genético de los muertos 273 11. Volviendo a tejer el mundo 303 12. El globo de la mente Apéndices 333 Bibliografía 343 índice onomástico y de materias Para Lalla Prefacio Un editor extranjero de mi primer libro {El gen egoísta, 1976) me confesó que después de leerlo no pudo dormir durante tres noches; hasta tal punto llegó a perturbarlo su, para él, frío y desolado mensaje. -

Enacting Virtual Reality
MediaTropes eJournal Vol VI, No 1 (2016): 1–29 ISSN 1913-6005 MOVING INTO VIEW: ENACTING VIRTUAL REALITY LASSE SCHERFFIG Introduction: De-emphasizing Visuality In the 1960s, the Brazilian artist Lygia Clark built a series of goggles and gloves exploring the human sensorium. These devices “hold small movable mirrors in front of the eyes, juxtaposing and fracturing reflections of the self and the surrounding world.”1 As art objects designed to be worn and used they form part of a practice that was grounded in the visual arts and constructivist movements of post-war Brazil,2 yet became increasingly concerned with “de- emphasizing visuality.”3 Having already produced reductive and geometric paintings, Clark experimented with folding the plane of the canvas into the third dimension, creating “hinged sculptures that combined geometric shapes and organic movements.”4 This work resulted in Bichos (animals, or beasts): a series of three-dimensional objects made from geometric surfaces that “needed to be manipulated by the viewer to reveal their organic nature and unfold their multiple configurations.” The Bichos, with a focus on interactive exploration of formal configurations, were then followed by Clark’s work on goggles and gloves focusing on the interaction of perception and self-motion. In other words, “Clark began with the eye, but the entire body began to make itself felt early on.” Her “devices” thus aimed to “dissolve the visual sense into an awareness of the body.”5 These works visually paralleled the first head-mounted display (HMD) built by Ivan Sutherland around the same time, including subsequent 1 Simone Osthoff, “Lygia Clark and Hélio Oiticica: A Legacy of Interactivity and Participation for a Telematic Future,” Leonardo 30, no. -

Systemwissenschaft
Systemwissenschaft Autor(en): Müller, Roland Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizer Monatshefte : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur Band (Jahr): 55 (1975-1976) Heft 4: Wird die Schweiz unregierbar? PDF erstellt am: 04.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-163088 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch -

Bibliographies
Bibliographies This is work in progress, and although it is something of a labor of love, it is also extremely time-consuming. I am constantly coming upon notes and references to various books or essays that had slipped my mind as sources of ideas and inspiration. This only one of several bibliographies I eventually hope to include, and it is only a beginning. Annotated Bibliography Ausubel, Kenny. Ed. Nature's Operating Instructions: The True Biotechnologies. San Francisco: Sierra Club Books, 2004. This collection of essays on developing sustainable technologies and using them sustainably includes sections that explore the practical, philosophical, and spiritual aspects of addressing modern-day problems and trying to reverse or mitigate their effects. Topics range from biomimicry to agribusiness to bioengineering, and the necessity of finding and using new models for economics that acknowledge the interdependence of human beings and the natural world. Contributors include Paul Hawken, Wes Jackson, Michael Pollan, Amory Lovins and Hunter Lovins, David Orr, and Terry Tempest Williams. The link is to his bio on the website for Bioneers, which was kindly (and enthusiastically) suggested to me by one of my fellow pubmates on the Serenity forum. Bateson, Mary Catherine. Our Own Metaphor: A Personal Account of a Conference on the Effects of Conscious Purpose on Human Adaptation. Washington, D. C.: Smithsonian Institution Press, 1991. The conference referred to took place in 1968, and was organized by anthropologist and psychiatrist Gregory -

Aerospace Medicine and Biology
NASASP-7011 (351) July 1991 AEROSPACE MEDICINE AND BIOLOGY (NASA-SP-701H351)) AEROSPACE MEDICINE AND N91-27756 BIOLOGY: A CONTINUING BIBLIOGRAPHY WITH INDEXES (SUPPLEMENT 351) (NASA) 92 p CSCL 06E Unclas 00/5? 0030329 A CONTINUING BIBLIOGRAPHY WITH INDEXES NASASP-7011 (351) July 1991 AEROSPACE MEDICINE AND BIOLOGY A CONTINUING BIBLIOGRAPHY WITH INDEXES National Aeronautics and Space Administration Office of Management NASA Scientific and Technical Information Program Washington, DC 1991 INTRODUCTION This issue of Aerospace Medicine and Biology (NASA SP-7011) lists 255 reports, articles and other documents originally announced in June 1991 in Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) or in International Aerospace Abstracts (IAA). The first issue of Aerospace Medicine and Biology was published in July 1964. Accession numbers cited in this issue are: STAR (N-10000 Series) N91-19024 - N91-21058 IAA (A-10000 Series) A91-28401 - A91-32448 In its subject coverage, Aerospace Medicine and Biology concentrates on the biological, physiological, psychological, and environmental effects to which humans are subjected during and following simu- lated or actual .flight in the Earth's atmosphere or in interplanetary space. References describing similar effects on biological organisms of lower order are also included. Such related topics as sanitary problems, pharmacology, toxicology, safety and survival, life support systems, exobiology, and person- nel factors receive appropriate attention. Applied research receives the most emphasis, but references to fundamental studies and theoretical principles related to experimental development also qualify for inclusion. Each entry in the publication consists of a standard bibliographic citation accompanied in most cases by an abstract. The listing of the entries is arranged by STAR categories 51 through 55, the Life Sciences division. -

Understanding Understanding : Essays on Cybernetics and Cognition
Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition Heinz von Foerster Springer UECPR 11/9/02 12:11 PM Page i Heinz von Foerster (German spelling: Heinz von Förster; November 13, 1911, Vienna – October 2, 2002, Pescadero, California) was an Austrian American scientist combining physics and philosophy, and widely attributed as the originator of Second-order cybernetics. He was twice a Guggenheim fellow (1956–57 and 1963–64) and also was a fellow of the American Association for the Advancement of Science, 1980. He is well known for his 1960 Doomsday equation formula published in Science predicting future population growth. UECPR 11/9/02 12:11 PM Page ii Springer New York Berlin Heidelberg Hong Kong London Milan Paris Tokyo UECPR 11/9/02 12:11 PM Page iii Heinz von Foerster Understanding Understanding Essays on Cybernetics and Cognition With 122 Illustrations 1 3 UECPR 11/9/02 12:11 PM Page iv Heinz von Foerster Biological Computer Laboratory, Emeritus University of Illinois Urbana, IL 61801 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data von Foerster, Heinz, 1911– Understanding understanding: essays on cybernetics and cognition / Heinz von Foerster. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-387-95392-2 (acid-free paper) 1. Cybernetics. 2. Cognition. I. Title. Q315.5 .V64 2002 003¢.5—dc21 2001057676 ISBN 0-387-95392-2 Printed on acid-free paper. © 2003 Springer-Verlag New York, Inc. All rights reserved. This work may not be translated or copied in whole or in part without the written permission of the publisher (Springer-Verlag New York, Inc., 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010, USA), except for brief excerpts in connection with reviews or scholarly analy- sis. -

Trivium, 20 | 2015, « Réflexivité Et Système
Trivium Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales - Deutsch-französische Zeitschrift für Geistes- und Sozialwissenschaften 20 | 2015 Réflexivité et Système. Le débat sur l'ordre et l'auto-organisation dans les années 1970 Reflexivität und System. Die Debatte über Ordnung und Selbstorganisation in den 1970er Jahren Elena Esposito et Erich Hörl (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/trivium/5126 DOI : 10.4000/trivium.5126 ISSN : 1963-1820 Éditeur Les éditions de la Maison des sciences de l’Homme Référence électronique Elena Esposito et Erich Hörl (dir.), Trivium, 20 | 2015, « Réflexivité et Système. Le débat sur l'ordre et l'auto-organisation dans les années 1970 » [En ligne], mis en ligne le 16 juin 2015, consulté le 27 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/trivium/5126 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ trivium.5126 Ce document a été généré automatiquement le 27 septembre 2020. Les contenus des la revue Trivium sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. 1 De nombreux chercheurs francophones et germanophones ont participé dans les années 1970 à des discussions intenses et constructives sur les conséquences épistémologiques de la cybernétique. Les textes réunis dans ce dossier reflètent ce débat ; ils mettent l’accent sur les points d’intersection de problématiques qui sont devenus dans les années ultérieures, des axes importants de la recherche en sciences sociales et qui ont alimenté le travail théorique et conceptuel des sciences de l’homme et de la société. Pour quelles raisons cette collaboration si fructueuse à l’époque est-elle finalement tombée dans un oubli quasi complet ? La traduction de quelques contributions centrales des débats des années 1970 pourrait inciter à revenir, dans une perspective renouvelée, sur les discussions d’alors. -

The Science, Language, and Epistemology of Gregory Bateson
Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 6-1-2020 1:30 PM Resonance, a step towards a fluency for complexity: The science, language, and epistemology of Gregory Bateson Won Jeon, The University of Western Ontario Supervisor: Darnell, Regna, The University of Western Ontario A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the Master of Arts degree in Theory and Criticism © Won Jeon 2020 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Philosophy of Science Commons, and the Theory and Philosophy Commons Recommended Citation Jeon, Won, "Resonance, a step towards a fluency for complexity: The science, language, and epistemology of Gregory Bateson" (2020). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 7034. https://ir.lib.uwo.ca/etd/7034 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. Abstract This thesis confronts the urgency with which new language and vocabulary is required to move beyond linear assumptions in mainstream science and humanities, as well as global policy-making. I examine Gregory Bateson’s body of work in history and philosophy of science, psychiatry and psychotherapy, anthropology, biology and ecology designed to communicate the necessarily interdisciplinary consideration for a nonlinear and recursive investigation of the self, other, and environment. Such intellectual forays cannot dismissed as non-scientific. I offer definitions and contextualizations of key terms derived from cybernetics, new materialisms, and posthumanism (such as emergence, process, paradox, metaphor, fractality) to speak about the ramifying intricacies and pathologies in processes of knowing at various different scales. -
On the Role of Sensory Cancellation and Corollary Discharge in Neural Coding and Behavior
On the Role of Sensory Cancellation and Corollary Discharge in Neural Coding and Behavior Armen Enikolopov Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2018 © 2018 Armen Enikolopov All Rights Reserved ABSTRACT On the Role of Sensory Cancellation and Corollary Discharge in Neural Coding and Behavior Armen Enikolopov Studies of cerebellum-like circuits in fish have demonstrated that synaptic plasticity shapes the motor corollary discharge responses of granule cells into highly-specific predictions of self- generated sensory input. However, the functional significance of such predictions, known as negative images, has not been directly tested. Here we provide evidence for improvements in neural coding and behavioral detection of prey-like stimuli due to negative images. In addition, we find that manipulating synaptic plasticity leads to specific changes in circuit output that disrupt neural coding and detection of prey-like stimuli. These results link synaptic plasticity, neural coding, and behavior and also provide a circuit-level account of how combining external sensory input with internally-generated predictions enhances sensory processing. In addition, the mammalian dorsal cochlear nucleus (DCN) integrates auditory nerve input with a diverse array of sensory and motor signals processed within circuity similar to the cerebellum. Yet how the DCN contributes to early auditory processing has been a longstanding puzzle. Using electrophysiological recordings in mice during licking behavior we show that DCN neurons are largely unaffected by self-generated sounds while remaining sensitive to external acoustic stimuli. Recordings in deafened mice, together with neural activity manipulations, indicate that self-generated sounds are cancelled by non-auditory signals conveyed by mossy fibers.