M&Z 1/05 Kern/V06/3.3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mitgemacht, Weitergemacht, Zugemacht Zum NS-Erbe Der Kommunikationswissenschaft in Deutschland
Horst Pöttker, Dortmund Mitgemacht, weitergemacht, zugemacht Zum NS-Erbe der Kommunikationswissenschaft in Deutschland Mediziner, Juristen, ja sogar Historiker und Journalisten (4; 5; 6;) bemühen sich mittlerweile, ihrer NS-Vergangenheit offen ins Auge zu blicken. Ausgerechnet in der deutschen Kommunikationswissenschaft, dem Prinzip Öffentlichkeit eigent- lich besonders verpflichtet, ist davon bisher wenig zu spüren. Über dunkle Fle- cken redet man hier immer noch am liebsten hinter vorgehaltener Hand - das allerdings ausgiebig. Der folgende Beitrag konzentriert sich auf wenige weder irrelevante noch untypische Beispiele. Vor 1933 begrenzte Vielfalt In ihrer Gründungsphase hatten in der deutschen Zeitungswissenschaft sowohl konservative wie liberale und sogar linke Positionen Platz. In Leipzig, wo der sozialdemokratisch orientierte Nationalökonom Karl Bücher 1916 das erste In- stitut für Zeitungskunde an einer deutschen Universität gegründet hatte, wurde zehn Jahre später der Liberale Erich Everth als erster Ordinarius für dieses Fach berufen, während sich kurz darauf in Berlin mit der Berufung Emil Dovifats auf den neuen Lehrstuhl für Zeitungswissenschaft und gleichzeitig zum Direktor des Deutschen Instituts für Zeitungskunde eine katholisch-konservative Ten- denz durchsetzte (2, 105-141). Wer als Zeitungswissenschaftler jüdischer Her- kunft war, hatte freilich schon in den 20er Jahren wenig Chancen. Otto Groth hat auch vor 1933 keinen Lehrstuhl bekommen, obwohl seine vierbändige Mo- nographie "Die Zeitung" die fachliche Leistung jener Epoche war. Emil Dovifat: Die Zeitung als Massenführungsmittel Für die Zeitung sind die Führungsgrundsätze der Masse von Wichtigkeit, denn sie ist ein Massenführungsmittel, dem freilich die Aufgabe gestellt ist, den neu- en Bindungen Beistand zu leisten, die aus der Masse Volk zu machen berufen sind. Gehorcht die Masse z. B. -

Journalism Research 3/2020 183 Editorial
Journalism Research Edited by Bernhard Debatin, Gabriele Hooffacker, Horst Pöttker, Tanjev Schultz and Martina Thiele 2020 | Vol. 3 (3) www.journalistik.online 183 Editorial Reviews Research Paper 259 Michael Haller, Walter Hömberg (Eds.): »Ich lass mir den Mund 186 Anna Spatzenegger nicht verbieten!«. Journalisten als Social media as a source for Wegbereiter der Pressefreiheit und journalistic work Demokratie [»I won’t be silenced!« An investigation into the influence of Journalists as pioneers of press freedom Facebook and Twitter posts by politicians and democracy] on reporting in daily newspapers Reviewed by Hans-Dieter Kübler 203 Horst Pöttker 262 Lauren Lucia Seywald: Investigativer For historical reasons Journalismus in Österreich. Geschichte, On the lack of acceptance of Gegenwart und Zukunft einer journalism studies in Germany Berichterstattungsform [Investigative journalism in Austria. History, present and Essay future of a form of reporting] Reviewed by Boris Romahn 220 Peter Welchering Opinion or attitude 265 Margreth Lünenborg, Saskia Sell (Eds.): Clarification in a journalistic debate on Politischer Journalismus im Fokus der values and knowledge Journalistik [Political journalism in the focus of journalism studies] Debate Rezensiert von Roger Blum 235 Gabriele Hooffacker 267 Patricia Müller: Social Media und Copycats or integrative innovators? Wissensklüfte. Nachrichtennutzung A proposal for the assessment of und politische Informiertheit junger »alternative media« Menschen [Social media and knowledge gaps. News use and political awareness 247 Michael Meyen among young people] The mainstream media are the problem Reviewed by Hans-Dieter Kübler Why the counter-discourse might help journalism HERBERT VON HALEM VERLAG H H Legal Notice Journalism Research (Journalistik. Zeitschrift für Journalismusforschung) 2020, Vol. 3 (3) http://www.journalistik.online Editorial Board Publisher Bernhard Debatin, Ohio University, Herbert von Halem Verlagsgesellschaft Athens (OH) mbH & Co. -
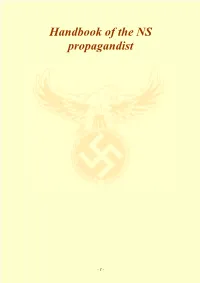
Handbook of the NS Propagandist
Handbook of the NS propagandist - 1 - Context: Propaganda Articles Pre - 1933 1. "Propaganda": A 1927 periodical discussing guidebook for Nazi problems speakers had with propagandists. local group leaders. 2. Modern Political Propaganda: 5. Rural Propaganda: A 1932 A 1930 pamphlet for Nazi piece on how to reach the propagandists. countryside. 3. "How I Treat a Local Group 6. An Analysis of Nazi Leader": a 1931 piece from Propaganda: Written after the the Nazi monthly for July 1932 Reichstag election. propagandists, discussing 7. Reaching the Marxists: A late problems in the propaganda 1932 essay discussing the system. difficulties in appealing to 4. "How I Treat a Speaker": A Marxists. 1931 piece from the same Propaganda Articles 1933-1945 1. "14 Days in a Gau Propaganda 7. "The Reichspropaganda- Office": How a Nazi regional leitung ": A 1936 article on propaganda office functioned the Nazi Party's Central in 1934. Propaganda Office. 2. "The Propaganda Warden": 8. "Political Propaganda as a The importance of lower-level Moral Duty": A 1936 article propagandists. on the importance of 3. "The Tasks of Propaganda in propaganda. the National Socialist State": 9. "The Reich Speaker School": A 1934 Goebbels speech on On methods of training propaganda. speakers. 4. "10 Commandments for 10. "Heart or Reason? What We Propagandists": A 1934 Don't Want from our satirical article on problems in Speakers": Problems in the the system. Nazi speaker system. 5. "Political Propaganda": A 11. "Film as a Weapon": A 1937 rather lengthy 1934 essay on piece by Fritz Hipper, who the nature of propaganda. made The Eternal Jew. -

Public Opinion Propaganda Ideology Brill’S Japanese Studies Library
Public Opinion Propaganda Ideology Brill’s Japanese Studies Library Edited by Joshua Mostow (Managing Editor) Caroline Rose Kate Wildman Nakai VOLUME 39 The titles published in this series are listed at brill.nl/bjsl Public Opinion Propaganda Ideology Theories on the Press and its Social Function in Interwar Japan, 1918–1937 By Fabian Schäfer LEIDEN • BOSTON 2012 Cover illustration: Taken from volume 2 of Sōgō jānarizumu kōza (Naigai-sha, 1930/31), depicting violations against article 23 of the press law (shinbunshi-hō) and article 19 of the publishing law (shuppan-hō) in 1923 (right circle) and in 1929 (left circle). During the short period of only six years, prohibitions of sale on the basis of ideology-based violations of the public peace and order (an’nei chitsujō) rose from 122 to 565 cases, whereas offenses against public morality ( fūzoku kairan) sunk from 1.394 to 614 cases. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Schäfer, Fabian. Public opinion, propaganda, ideology : theories on the press and its social function in interwar Japan, 1918–1937 / by Fabian Schäfer. p. cm. — (Brill’s Japanese studies library ; 39) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-22913-6 (hardback : alk. paper) 1. Journalism—Social aspects—Japan—History—20th century. 2. Journalism—Political aspects—Japan—History—20th century. 3. Public opinion—Japan. I. Title. PN5407.S6S33 2012 02.230952—dc23 2012009656 This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, IPA, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.nl/brill-typeface. -

Zeitungswissenschaft in Wien Bis 1945
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Zeitungswissenschaft in Wien 1900-1945 Die Institutionalisierung im Kontext der deutschsprachigen Fachentwicklung Verfasserin Katharina Kniefacz angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 301 Studienrichtung lt. Studienblatt: 1. Studienrichtung Geschichte Betreuer: ao. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Stadler Inhalt 1 Einleitung: Beitrag zur Disziplingeschichte der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und zur „Historischen Wissenschaftsforschung“ ............................................................................... 3 2 Zeitungskunde und Zeitungswissenschaft als akademische Disziplin in Deutschland.................................................................................................. 11 2.1 Frühe Zeitungskunde: Vorläufer und Pioniere zwischen Geschichte, Nationalökonomie und Pressepraxis 1890-1925 ............................................... 11 2.2 Konsolidierung und inhaltliche Neuorientierung 1925 bis 1933 ....................... 16 2.3 Zeitungswissenschaft im Nationalsozialismus: „Gleichschaltung“ durch den DZV unter Walther Heide ................................................................................ 19 2.4 Ende und Neubeginn 1945 ............................................................................... 27 2.5 Wirkungsstätten der Zeitungskunde/-wissenschaft ........................................... 28 2.5.1 Schweiz ................................................................................................................ -

Comparative History of Communication Studies: France and Germany
The Open Communication Journal, 2008, 2, 1-13 1 Comparative History of Communication Studies: France and Germany Stefanie Averbeck* University of Leipzig, Institut for Communication and Media Studies Abstract: The aim is to outline general differences in two academic cultures, considering historic perspectives: German ‘Kommunikationswissenschaft’ with its roots in ‘Publizistik-’ and ‘Zeitungswissenschaft’ and French ‘Sciences de l’information et de la communication’ with its roots in semiotics and cultural views on communication. There are differ- ent internal and external (societal and political) means which influenced the development of communication studies and theories in each of the two countries. The Sciences de l’information et de la communication (SIC) gained their academic acceptance in France in 1975 which under international comparison was late. One strong external moment of the instutionalization of SIC was the political aim to modernize the French University for the so called ‘information society’. The French researchers developed their own focus. Semio-pragmatics and social constructivism are two basic theoretical orientations which, after the end of the limiting structuralistic paradigm of the 1960ths, lead to a fruitful connection of the analysis of the micro and the meso-level of communication processes. Thus, Pragmatics and Symbolic Interactionism played an important role in French SIC much earlier than in Germany. Keywords: History of communication studies, French Sciences de l’information et de la communication, German -

For Historical Reasons. on the Lack of Acceptance of Journalism
Journalism Research HERBERT VON HALEM VERLAG 2020, Vol 3 (3) p. 203-219 ISSN 2569-152X DOI: 10.1453/2569-152X-32020-10998-en Research Paper Horst Pöttker For historical reasons On the lack of acceptance of journalism studies in Germany Abstract: In Germany, journalism studies as a university subject – whose role is innovation and education/training in relation to journalism as a profes- sion, in a similar way to medicine for the medical profession – receives little acceptance compared to in the USA and even Russia. This is expressed, for example, in the rather hostile attitude of media practitioners to the academ- ic professional training of journalists. This paper outlines a reason for this deficit that goes back to the history of the subject: In the USA, professional journalism training became established at many universities as far back as the 1920s, as journalism there broke away from party politics and questions of belief early on and publishers were happy to allow the public purse to pay for qualification for a profession with a public role. In Germany, on the other hand, it was the publishing houses and chief editors who called the shots as journalism studies was being set up, acting as party politicians or church rep- resentatives at the same time. They did not want to leave the training of their journalistic staff to universities – institutions that were and still are focused on academic objectivity. In contrast, journalism studies as a subject devel- oped early and more powerfully in the USSR than in Germany, as both the media and the universities there were in the hands of the ruling single party, the CPSU. -

Designing the 'Umvolkung' Nazi Social Anthropology
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS 2014 Tomus LIV. Fasc. 1 Pag. 23–54 DESIGNING THE ‘UMVOLKUNG’ NAZI SOCIAL ANTHROPOLOGY (SOZIALANTHROPOLOGIE) – KARL VALENTIN MÜLLER AND HIS CONCEPT OF ETHNIC RE-ENGINEERING, 1940–1945 URSULA FERDINAND ABSTRACT Karl Valentin Müller (1896–1963), an amateur researcher, published his first papers on the synthesis of ‘social’ and ‘racial’ issues in the tradition of German Sozialanthropologie around 1930. A decade later, the former mem- ber of the German Social Democratic Party had already become a prominent expert on Nazi population policy and Umvolkung. In 1941 he was appointed professor at the newly established Institute of Social Anthropology and Volk Biology (Institut für Sozialanthropologie und Volksbiologie) at the Faculty of Philosophy of the Ger- man University in Prague. His professional advancement was strongly supported by high SD and SS officials. In Prague he presented his programme of Umvolkung, or ethnic re-engineering, which was based on the idea of reorganising the national composition of the population in Central and South Eastern Europe. The programme was grounded in Müller’s own theories of Umvolkung with special focus on Bohemia and Moravia. After the Second World War, he became head of the Institute for Research on Intellectual Giftedness (Institut für Be- gabtenforschung) in Hannover. Later, Müller was appointed professor of empirical sociology at the University of Economic and Social Sciences in Nuremberg and became an active representative of Sozialanthropologie in the early Federal Republic of Germany. Müller never abandoned his basic assumptions, which were rooted in his convictions regarding heredity and racial biology and supported by an eclectic methodological mix. -

PDF Download
SC|MStudies in Communication and Media SC|MStudies in Communication and Media FULL PAPER 100 years communication study in Europe: Karl Bücher’s impact on the discipline’s reflexive project 100 Jahre Kommunikationswissenschaft in Europa: Karl Büchers Einfluss auf das reflexive Projekt der Disziplin Thomas Wiedemann, Michael Meyen & Iván Lacasa-Mas Studies in Communication and Media, 7. Jg., 1/2018, S. 7–30, DOI: 10.5771/2192-4007-2018-1-7 7 https://doi.org/10.5771/2192-4007-2018-1-7, am 25.09.2021, 08:17:17 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb Thomas Wiedemann, Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Ludwig-Maximilians-Universität München, Oettingenstr . 67, 80538 München, Germany; Contact: wiedemann(at)ifkw .lmu .de Michael Meyen, Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Ludwig- Maximilians-Universität München, Oettingenstr . 67, 80538 München, Germany; Contact: meyen(at)ifkw .lmu .de Iván Lacasa-Mas, Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universitat Internacional de Catalunya, Immaculada, 22, 08017 Barcelona, Spain; Contact: lacasa(at)uic .es 8 SCM, 7. Jg., 1/2018 https://doi.org/10.5771/2192-4007-2018-1-7, am 25.09.2021, 08:17:17 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb Full Paper 100 years communication study in Europe: Karl Bücher’s impact on the discipline’s reflexive project 100 Jahre Kommunikationswissenschaft in Europa: Karl Büchers Einfluss auf das reflexive Projekt der Disziplin Thomas Wiedemann, Michael Meyen & Iván Lacasa-Mas Abstract: Grounded in Giddens’ structuration theory and using Bourdieu’s analytical tools this paper argues that Karl Bücher’s launch of Europe’s first communication department at Leipzig University in 1916 had a structural impact on the discipline’s development across the continent, which goes far beyond content or citations. -

HUCP 1 2014.Pdf
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE 2014 HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE 2014 Tomus LIV. Fasc. 1 Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE KAROLINUM PRESS 2015 Editor-in-chief: Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. Executive editors: Mgr. Kateřina Schwabiková, Mgr. Michal V. Šimůnek, Ph.D., PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. Reviewers: Mgr. Marco Stella, Ph.D., Prof. Dr. rer. nat. Uwe Hoßfeld, Dr. Georgy S. Levit This issue is produced within the framework of Programme for the Development of Scientific Dis- ciplines at the Charles University (PRVOUK), P21: History of Academic Science and Education. Cover photo: A German X-ray image of a head for anthropological use, app. 1942, private collection. http://www.karolinum.cz/journals/hucp © Charles University in Prague, 2015 ISSN 0323-0562 (Print) ISSN 2336-5730 (Online) CONTENTS 9 Abbreviations Introduction 13 Michal V. Šimůnek, Anthropology & Monstrosity Articles 23 Ursula Ferdinand, Designing the ‘Umvolkung’. Nazi Social Anthropology (Sozialanthropologie) – Karl Valentin Müller and His concept of Ethnic Re-Engineering, 1940–1945 55 Michal V. Šimůnek – Uwe Hoßfeld, The Avantgarde of the ‘Rasse’. Nazi ‘Racial Biology’ at the German Charles University in Prague, 1940–1945 Reviews 107 Michal V. Šimůnek – Antonín Kostlán (eds.), Disappeared Science: Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945 (Petr Svobodný) 110 Walter Rüegg (ed.), Geschichte der Universität in Europa, IV, Vom Zweiten Weltkrieg bis zum Ende des 20. Jahrhunderts (Jiří Pešek) Czech Summaries 18 Michal V. Šimůnek, Antropologie & monstróznost 53 Ursula Ferdinand, Plánování „Umvolkung“. Nacistická sociální antropologie (Sozialanthropologie) – Karl Valentin Müller a jeho koncept „přenárodnění“, 1940–1945 97 Michal V. -

Jesko Von Hoegen
Politische Ikonographie 1/2009 - 1 Jesko von Hoegen Der „Marschall“ und der „Gefreite“. Visualisierung und Funktionalisierung des Hindenburg-Mythos im „Dritten Reich“ Einleitung Der Sieg in Ostpreußen wurde mit Reminiszenzen an die Schlacht bei Tannenberg aus dem Jahr 1410 ver- „Der Marschall und der Gefreite kämpfen mit uns für knüpft, in welcher der Deutsche Orden den Kampf ge- Frieden und Gleichberechtigung“. So lautete der Un- gen das Heer des Königs von Polen und des Groß- tertitel eines Wahlplakates der Nationalsozialisten zur fürsten von Litauen um die Vorherrschaft im damali- Reichstagswahl im November 1933. Es zeigte ein gen Deutschordensland verloren hatte. Die Schlacht Doppelportrait, auf dem sich der „Gefreite“ des Welt- von Tannenberg im August 1914 wurde zu einer ver- krieges, der „unbekannte Soldat“ Hitler mit dem „Mar- späteten Revanche für 1410 stilisiert, zu einer Vertei- schall“, dem „Retter“ Hindenburg, als väterlichem digung ,uralten deutschen Bodens' gegen den stets Mentor präsentierte.1 Die Distanz zwischen beiden eine Bedrohung darstellenden slawischen Feind.7 Der Männern, die noch ein Jahr zuvor als Kontrahenten im Hindenburg-Mythos entstand aus dem Gefühl der Kampf um das Reichspräsidentenamt die politischen Dankbarkeit gegenüber dem „Befreier Ostpreußens" Lager der Weimarer Republik polarisiert hatten und und war nicht das Produkt einer staatlich gelenkten die auch nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanz- Propaganda. Der „Held von Tannenberg" Paul von ler am 30. Januar 1933 durch Hindenburg zunächst Hindenburg -

Communicatio Socialis Challenge of Theology and Ministry in the Church Festschrift for Franz-Josef Eilers
Helmuth Rolfes / Angela Ann Zukowski (ed.) Communicatio Socialis Challenge of Theology and Ministry in the Church Festschrift for Franz-Josef Eilers Bibliographic information published by Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.d-nb.de. ISBN 978-3-89958-310-6 URN urn:nbn:de:0002-3101 URL http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbupress/publik/abstract.php?978-3-89958-310-6 2007, kassel university press GmbH, Kassel www.upress.uni-kassel.de Satz und Layout: Dr. Eva Oppermann, Kassel Umschlaggestaltung: Jörg Batschi Grafik Design, Kassel Druck und Verarbeitung: Unidruckerei der Universität Kassel Printed in Germany Franz-Josef Eilers SVD I Table of Contents Introduction 1 John Foley 6 Foreword Helmuth Rolfes Inter Mirifica, and What Followed: The Second Vatican Council as the Beginning of a New Era in the Relationship between the Church and the Media 8 Willi Henkel Areopagus of the Modern World 28 Giso Deussen The Cultures of Africa: Voiceless in the Internet 36 Ineke de Feijter The Concept of Dialogue and Its Ethical Implications: A Contribution to the Concept of Social Communication 48 Frances Forde Plude Religion and Mediated Popular Culture: The Need for Dialogue 70 Henry D’Souza Inter-Religious Dialogue as Communication 85 Sebastian Periannan Spirituality of Communication in the Context of “Communalism, Consumerism and Terrorism” 91 Daniela Frank Taking on the Challenge of Furthering Catholic Communications: An Ongoing Task in an Ever-Changing World 106 Angela Ann Zukowski Shifting Sands: Catechesis, Imagination and the Digital Culture 116 Jacob Srampickal Interdisciplinary Approach is Inevitable and a Major Challenge in Communication Studies 143 Pradip Thomas The Case for Communication in Theological Education 169 II Roberto M.