Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Absence of Traditional Characters in Philippe Manoury's Thinkspiel Kein Licht
The absence of traditional characters in Philippe Manoury’s Thinkspiel Kein Licht. (2011/2012/2017) Eva Van Daele (Ghent University, September 2018) To this day, composers try to reinvent the genres of opera and music theatre. One of the impulses for renewal is contemporary theatre. One development we notice is a discrepancy between the singer and the character in contemporary music theatre (in its broadest form). This discrepancy is an opportunity to question how we (re)present voices, ourselves and our stories on stage. We will look at the phenomenon in one specific work. Our case Kein Licht. (2011/2012/2017) is a collaboration between the French composer Philippe Manoury (b. 1952) and German theatre director Nicolas Stemann (b. 1968) who created a performance based on theatre texts by Elfriede Jelinek. The main concern of this paper is this: how is the lack of characters in Jelinek’s text addressed in the Thinkspiel Kein Licht. (2011/2012/2017) of Nicolas Stemann and Philippe Manoury?1 This question is inseparable from the treatment and the allocation of text to the voices and bodies on stage. It is not immediately clear how the text of Jelinek is distributed among the speakers and if the words of actors and singers have a different status. Since nor in the theatre texts, nor in the Thinkspiel we can’t speak of “characters”, I will use the term “roles”. There is a friction between the “roles” (such as A and B) in the text, what we see on scene, and what we hear. Indeed, even between what we see and what we hear, concerning the actors and singers, we notice a discrepancy. -

Elfriede Jelineks Theater. Eine Analyse Des Königinnenduetts in Nicolas Stemanns Inszenierung Von Ulrike Maria Stuart.“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Elfriede Jelineks Theater. Eine Analyse des Königinnenduetts in Nicolas Stemanns Inszenierung von Ulrike Maria Stuart.“ Verfasserin Cara-Sophia Pirnat angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, Februar 2014 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Ao. Univ.-Prof. Dr. Monika Meister Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG ............................................................................................................................... 1 1.1 SUBJEKTIVITÄT DER ANALYSE ...................................................................................................... 1 1.2 CO-AUTORENSCHAFT ZWISCHEN AUTORIN UND REGISSEUR ........................................................ 5 1.3 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND THEMATIK DES TEXTES ULRIKE MARIA STUART ......................... 6 1.4 FORSCHUNGSSTAND ...................................................................................................................... 9 1.5 REZEPTION DER INSZENIERUNG .................................................................................................. 10 1.6 METHODE UND PROBLEMATIK DER INSZENIERUNGSANALYSE .................................................... 11 2 REGIE: NICOLAS STEMANN ................................................................................................. 13 3 DIE INSZENIERUNG ............................................................................................................... -

Redalyc.Von Schillers Ästhetischer Theorie Zur Dekonstruktion Und
Revista de Filología Alemana ISSN: 1133-0406 [email protected] Universidad Complutense de Madrid España GIMÉNEZ CALPE, Ana Von Schillers ästhetischer Theorie zur Dekonstruktion und Entmythologisierung. Elfriede Jelineks / Nicolas Stemanns Ulrike Maria Stuart Revista de Filología Alemana, vol. 23, 2015, pp. 135-152 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España Erhältlich in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321841408008 Wie zitieren Komplette Ausgabe Wissenschaftliche Informationssystem Mehr informationen zum Artikel Netzwerk von wissenschaftliche Zeitschriften aus Lateinamerika, der Karibik, Spanien und Zeitschrift Homepage in redalyc.org Portugal Wissenschaftliche Non-Profit-Projekt, unter der Open-Access-Initiative Von Schillers ästhetischer Theorie zur Dekonstruktion und Entmythologisierung. Elfriede Jelineks / Nicolas Stemanns Ulrike Maria Stuart Ana GIMÉNEZ CALPE Universitat de València [email protected] Recibido: 3 de septiembre de 2014 Aceptado: 20 de noviembre de 2014 ZUSAMMENFASSUNG Wie die meisten Texte Elfriede Jelineks ist auch das Theaterstück Ulrike Maria Stuart reich an intertextuellen Referenzen. Neben Schillers Trauerspiel Maria Stuart werden unter anderem Texte aus den Schriften der RAF (Rote Armee Fraktion) so wie aus journalistischen Veröffentlichungen über die terroristische Vereinigung zitiert, paraphrasiert und umformuliert. Dieser Artikel geht der Frage nach, wie die intertextuellen Referenzen in Jelineks polyphonem Text eine idealistische Auf- fassung der Welt und der Kunst, die in den in Ulrike Maria -
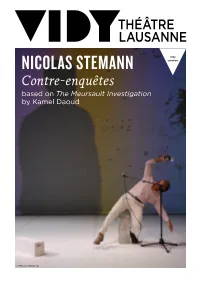
NICOLAS STEMANN Creation Contre-Enquêtes Based on the Meursault Investigation by Kamel Daoud
Vidy NICOLAS STEMANN creation Contre-enquêtes based on The Meursault Investigation by Kamel Daoud © Philippe Weissbrodt CONTENTS 2 DISTRIBUTION 3 PRESENTATION 4 HOW LITERATURE CAN ACT AGAINST CYNICISM THE THEATRE OF NICOLAS STEMANN 5 TEASER 7 MEETING THE STRANGER 8 “THE PRESENT ONLY EXISTS BECAUSE ONE MAN REMEMBERS IT” 11 BEYOND THE SHOW 12 NICOLAS STEMANN 13 MOUNIR MARGOUM 14 THIERRY RAYNAUD 15 KAMEL DAOUD 16 PALOMA COLOMBE 17 KATINKA DEECKE 18 CLAUDIA LEHMANN 19 MARYSOL DEL CASTILLO 20 CONTACTS 21 DISTRIBUTION 3 Vidy Contre-enquêtes creation based on The Meursault Investigation by Kamel Daoud Length: ~1:20 Theatre English surtitles available Conception, adaptation, scenography Nicolas Stemann Video Claudia Lehmann Costumes Marysol del Castillo Sound creation Paloma Colombe Nicolas Stemann Light creation Jonathan O’Hear Dramaturgy Katinka Deecke Assistant to the director Mathias Brossard With Mounir Margoum Thierry Raynaud Production Théâtre Vidy-Lausanne Schauspielhaus Zürich The Cercle des mécènes du Théâtre Vidy-Lausanne supports the Théâtre Vidy-Lausanne for this show. With the support of the production, technical, communication and administration teams of Théâtre Vidy-Lausanne BACK TO Creation 2020 CONTENTS PRESENTATION 4 With this new creation, German director Nicolas Stemann has taken the novel that was to demonstrate the incisive writing of Algerian Kamel Daoud to the world, complemented with other texts. This Algerian author, today one of the most unique voices in Francophone literature, is known for his strong stand against religious radicalisation, as well as against post-colonial hypocrisy. He positions himself in the breach that writing provides, pointing out hypocrisy and responsibility in the West as well as in the Muslim world. -

Elfriede Jelinek's Die Schutzbefohlenen
Elfriede Jelinek’s Die Schutzbefohlenen : A chorus of complaints on human rights catastrophes I. Refugees Twenty-eight fugitives escaping from the eastern shore of Maryland is a painting that was published in 1872 in the book The Underground Railroad (Philadelphia, Porter & Coates, 1872), written by William Still. William Still lived in Philadelphia, where he was chairman of the Vigilance Committee of the Pennsylvania Anti-Slavery Society. He aided fugitive slaves by means of the so-called Underground Railroad and kept records of their lives in order to help families reunite after slavery was abolished. Elfriede Jelinek’s theater text Die Schutzbefohlenen begins with that image. First published in internet on June 14 th , 2013, the text was later modified by herself in November 2013 and again in November 2014. Jelinek, who was born in 1946 in a small Austrian village, had her literary breakthrough in 1975 with die liebhaberinnen , a marxist-feminist caricature of a homeland-novel. Since then, Jelinek writes against drawbacks in both public-political and private live – mainly, but not only of the Austrian society: Babel (2005) for example is a theater text on the war in Iraq and the Abu Ghraib torture and prisoner abuse. In 2004, she was awarded the Nobel Prize in Literature for her »musical flow of voices and counter-voices in novels and plays that, with extraordinary linguistic zeal, reveal the absurdity of society's clichés and their subjugating power. «1 Considering the literature market of the German speaking countries to be extremely bankrupt and nepotistic, she decided recently to publish her writings exclusively on her own website. -

The Meursault Investigation by Kamel Daoud, and Other Texts
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE AV. E.-H. JAQUES-DALCROZE 5 CH-1007 LAUSANNE Creation NICOLAS STEMANN at Vidy Contre-enquêtes based on The Meursault Investigation by Kamel Daoud, and other texts © DR NICOLAS STEMANN CONTRE-ENQUÊTES 2 CONTACTS THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE DIRECTION: VINCENT BAUDRILLER PRODUCTION: DIRECTOR OF ARTISTIC AND INTERNATIONAL PROJECTS CAROLINE BARNEAUD [email protected] T +41 (0)21 619 45 44 TECHNICS: TECHNICAL DIRECTION CHRISTIAN WILMART / SAMUEL MARCHINA [email protected] T +41 (0)21 619 45 16 / 81 PRESS: DIRECTOR OF AUDIENCES AND COMMUNICATION ASTRID LAVANDEROS [email protected] T +41 (0)21 619 45 74 M +41 (0)79 949 46 93 COMMUNICATION ASSISTANT PAULINE AMEZ-DROZ [email protected] T +41 (0)21 619 45 21 Creation NICOLAS STEMANN CONTRE-ENQUÊTES 3 at Vidy DISTRIBUTION Conception, adaptation, scenography : Nicolas Stemann Assistant to the director : Mathias Brossard Video : Claudia Lehmann Costumes : Marysol del Castillo Dramaturgy : Katinka Deecke With : Mounir Margoum Thierry Raynaud Production : Théâtre Vidy-Lausanne Schauspielhaus Zürich Creation March 2020 NICOLAS STEMANN CONTRE-ENQUÊTES 4 PRESENTATION This time as a starting point, the German director has taken the novel that was to demonstrate the incisive writing of Algerian Kamel Daoud to the world, probably complemented with other texts. This Algerian author, today one of the most unique voices in Francophone literature, is known for his strong stand against religious radicalisation, as well as against post-colonial hypocrisy. He positions himself in the breach that writing provides, pointing out hypocrisy and responsibility in the West as well as in the Muslim world. In his novel, Kamel Daoud gives voice to the alleged brother of the Arab killed by Meursault, the hero of The Stranger by Camus. -

Bibliography
BIbLIOGRAPHY Abdilla, R. (2016) ‘Local Artistic Produce (3): Lampedusa’, 17 March. http:// whenpraxisbecomesunbearable.tumblr.com/post/141197850957/local-artis- tic-produce-3-lampedusa, date accessed 13 March 2017. ACP (2012) Contemporary Catholic Perspectives. http://www.associationof- catholicpriests.ie/wp-content/uploads/2012/04/Contemporary-Catholic- Perspectives.pdf, date accessed 26 February 2017. Aeschylus. (1992) ‘The Suppliant Maidens’, trans. S.G. Benardete in D. Grene and R. Lattimore (eds) Aeschylus II (Chicago: University of Chicago Press). Agamben, G. (1995) ‘We Refugees’, trans. Michael Rocke, Symposium, 49 (2), 114–119. http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/Phil%20108- 08/We%20Refugees%20-%20Giorgio%20Agamben%20-%201994.htm, date accessed 15 February 2017. Agamben, G. (1998) Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. Daniel Heller-Roazen (Stanford: Stanford University Press). Agamben, G. (2005) State of Exception, trans. K. Attell (Chicago: Chicago University Press). Agee, P. (1975) Inside the Company: CIA Diary (Penguin Books). AIDA (2016) ‘Country Report: Ireland’. http://www.asylumineurope.org/ sites/default/files/report-download/aida_ie_update.v_final.pdf, date accessed 1 April 2017. Anderson, P. (2003) ‘Over 100,000 Protest Against War in Dublin and Belfast’, Irish Times, 15 February. http://www.irishtimes.com/news/over-100-000- protest-against-war-in-dublin-and-belfast-1.461812, date accessed 27 February 2017. © The Author(s) 2018 213 S.E. Wilmer, Performing Statelessness in Europe, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69173-2 214 BibliographY Anouilh, J. (1946) Antigone, trans. Lewis Galantière (New York: Random House). Arendt, H. (1943) ‘We Refugees’, The Menorah Journal, 31 (1) 69–77. -
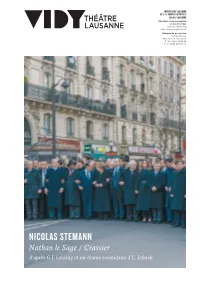
NICOLAS STEMANN Nathan Le Sage / Crassier D’Après G.E Lessing Et Un Drame Secondaire D’E
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE AV. E.-H. JAQUES-DALCROZE 5 CH-1007 LAUSANNE Directrice de la production et des tournées Caroline Barneaud Mail: [email protected] Chargée de production Sophie Mercier Mail: [email protected] T +41 (0)21 619 45 83 P+41 (0)78 807 63 45 NICOLAS STEMANN Nathan le Sage / Crassier d’après G.E Lessing et un drame secondaire d’E. Jelinek NICOLAS STEMANN NATHAN LE SAGE 2 NATHAN LE SAGE Création à Vidy Mise en scène : Nicolas Stemann Traduction et dramaturgie : Mathieu Bertholet Scénographie : Katrin Nottrodt Musique : Waël Koudaih (Rayess Bek) Costumes : Marysol del Castillo Vidéo : Claudia Lehmann Assistanat mise en scène : Nora Bussenius Stagiaire assistanat mise en scène : Mathias Brossard Stagiaire assistanat costumes : Giulia Rossini Construction du décor : Ateliers du Théâtre de Vidy Avec : Lorry Hardel Lara Katthabi Mounir Margoum Serge Martin Elios Noël Véronique Nordey Laurent Papot Lamya Regragui et les musiciens : Waël Koudaih (Rayess Bek) Yann Pittard Production : Théâtre de Vidy Coproduction : MC93-Maison de la Culture de la Seine St-Denis, Bobigny Théâtre National de Strasbourg Théâtre National de Bretagne Bonlieu Scène nationale Annecy et La Bâtie-Festival de Genève dans le cadre du programme INTERREG France-Suisse 2014-2020 Avec le soutien de: Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture L’Arche est l’agent théâtral d’Elfriede Jelinek Création le 14 septembre 2016 au Théâtre de Vidy Durée estimée : 2h NICOLAS STEMANN NATHAN LE SAGE 3 PRÉSENTATION En 2009 au Thalia Theater de Hambourg, Nicolas Stemann mettait en scène Nathan le Sage, le célèbre chef d’oeuvre de Lessing, complété par un « drame secondaire » commandé à Elfriede Jelinek. -
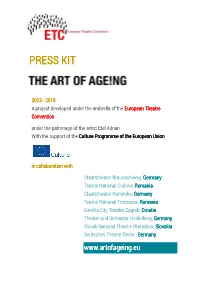
The Art of Ageing Press
PRESS KIT 2013 --- 2015 A project developed under the umbrella of the European Theatre Convention under the patronage of the artist Etel Adnan With the support of the Culture Programme of the EuropeanEuropean Union in cocollaborationllaboration with Staatstheater Braunschweig, Germany Teatrul National Craiova, Romania Staatstheater Karlsruhe, Germany Teatrul National Timisoara, Romania Gavella City Theatre Zagreb, Croatia Theater und Orchester Heidelberg, Germany Slovak National Theatre Bratislava, Slovakia Deutsches Theater Berlin , Germany www.artofageing.eu CContentsontents 1.1.1. About The Art of Ageing ............................................................................................................................................................................... ............... 333 2. The Art of Ageing CoCo----ProductionsProductions .............................................................................................................................. 555 3.3.3. Irgendwann in der Nacht, written by Etel Adnan .............................................................................. 191919 4. The conference ................................................................................................................................................................................... ................................... 222222 5. The Art of Ageing festival .......................................................................................................................................................................... -

2-Engl CV and PUBLICATIONS Kovacs
Dr.in Teresa Kovacs E-Mail: [email protected] Web: www.teresakovacs.com CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS (Updated 9/1/2017) I CURRICULUM VITAE Professional Development since 08/2017 Erwin Schrödinger Fellow (FWF) at the Department of Germanic Languages and Literatures, University of Michigan, Ann Arbor 06/2016-07/2017 Universitätsassistentin Post-Doc, Forschungsplattform Elfriede Jelinek der Universität Wien 04/2016 Completion of Doctoral Studies (grade: outstanding) in German Studies Institut für Germanistik der Universität Wien (supervisor: ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Pia Janke, evaluators: Univ.-Prof. Dr. Stefan Krammer, Univ.-Prof. Dr. Monika Szczepaniak) Title of PhD thesis: Drama als Störung. Elfriede Jelineks Konzept des Sekundärdramas 06/2013-05/2016 Universitätsassistentin Prae-Doc, Forschungsplattform Elfriede Jelinek der Universität Wien 10/2011-05/2013 Wissenschaftliche Mitarbeiterin, FWF-sponsored project Elfriede Jelinek: Werk und Wirkung. Annotierte Bibliographie am Institut für Germanistik der Universität Wien 05/2011 Completion of the Master’s Program in German Studies Germanistik (grade: outstanding) (supervisor: ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Pia Janke) Title of MA thesis: „Mein Assistent des Verschwindens“. Elfriede Jelineks Texte für Christoph Schlingensief 2011-2013 Wissenschaftliche Mitarbeiterin, research project Körper- Macht-Medien. Elfriede Jelineks feministische Bezüge. (supported by Bundeskanzleramt Österreich, Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst), Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 2009-2010 -

Download Download
Christoph Leitgeb and Monika Mokre “Staging Participation”. AmeriQuests vol. 16.1 (2021) Staging Participation: Cultural Productions With, and About, Refugees Christoph Leitgeb and Monika Mokre Introduction The aim of this paper is to analyze two selected pieces of performance art about and including refugees – Charges (The Suppliants) by Elfriede Jelinek (hereafter referred to as The Suppliants) and Homohalal by Ibrahim Amir – in terms of their content, process, and the question of representation. These pieces were created and performed over a five-year period (2013–2018), and their shared intention was to make refugees visible and audible through art. Both The Suppliants and Homohalal emerge from a political phenomenon that has risen to prominence over the last fifteen years, at least in the German-speaking countries: the “social turn” in the performing arts, in which artists take on a form of political responsibility (Michaels 123–124). Projects in this tradition engage with topical, socially relevant issues, either by including those directly affected or by using original research and artistic approaches to bring the issues to the stage. We begin by describing socially engaged arts projects as committed both to the arts scene itself and to the communities with, and for which, they set out to work. This entails problems of representation: the very problems that were supposed to be addressed by the participation of those directly concerned. This participation presents new challenges, because it reproduces precisely those differences that are invoked in the discourse of social exclusion. Moreover, it is liable to create an image of (false) authenticity within an artistic (and therefore, by nature, artificial) set-up. -

Schaubühne Berlin
Friday and Saturday, October 12 –13, 2018, 8pm Zellerbach Hall Schaubühne Berlin An Enemy of the People by Henrik Ibsen | Version by Florian Borchmeyer Premieres: July 18, 2012 in Avignon and September 8, 2012 in Berlin Cast/ Creative Team Dr. Stockmann Christoph Gawenda Member of the City Council Konrad Singer Mrs. Stockmann Eva Meckbach Hovstad Renato Schuch Aslaksen David Ruland Billing Moritz Gottwald Morten Kiil omas Bading Direction omas Ostermeier Stage Design Jan Pappelbaum Costume Design Nina Wetzel Music Malte Beckenbach, Daniel Freitag Dramaturgy Florian Borchmeyer Lighting Design Erich Schneider Wall Paintings Katharina Ziemke An Enemy of the People will be performed without an intermission and will last approximately two hours and 30 minutes. Cal Performances’ 2018 –19 season is sponsored by Wells Fargo. 19 ABOUT THE ARTISTS Synopsis which includes new forms of dance and musi - Dr. Stockmann discovers that the source of cal theater. e search for a contemporary and drinking and spa water is riddled with patho - experimental theater language that focuses on genic micro-organisms, caused by industrial storytelling and a precise understanding of waste. Stockmann wants to publish the find - texts—both classical and contemporary—is a ings in the newspaper and demands that the unifying element. e repertoire encompasses city council re-route the water pipes. Influential the great dramatic works of world literature citizens and local journalists promise their alongside contemporary plays from interna - support. tionally renowned writers. e more than 100 However, Stockmann’s brother Peter, the world and German premieres during the past councilor of the city, raises some serious con - 19 years have been a key component of the cerns: e economic prosperity of the spa Schaubühne’s work.