B 3.1 Situation in Funktionsraum 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

100 Jahre Elsflether Werft Eine Bewegte Geschichte
Jens Schmeyers / Susanne Wiechmann 100 Jahre Elsflether Werft Eine bewegte Geschichte EDITION NORDSEE-ZEITUNG Inhaltsverzeichnis Vorwort 9 Grußwort von Björn Thümler 10 1916 – 1935: Stapellauf und erste Jahrzehnte der Werft unter Franz Peuss 12 Die Werftgründung 12 Aufbau der Werft während des Ersten Weltkrieges 14 Erste Nachkriegsjahre bis zur Inflation 15 Etablierung der Werft 18 1936 – 1962: Der Ausbau der Werft in schwierigen Zeiten unter Walter Behrendt und Eduard Zurawski 21 Die Werft unter dem Hakenkreuz 21 Wirtschaftlicher Aufschwung 22 Die ersten Jahre des Zweiten Weltkrieges 25 Die zweite Kriegshälfte 27 Die Nachkriegszeit unter alliierter Besatzung 31 Der Neuanfang 32 Der Wiederaufstieg der Werft 36 Ausbau der Werft 40 Erste Krisen 46 Szenen einer Werft aus den 1960er Jahren 51 Die Sturmflut von 1962 52 Walter Behrendts Abschied 55 5 1962 – 1979: Aufbruch zu neuen Ufern unter Edmund Behrendt Im Auftrage der Bundesmarine 115 und seit 1969 Erhard Bülow 57 Musikaufführungen 118 Die Umwandlung der Werft zur Aktiengesellschaft 120 Neue Ideen in Zeiten der Krise 57 Das 50-jährige Jubiläum 60 Der weitere Ausbau der Werft 62 Seit 2011: Klaus Wiechmann 122 Auf großer Fahrt 67 Spezialschiffbau in den 1970er Jahren 70 Der neue Werftchef 122 Forschungsschiffe 78 Die neue Montagehalle und weitere Umbaumaßnahmen 122 Edmund Behrendts letzte Aktivitäten 83 Wichtige Aufträge in Bildern 127 Soziales und gesellschaftliches Engagement 131 Menschen auf der Werft 133 1979 – 1996: In Zeiten der Schiffbaukrise und des Konkurses unter Erhard Bülow 85 Ein Neuanfang mit dem Streit um die Yacht »Hanse« 85 Ausgewählte Schiffsbiografien 142 Heraufziehende Krisenjahre 87 Spezialschiffbau zu Beginn der 1980er Jahre 89 Aufträge für Marine und Grenzschutz 95 Bauliste 158 Yachten und sonstige Aufträge 96 Von der »Lili Marleen« bis zum Konkurs 99 Unter Konkursverwaltung 102 Anhang 169 Zeittafel 169 1996 – 2011: Neugründung und Konsolidierung als Reparaturwerft Literatur 175 unter Kurt Wiechmann 105 Bildnachweis 175 Die Autoren 176 Die Neugründung als GmbH & Co. -

Zonation of the TIDE Estuaries
Zonation of the TIDE estuaries Lindsay Geerts, Kirsten Wolfstein, Sander Jacobs, Stefan van Damme & Wouter Vandenbruwaene, September 2012 Authors: Lindsay Geerts, Sander Jacobs, Stefan van Damme University of Antwerp "Campus Drie Eiken" Department of Biology Ecosystem Management Research Group Universiteitsplein 1 2610 Antwerpen Belgium Wouter Vandenbruwaene Flanders Hydraulics Reseach Waterbouwkundig Laboratorium 2140 Antwerpen Belgium Kirsten Wolfstein Hamburg Port Authority Neuer Wandrahm 4 20457 Hamburg Germany Disclaimer The authors are solely responsible for the content of this report. Material included herein does not represent the opinion of the European Community, and the European Community is not responsible for any use that might be made of it. Table of Contents Summary 1 Introduction 3 2 Zonation per estuary 4 a) Schelde 4 b) Elbe 6 c) Weser 9 d) Humber 12 3 Zonation according to Venice for all TIDE estuaries 14 4 Concluding remarks 19 Summary In the TIDE project a zonation approach was set up for cases when it was more sensible to compare only certain areas of the 4 estuaries Scheldt, Elbe, Weser and Humber instead of considering the whole estuary. In order to be able to directly compare certain characteristics e.g. ecological functioning, research questions, measures and management issues, basis zones of equal properties were chosen. The zonation approach consists of a nested zonation of 3 or 4 scale levels: the whole estuarine system (the estuary corresponds to one compartment or zone) on the first level and more compartment numbers on every scale below. The project partners agreed on setting km “0” of all estuaries at the inland tidal boundary on the longitudinal axis and using the Venice system for a comparable zonation, even when this approach differed from those used by the different partners in the past. -

Blumenthals Gewässer
verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Seit 2009 besitzt die Jenseits der Stadtautobahn erreicht man auf der rechten Seite die zur Kühlung von Bier. Die Rönnebecker Brauerei sägte vor dem mit Rindern beweidet. Zweimal im Jahr dürfen die Rinder Der Golleckteich Ein Kiessee auf der Rekumer Geest Beckedorfer Beeke parallel zur Straße Burgwall im Blumenthaler Beckedorfer Beeke. Ersten Weltkrieg im Winter zu diesem Zweck große Eisstücke aus im Eispohlgelände aufwachsende Gehölze und Uferstauden Verlauf ein neues „Bett“: Damit Flora und Fauna sich dort besser der gefrorenen Oberfläche heraus. Ob das auch der Zweck des beweiden. Dabei schaffen sie für Pionierpflanzen bodenoffene am Blumenthaler Freibad Blumenthals Gewässer entwickeln können, wurde der Lauf der Beeke verlängert und In der Rekumer Geest: östlich gelegenen kleineren Katzenpohls war, ist nicht überliefert. Stellen. in seiner Linienführung verändert. Oberhalb davon wurde das Das Naturschutzgebiet Das Gebiet weist heute Heideflächen, Kleingewässer, Magerrasen, Ansonsten ist der Weiher zum Schutz für die empfindliche Gewässerbett verbreitert, damit sich dort das Wasser beruhigt Feuchtwiesen und Dünen auf und kann auf gekennzeichneten Vegetation eingezäunt. und sich Sand absetzen kann. So kann verhindert werden, dass Eispohl-Sandwehen Wegen erkundet werden. Der dort ehemals vorkommende Wald Zum Naturschutzgebiet gehört seit 2014 die nördlich angrenzend sich im Unterlauf die Sohle der Beeke weiter durch Sandablage- wurde durch Schafhaltung zurückgedrängt und entwickelte Fläche, die auch gleichzeitig ein europäisches Schutzgebiet ist: rungen erhöht. sich zu einer nährstoffarmen Heidelandschaft. Später wurde für „Heide und Heideweiher auf der Rekumer Geest“. Mit einer Im Bereich der Einmündung der Beeke in die Blumentaler Aue am Schafhaltung Boden als Stalleinstreu entnommen. Die sandigen Größe von 35,4 Hektar zieht es sich innerhalb des Wasser- Haus Blomendal wurden weitere Verbesserungen vorgenommen. -

B DIRECTIVE of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL of 12 December 2006 Laying Down Technical Requirements for Inland W
2006L0087 — EN — 30.04.2009 — 004.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC (2006/87/EC) (OJ L 389, 30.12.2006, p. 1) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council of L 389 261 30.12.2006 18 December 2006 ►M2 Council Directive 2008/59/EC of 12 June 2008 L 166 31 27.6.2008 ►M3 Commission Directive 2008/87/EC of 22 September 2008 L 255 5 23.9.2008 ►M4 Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of L 260 13 30.9.2008 24 September 2008 ►M5 Commission Directive 2008/126/EC of 19 December 2008 L 32 1 31.1.2009 ►M6 Commission Directive 2009/46/EC of 24 April 2009 L 109 14 30.4.2009 2006L0087 — EN — 30.04.2009 — 004.001 — 2 ▼B DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC (2006/87/EC) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 71(1) thereof, Having regard to the proposal from the Commission, Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1), Following consultation of the Committee of the Regions, Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (2), Whereas: (1) Council Directive 82/714/EEC of 4 October 1982 laying down technical requirements for inland waterway vessels (3) introduced harmonised conditions for issuing technical certificates for inland waterway vessels in all Member States, albeit excluding operations on the Rhine. -
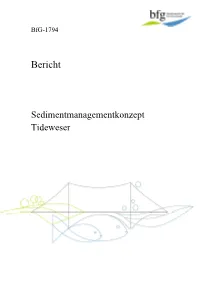
Sedimentmanagementkonzept Tideweser
BfG-1794 Bericht Sedimentmanagementkonzept Tideweser Zitiervorschlag: BfG (2014): Sedimentmanagementkonzept Tideweser. Untersuchung im Auftrag der WSÄ Bremen und Bremerhaven. Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz, BfG- Bericht 1794. BfG-1794 Bericht Sedimentmanagementkonzept Tideweser 15.04.2014 Auftraggeber: Wasser- und Schifffahrtsämter Bremen und Bremerhaven Auftragsnummer: M 39630104030 Anzahl der Seiten: 253 Bundesanstalt für Gewässerkunde Sediment- management- konzept Tideweser Bearbeiter(innen) in der BfG BfG-1794 Federführung Mailin Eberle Dr. Michael Fiedler Fachliche Bearbeitung Hydrologie Christoph Blasi Hydromorphologie Dr. Frauke König Wasserbeschaffenheit/Phytoplankton Andreas Schöl Schadstoffe in Feststoffen Dr. Birgit Schubert Ökotoxikologie Dr. Ute Feiler Fauna Dr. Markus Wetzel Christian von Landwüst Vegetation Dr. Andreas Sundermeier Bearbeitung/Fachliche Begleitung im WSA Bremen Rüdiger Oltmanns Friederike Piechotta (Bearbeitung Kapitel 2) Bearbeitung/Fachliche Begleitung im WSA Bremerhaven Ulrich Günther Sven Dunker Jürgen Lange Seite 1 Bundesanstalt für Gewässerkunde Sediment- management- konzept Tideweser BfG-1794 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................... 11 1.1 Anlass und Zielsetzung .............................................................................................. 11 1.2 Übersicht über das Bearbeitungsgebiet ................................................................... 13 2. Aktuelles Sedimentmanagement -
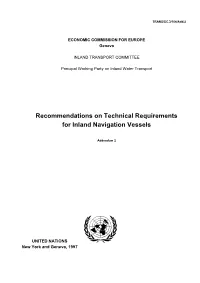
Recommendations on Technical Requirements for Inland Navigation Vessels
TRANS/SC.3/104/Add.2 ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE Geneva INLAND TRANSPORT COMMITTEE Principal Working Party on Inland Water Transport Recommendations on Technical Requirements for Inland Navigation Vessels Addendum 2 UNITED NATIONS New York and Geneva, 1997 TRANS/SC.3/104/Add.2 page 3 AMENDMENTS TO RESOLUTION NO. 17, REVISED: RECOMMENDATIONS ON TECHNICAL REQUIREMENTS FOR INLAND NAVIGATION VESSELS 1/ Resolution No. 32 (adopted by the Principal Working Party on Inland Water Transport on 12 November 1992) The Principal Working Party on Inland Water Transport, Considering resolution No. 17, revised (TRANS/SC.3/103, annex 1), containing in its annex the Recommendations on Technical Requirements for Inland Navigation Vessels (TRANS/SC.3/104), Bearing in mind the report of the Working Party on the Standardization of Technical and Safety Requirements in Inland Navigation on its fourth session (TRANS/SC.3/WP.3/8), Decides to amend the Recommendations on Technical Requirements for Inland Navigation Vessels by the text contained in the annex to this resolution, Requests Governments and river commissions to inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe whether they accept this resolution, Requests the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe to place the question of the application of this resolution periodically on the agenda of the Principal Working Party on Inland Water Transport. / The text of this resolution also appears in the compendium of all valid resolutions of the Principal Working Party on Inland Water Transport published in 1993 under the symbol TRANS/SC.3/131. TRANS/SC.3/104/Add.2 page 4 Annex CHAPTER 11 BIS HOISTING DEVICES OF WHEELHOUSES OF INLAND NAVIGATION VESSELS 11 bis-1 GENERAL REQUIREMENTS 11 bis-1.1 A vertically movable wheelhouse shall permit efficient steering of the inland navigation vessel. -

Download Full Measure
‘Shallow water area Rönnebecker Sand’ Measure analysis 25 in the framework of the Interreg IVB project TIDE S. Saathoff 1, J. Lange ² 1 Lower Saxony Water Management, Coastal Defence and Nature Conservation Agency, Germany 2 Water and Shipping Authority Bremerhaven, Germany December 2012 Disclaimer The authors are solely responsible for the content of this report. Material included herein does not represent the opinion of the European Community, and the European Community is not responsible for any use that might be made of it. Sonja Saathoff Lower Saxony Water Management, Coastal Defence and Nature Conservation Agency (NLWKN) Department Brake-Oldenburg Germany www.nlwkn.niedersachsen.de Citation: Saathoff, S. & J. Lange (2012): ‘Shallow water area Rönnebecker Sand’ (Weser estuary). Measure analysis in the framework of the Interreg IVB project TIDE. Measure 25. 14 pages. Oldenburg, Bremerhaven. Table of contents Table of contents ..................................................................................................................................... 1 List of figures ........................................................................................................................................... 2 List of tables ............................................................................................................................................ 2 Part 1: Measure description .................................................................................................................... 3 1.1 Measure description -

B Directive of the European Parliament
2006L0087 — EN — 01.11.2013 — 007.003 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC (2006/87/EC) (OJ L 389, 30.12.2006, p. 1) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Directive 2006/137/EC of the European Parliament and of the Council L 389 261 30.12.2006 of 18 December 2006 ►M2 Council Directive 2008/59/EC of 12 June 2008 L 166 31 27.6.2008 ►M3 Commission Directive 2008/87/EC of 22 September 2008 L 255 5 23.9.2008 ►M4 Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of L 260 13 30.9.2008 24 September 2008 ►M5 Commission Directive 2008/126/EC of 19 December 2008 L 32 1 31.1.2009 ►M6 Commission Directive 2009/46/EC of 24 April 2009 L 109 14 30.4.2009 ►M7 Commission Directive 2012/48/EU of 10 December 2012 L 6 1 10.1.2013 ►M8 Commission Directive 2012/49/EU of 10 December 2012 L 6 49 10.1.2013 ►M9 Council Directive 2013/22/EU of 13 May 2013 L 158 356 10.6.2013 ►M10 Commission Directive 2013/49/EU of 11 October 2013 L 272 41 12.10.2013 2006L0087 — EN — 01.11.2013 — 007.003 — 2 ▼B DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC (2006/87/EC) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty -

Kliwas 40 2014 3.06.Pdf (3.495
Periodical Part, Report, Published Version Kleisinger, Carmen; Burger, Beate; Grope, Norbert; Schubert, Birgit Klimabedingt verändertes Transportverhalten schadstoffbelasteter Sedimente und Unterhaltung von Wasserstraßen in Nordsee Ästuaren KLIWAS Schriftenreihe Verfügbar unter/Available at: https://hdl.handle.net/20.500.11970/105393 Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested citation: Kleisinger, Carmen; Burger, Beate; Grope, Norbert; Schubert, Birgit (2014): Klimabedingt verändertes Transportverhalten schadstoffbelasteter Sedimente und Unterhaltung von Wasserstraßen in Nordsee Ästuaren. Koblenz: Bundesanstalt für Gewässerkunde (KLIWAS Schriftenreihe, 40/2014). https://doi.org/10.5675/Kliwas_40/2014_3.06. Standardnutzungsbedingungen/Terms of Use: Die Dokumente in HENRY stehen unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, sofern keine abweichenden Nutzungsbedingungen getroffen wurden. Damit ist sowohl die kommerzielle Nutzung als auch das Teilen, die Weiterbearbeitung und Speicherung erlaubt. Das Verwenden und das Bearbeiten stehen unter der Bedingung der Namensnennung. Im Einzelfall kann eine restriktivere Lizenz gelten; dann gelten abweichend von den obigen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. Documents in HENRY are made available under the Creative Commons License CC BY 4.0, if no other license is applicable. Under CC BY 4.0 commercial use and sharing, remixing, transforming, and building upon the material of the work is permitted. In some cases a different, more restrictive license may apply; if applicable -
Kreiswettbewerb 2017
Kreiswettbewerb 2017 Bewerbungsunterlagen der Interessengemeinschaft „Rastplatz Weserdeich“ 26. Landeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft Vorwort Mit dem nachfolgenden Fragen möchten wir Sie bitten, Ihr Dorf, Ihre Ziele und das bislang Erreichte zu beschreiben. Diese Unterlagen und benannten Anlagen genügen damit den Anforderungen der Ausschreibung zum 26. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Weitere ergänzende Unterlagen über die nachfolgend benannten Anlagen hinaus sind nicht gefor- dert. Mit Ihren Angaben wird sowohl im Rahmen des Vorentscheides als auch im Landesentscheid zum Landeswettbewerb gearbeitet. Die für den Landeswettbewerb nominierten Dörfer brauchen keine weiteren Unterlagen einzureichen. Damit möchten wir Ihnen entgegenkommen, um den entstehenden Aufwand in den teilnehmenden Dörfern so gering als möglich zu gestalten. Darüber hinaus möchten wir so gewährleisten, dass die Eingangsvoraussetzungen für alle Dörfer im Hinblick auf die Einreichungsunterlagen gleich sind. Wettbewerbsteilnehmer (Name des Dorfes) Weserdeich-Ranzenbüttel Gemeinde/ 27804 Berne Landkreis Wesermarsch Samtgemeinde/Stadt Anschriften/ Ansprechpartner Vertretung des Dorfes Träger des Wettbewerbs im Dorf im Sinne der Nds. Gemeindeordnung Name Name Funktion Funktion Straße, Hausnr. Straße, Hausnr. PLZ, Ort 27804 Berne PLZ, Ort 27804 Berne – Weserdeich Telefon Telefon Fax Fax Email Email „Steckbrief“ zur Vorstellung Ihres Dorfes 1. Welches Leitbild/ welche Entwicklungsziele strebt Ihr Dorf an? Zum ersten Mal seit 20 Jahren kann man eine Stadtflucht aus -

Kopfbogen NLWKN
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz V e r o r d n u n g über das Naturschutzgebiet „Tideweser“ im kreis- und gemeindefreien Gebiet der Außenweser sowie in den Landkreisen Cuxhaven, Osterholz und Wesermarsch Vom 15. 1. 2019 Aufgrund § 20 Abs. 2 Nr. 1, § 22 Abs. 1 und 2 und den §§ 23 und 32 Abs. 2 und 3 BNatSchG vom 29. 7. 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. 9. 2017 (BGBl. I S. 3434), i. V. m. den §§ 14, 15, 16 Abs. 1 und § 32 Abs. 1 und 2 NAGB- NatSchG vom 19. 2. 2010 (Nds. GVBl. S. 104) wird im Einvernehmen mit den Landkreisen Cuxhaven, Osterholz und Wesermarsch verordnet: § 1 Naturschutzgebiet (1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet (NSG) „Tideweser" erklärt. (2) Das NSG liegt in der naturräumlichen Einheit „612 Wesermarschen“. Es befindet sich in den Gemeinden Loxstedt und Hagen im Landkreis Cuxhaven, der Gemeinde Schwane- wede im Landkreis Osterholz, den Städten Brake, Elsfleth, Nordenham und den Gemeinden Berne und Stadland im Landkreis Wesermarsch. Innerhalb des NSG liegen außerdem dem kreis- und gemeindefreien Gebiet zugehörige Wasserflächen der Außenweser. Das Gebiet erstreckt sich mit Unterbrechungen von der seeseitigen Grenze des Übergangs- gewässers (ca. Weser-km 85) bis Warfleth (ca. Weser-km 23). Die nordöstlichen und süd- westlichen Grenzen des NSG bilden in der Außenweser die Grenzen des Nationalparks Nie- dersächsisches Wattenmeer. Sofern sich aus den Schutzgebietskarten nicht eindeutig etwas anderes ergibt, bildet im weiteren Verlauf stromaufwärts die wasserseitige Grenze der Hauptdeiche und/oder der Außendeichsfuß der aktuellen Sommerdeiche einschließlich ihrer Außenberme die Gebietsgrenze. -

Zonation of the TIDE Estuaries
Tine ■ i * * . * » . Tidal River Development Zonation of the TIDE estuaries Lindsay Geerts, Kirsten Wolfstein, Sander Jacobs, Stefan van Damme & Wouter Vandenbruwaene, September 2012 Universiteit flanders Antwerpen HYDRAULICS RESEARCH Project part-financed by the ECOSYSTEM MANAGEMENT hß\4 Hamburg Port Authority RESEARCH GROUP European Union (European Regional Development Fund) J ia The Interreg IVB North Sea Region Programme Tine Tidal River Development Authors: Lindsay Geerts, Sander Jacobs, Stefan van Damme University of Antwerp "Campus Drie Eiken" Department of Biology Ecosystem Management Research Group Universiteitsplein 1 2610 Antwerpen Belgium Wouter Vandenbruwaene Flanders Hydraulics Reseach Waterbouwkundig Laboratorium 2140 Antwerpen Belgium Kirsten Wolfstein Hamburg Port Authority Neuer Wandrahm 4 20457 Hamburg Germany Disclaimer The authors are solely responsible for the content of this report. Material included herein does not represent the opinion of the European Community, and the European Community is not responsible for any use that might be made of it. Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Tine ..... Tidal River Development Table of Contents Summary 1 Introduction 3 2 Zonation per estuary 4 a) Schelde 4 b) Elbe 6 c) Weser 9 d) Humber 12 3 Zonation according to Venice for all TIDE estuaries 14 4 Concluding remarks 19 Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Tine ...... Tidal River Development Summary In the TIDE project a zonation approach was set up for cases when it was more sensible to compare only certain areas of the 4 estuaries Scheldt, Elbe, Weser and Humber instead of considering the whole estuary. In order to be able to directly compare certain characteristics e.g.