Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Versailles (Hellerau, 1927). Even Deutschland, Frankreich Und
BIBLIOGRAPHICAL NOTE Most of the sources on German history from 1890 to the end of the Weimar Republic are of use in a study of Maximilian Har den. In the following paragraphs are noted, besides the un published sources, only the published materials that deal directly with Harden, and the general works or monographs on the period that have been used most extensively. Many works cited in the text are not listed here; a complete reference to each one is found in its first citation. The indispensable source of information on Harden is the magazine he edited from 1892 until 1922. The one hundred and eighteen volumes of the Zukunft contain the bulk of his essays, commentaries, and trial records, as well as many private letters to and from him. The Zukunft was the inspiration or the source for Harden's principal pamphlets and books, namely Kampfge nosse Sudermann (Berlin, 1903); KopJe (4 vols., Berlin, 1911-1924); Krieg und Friede (2 vols., Berlin, 1918); and Von Versailles nach Versailles (Hellerau, 1927). Even Deutschland, Frankreich und England (Berlin, 1923), written after the Zukun}t had ceased publication, was in large a repetition of Zukunft articles. Harden's earliest work, Berlin als Theaterhauptstadt (Berlin, 1889), consisted in part of pieces he had written for Die Nation. Apostata (Berlin, 1892), Apostata, neue Folge (Berlin, 1892), andLiteraturund Theater (Berlin, 1896), were collections of his essays from Die Gegenwart. The Gegenwart and the other magazines for which he wrote before 1892 - Die Nation, Die Kunstwart, and M agazin fur Litteratur - are also indispensable sources. Harden's published writings also include articles in other German and foreign newspapers and magazines. -
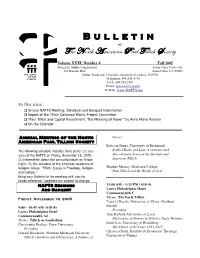
Bulletin to the Meeting with You for Handy Reference
B u l l e t i n of The North American Paul Tillich Society Volume XXXI, Number 4 Fall 2005 Religious Studies Department Santa Clara University 336 Bannan Hall Santa Clara, CA 95053 PHILOSOPHY Editor: Frederick J. Parrella, Secretary-Treasurer, NAPTS CULTURE THEOLOGY Telephone: 408.554.4714 FAX: 408.554.2387 Email: [email protected] Website: www.NAPTS.org In this issue: Annual NAPTS Meeting: Schedule and Banquet Information Report of the Tillich Collected Works Project Committee “Paul Tillich and Capital Punishment: The Meaning of Power” by Anne Marie Reijnen On the Calendar ___________________________________________________________________________________ Annual Meeting of the North Nerve? American Paul Tillich Society Robison James, University of Richmond The following schedule includes three parts: (1) ses- Symbol Early and Late: Continuity and sions of the NAPTS on Friday, November 18, 2005; Discontinuity between the German and (2) information about the annual banquet on Friday American Tillich night; (3) the schedule of the American Academy of Religion Group, “Tillich: Issues in Theology, Religion Stephen Murray, Skidmore College and Culture.” Paul Tillich and the Wrath of God Bring your Bulletin to the meeting with you for handy reference. Locations are subject to change. NAPTS Sessions 11:00 AM – 1:15 PM (A18–9) And Banquet Loews Philadelphia Hotel Commonwealth C Friday, November 18, 2005 Theme: The Early Tillich Terry O’Keeffe, University of Ulster, Northern Ireland 9:00 – 10:45 AM (A18–8) Presiding Loews Philadelphia Hotel -

HANS-LUKAS KIESER • Talat Paşa
HANS-LUKAS KIESER • Talat Paşa HANS-LUKAS KIESER Osmanlı’nın son dönemleri ile Osmanlı sonrasının yerel, bölgesel ve küresel boyutları üzerine uzmanlaşan bir tarihçi ve Newcastle, Avustralya ve Zürih üniversitelerinde modern tarih profesörüdür. 2005’ten 2015’e kadar Basel’deki İsviçre-Türkiye Araştırmalar Derneği’ne başkan- lık yapmıştır. World War I and the End of the Ottomans (2015), Nearest East: American Millennialism and Mission to the Middle East (2010), Vorkämpfer der “neuen Türkei” (2005, Türkçede: Türklüğe İhtida, 2008, İletişim Yayınları), Turkey Beyond Nationalism (2005), Der verpasste Friede (2000, Türkçede: Iskalanmış Barış, (2005, 5. baskı 2018, İletişim Yayınları) ve Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah (2002, 3. baskı 2014) yayınları arasındadır. Halen Lozan Konferansı ve Antlaşması’nın tarihi üzerine çalışmaktadır. Talaat Pasha. Father of Modern Turkey, Architect of Genocide © 2018 Hans-Lukas Kieser İletişim Yayınları 2998 • Tarih Dizisi 151 ISBN-13: 978-975-05-3062-3 © 2021 İletişim Yayıncılık A.Ş. / 1. BASIM 1. Baskı 2021, İstanbul EDİTÖR Merve Öztürk KAPAK Suat Aysu KAPAK FOTOĞRAFI Talat Paşa, 1910 UYGULAMA Hüsnü Abbas DÜZELTİ Remzi Abbas DİZİN Berkay Üzüm BASKI Ayhan Matbaası · SERTİFİKA NO. 44871 Mahmutbey Mahallesi, 2622. Sokak, No: 6/31 Bağcılar 34218 İstanbul Tel: 212.445 32 38 • Faks: 212.445 05 63 CİLT Güven Mücellit · SERTİFİKA NO. 45003 Mahmutbey Mahallesi, Devekaldırımı Caddesi, Gelincik Sokak, Güven İş Merkezi, No: 6, Bağcılar, İstanbul, Tel: 212.445 00 04 İletişim Yayınları · SERTİFİKA NO. 40387 -

The Rarity of Realpolitik the Rarity of Brian Rathbun Realpolitik What Bismarck’S Rationality Reveals About International Politics
The Rarity of Realpolitik The Rarity of Brian Rathbun Realpolitik What Bismarck’s Rationality Reveals about International Politics Realpolitik, the pur- suit of vital state interests in a dangerous world that constrains state behavior, is at the heart of realist theory. All realists assume that states act in such a man- ner or, at the very least, are highly incentivized to do so by the structure of the international system, whether it be its anarchic character or the presence of other similarly self-interested states. Often overlooked, however, is that Real- politik has important psychological preconditions. Classical realists note that Realpolitik presupposes rational thinking, which, they argue, should not be taken for granted. Some leaders act more rationally than others because they think more rationally than others. Hans Morgenthau, perhaps the most fa- mous classical realist of all, goes as far as to suggest that rationality, and there- fore Realpolitik, is the exception rather than the rule.1 Realpolitik is rare, which is why classical realists devote as much attention to prescribing as they do to explaining foreign policy. Is Realpolitik actually rare empirically, and if so, what are the implications for scholars’ and practitioners’ understanding of foreign policy and the nature of international relations more generally? The necessity of a particular psy- chology for Realpolitik, one based on rational thinking, has never been ex- plicitly tested. Realists such as Morgenthau typically rely on sweeping and unveriªed assumptions, and the relative frequency of realist leaders is difªcult to establish empirically. In this article, I show that research in cognitive psychology provides a strong foundation for the classical realist claim that rationality is a demanding cogni- tive standard that few leaders meet. -
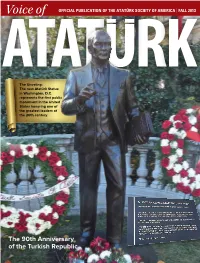
The 90Th Anniversary of the Turkish Republic CHAIRMAN’S COMMENTS the Atatürk Society of America Voice of 4731 Massachusetts Ave
Voice of OFFICIAL PUBLICATION OF THE ATATÜRK SOCIETY OF AMERICA | FALL 2013 The Unveling: The new Atatürk Statue in Washington, D.C. represents the first public monument in the United States honoring one of the greatest leaders of the 20th century. The 90th Anniversary of the Turkish Republic CHAIRMAN’S COMMENTS The Atatürk Society of America Voice of 4731 Massachusetts Ave. NW CONTENTS Washington DC 20016 Phone 202 362 7173 Fax 202 363 4075 Mustafa Kemal’in Askerleriyiz... CHAIRMAN’S COMMENTS E-mail [email protected] 03 www.Ataturksociety.org Reversal of the Atatürk miracle— We are the soldiers of Mustafa Kemal... Destruction of Secular Democracy EXECUTIVE BOARD “There are two Mustafa Kemals. One, the flesh-and-blood Mustafa Kemal who now stands before Hudai Yavalar you and who will pass away. The other is you, all of you here who will go to the far corners of our President land to spread the ideals which must be defended with your lives if necessary. I stand for the nation's Prof. Bülent Atalay PRESIDENT’S COMMENTS dreams, and my life's work is to make them come true.” 04 Vice President —Mustafa Kemal Atatürk 10th of November — A day to Mourn Filiz Odabas-Geldiay Dr. Bulent Atalay Treasurer Members Believing secularism , democracy, science and technology Mirat Yavalar Aynur Uluatam Sumer 06 he year 2013 marked the 90th anniversary of the founding of the Turkish Republic. And ASA NEWS Secretary Ilknur Boray Hudai Yavalar 05 it was also the year of the most significant uprising in the history of Turkey. The chant Lecture by Dr. -

Sholem Schwarzbard: Biography of a Jewish Assassin
Sholem Schwarzbard: Biography of a Jewish Assassin The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Johnson, Kelly. 2012. Sholem Schwarzbard: Biography of a Jewish Assassin. Doctoral dissertation, Harvard University. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:9830349 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA © 2012 Kelly Scott Johnson All rights reserved Professor Ruth R. Wisse Kelly Scott Johnson Sholem Schwarzbard: Biography of a Jewish Assassin Abstract The thesis represents the first complete academic biography of a Jewish clockmaker, warrior poet and Anarchist named Sholem Schwarzbard. Schwarzbard's experience was both typical and unique for a Jewish man of his era. It included four immigrations, two revolutions, numerous pogroms, a world war and, far less commonly, an assassination. The latter gained him fleeting international fame in 1926, when he killed the Ukrainian nationalist leader Symon Petliura in Paris in retribution for pogroms perpetrated during the Russian Civil War (1917-20). After a contentious trial, a French jury was sufficiently convinced both of Schwarzbard's sincerity as an avenger, and of Petliura's responsibility for the actions of his armies, to acquit him on all counts. Mostly forgotten by the rest of the world, the assassin has remained a divisive figure in Jewish-Ukrainian relations, leading to distorted and reductive descriptions his life. -

Germany Minds
SCHENDERLEIN GERMANY ON THEIR MINDS German Jewish Refugees in the United States and Their Relationships with Germany, 1938–1988 GERMANY ANNE C. SCHENDERLEIN ON THEIR is is a solid, comprehensive study of German Jewish refugees in the United States, especially in Los Angeles and New York. It is probing and judicious. Michael A. Meyer, Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion MINDS THEIR ON GERMANY roughout the 1930s and early 1940s, approximately ninety thousand German MINDS Jews ed their homeland and settled in the United States, prior to that nation closing its borders to Jewish refugees. And even though many of them wanted little to do with Germany, the circumstances of World War II and the postwar era meant that engagement of some kind was unavoidable—whether direct or indirect, initiated within the community itself or by political actors and the broader German public. is book carefully traces these entangled histories on GERMAN JEWISH REFUGEES both sides of the Atlantic, demonstrating the remarkable extent to which German Jews and their former fellow citizens helped to shape developments from the IN THE UNITED STATES AND THEIR Allied war e ort to the course of West German democratization. RELATIONSHIPS WITH GERMANY, 19381988 Anne C. Schenderlein is the managing director of the Dahlem Humanities Cen- ter at Freie Universität Berlin. After receiving her doctorate in modern European history at the University of California, San Diego, she was a research fellow at the German Historical Institute from 2015 to 2019. Her research has been sup- ported by numerous fellowships, including the Leo Baeck Fellowship and, more recently, a grant from the American Jewish Archives, where she conducted research on American Jewish boycotts and consumption of German products. -

Schliemann and His Papers 787
HESPERIA 76 (2OO7) SCHLIEMANN AND HIS Pages 785-817 PAPERS A Tale from the Gennadeion Archives ABSTRACT Heinrich Schliemanns heirs deposited most of his personal papers in the Gennadius Library of the American School of Classical Studies at Athens over in 1936, but retained control them until the School purchased them in 1962. For 27 years, the heirs granted sole authorization to exploit the papers access to Ernst Meyer, who published only limited excerpts, obstructed the of other researchers, and borrowed several volumes that were never returned. The author explores the troubled history of the Heinrich Schliemann Papers since the archaeologist's death in 1890 and examines the ways inwhich recent access are new on improvements in cataloguing and facilitating research Schliemann s life and career in their historical context. The basic outline of Heinrich Schliemanns life is fairly well known: his successes parsonage childhood and straitened youth, the entrepreneurial of his maturity, his quest for the Greek bride who became his second wife, and the famous archaeological discoveries of his later career.1 Schliemann own frequently publicized his life story, beginning with the preface to The abbreviations for archival 1.1 thank Natalia Vogeikoff-Brogan, following - archivist of the American School of documentation are used: HS&FP Studies at for Heinrich Schliemann and Classical Athens, grant Family Papers; access to GennRec = Gennadeion ing the Schliemann Papers Records, and to the Schliemann approval publish elements of Correspondence Folders; further work B = Heinrich series correspondence, enabling Schliemann Papers, on = the database, and for encouragement B: Correspondence; BBB Heinrich are to and advice; special thanks due Schliemann Papers, series BBB: Copy Maria Voltera and Katerina Papatheo books. -

Exploring the Evidence the Holocaust, Cambodian Genocide, and Canadian Intervention Centre Commémoratif De L’Holocauste À Montreal
Student Materials Exploring the Evidence The Holocaust, Cambodian Genocide, and Canadian Intervention Centre commémoratif de l’Holocauste à Montreal 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine Montréal (Québec) H3W 1M6 Canada Phone : 514-345-2605 Fax : 514-344-2651 Email : [email protected] museeholocauste.ca/en Produced by the Montreal Holocaust Museum, 2012, 2018 Content and production: Sabrina Moisan, Original concept Cornélia Strickler, Head of Education Erica Fagen, Education Agent Emma Hoffman, Michelle Fishman, and Carson Phillips, Ph.D., Adaptation of pedagogical tool for Ontario, Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre Claudia Seidel, Research intern Graphic Design: Fabian Will and Kina Communication ISBN: 978-2-924632-58-1 (PDF), 978-2-924632-57-4 (print) Legal deposit - Bibliothèque et Archives nationales Québec, 2018 Acknowledgements: This project has been made possible in part by the Government of Canada. © Montreal Holocaust Museum, 2018 B Student Materials Table of Contents Part 1 - The Holocaust .........................................................................2 Activity 1 - Initiating activity / trigger ..............................................2 Activity 2 - Activating students’ knowledge ...................................4 Activity 3 - Historical examination of the Holocaust .................... 11 Activity 4 - Analysis of Canada’s intervention ............................. 42 Part 2 - Human Rights and Intervention ............................................. 62 Activity 1 - Human Rights -

Rigg Bm.Pdf (651.5Kb)
notes note on sources Although oral testimonies are subject to fallible human memories, they have none- theless proven invaluable in explaining several documents collected for this study. Documents never before seen by historians, found in people’s closets, basements, and desk drawers, created a much fuller and complex history, especially when their owners supplied the background and history of the documents as well. These sources helped re-create the unique and tragic history of the Mischlinge, which is still so little understood over half a century later. The thousands of pages of documents and oral testimonies (on 8 mm video and VHS video) in this study are now part of the permanent collection at the Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg, Germany, as the Bryan Mark Rigg Collection. Although interviews need to be treated with some skepticism, they have repeatedly shown that oral history often enriches rather than contradicts historical documents. All too often, history is written without the human element, that is, without knowing what these people thought, felt, and believed. Oral history helps reconstruct many of these people’s thoughts, feelings, and beliefs through their diaries, letters, interviews, and photographs. In this way, a healthy combination of hard documents or primary sources and secondary sources and testimonies expands our sense of this history. Often one reads about men and women but feels no human connection with them. The interviews were done to try to bridge this gap and to pro- vide readers with the means to enter these men’s and women’s thoughts and feelings to understand them better and to deepen readers’ knowledge of this history. -
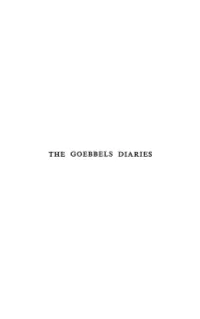
The Goebbels Diaries the Goebbels Diaries
THE GOEBBELS DIARIES THE GOEBBELS DIARIES Translated and Edited by LOUIS P. LOCHNER HAMISH HAMILTON LONDON Fust Published in Great !Jritain 1948 IU.Dlt AND PRINTRD tN GRL\"r BRITAIN BY PURNllLL AND SONS, 1.'1 D-1 PAULTOM (soiOillSIIT) AND LONDON PUBLISHER'S NOTE WHEN THE Russians occupied Berlin in 1945 they went through the . German official archives with more vigour than discrimination, lihipped some material to Russia, destroyed some, and left the rest scattered underfoot. They often followed a system that is difficult to understand of emptying papers on the floor and shipping to Russia the filing cabinets that had contained them. Considerable fragments of Dr. Goebbels' diaries, from which the following pages were selected, were found in the courtyard of his ministry, where they had evidently narrowly escaped burning, many of the pages being singed and all smelling of smoke. Apparently they were originally bound in the German type of office folder. Thin metal strips in the salmon-coloured binders wete run through holes punched in the paper, bent over, and locked into place. At that time all Berlin was one great junk yard wi~h desperate people laying hands on anything tangible and movable that could be used for barter. The unburned papers were taken away by one of these amateur junk dealers, who carefully salvaged the binders and discarded the contents-leaving more than 7,000 sheets of loose paper. A few binders had not been removed but most of the pages were tied up in bundles as waste paper. It later proved a considerable task to put them together again in the right sequence, as they were not numbered. -

Bismarck : the Dishonest Broker?
BISMARCK ~ THE DISHONEST BROKER? by M. DALE CARLSON B. S,, Kansas State University, 195>9 A MASTERS THESIS submitted in partial fulfillment ol the requirements for the degree MASTER OF ARTS Department of History, Political Science and Philosophy KANSAS STATE UNIVERSITY Manhattan, Kansas 196U Approved by: Major Professor LP PfCU). ACKNOWLEDGMENTS I wish to express my sincere gratitude to Er# Werner H. Barth tor his assistance in the writing of this paper. Kis suggestions, cooperation, patience and kind understanding have been of tremendous assistance. The library staff of Kansas State University and Nebraska University have my deepest thanks tor the patient assistance they have given me in the collection of material tor this paper. Appreciation must also be expressed to my wife Margaret, whose typing, editing and encouragement have been essential in the com- pletion of this paper. PREFACE From June 13 until July 13, an International gathering of the leading statesmen of Europe met at the Congress of Berlin to decide the fate of the Treaty of San Stefano signed between Russia and Turkey to conclude the Russo- Turkish War of 1877-78. At this Congress, Otto von Bismarck reached the height of his political career* Representing a powerful Germany that he had helped to construct, he presided as President of one of the three great Congresses of the Nineteenth Century* Bismarck professed that he entered the Congress as the n Honest Broker" and would serve as umpire between the great powers of Europe. He stated openly that Germany had nothing to gain, and no interests to serve in the Eastern Question.