Prof. Dr. Peter Fischer Vors
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deutscher Bundestag Drucksache 19/6961 11.01.2019 19
Deutscher Bundestag Drucksache 19/6961 11.01.2019 19. Wahlperiode ersetzt. - wird durch die lektorierte Version Vorabfassung Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 7. Januar 2019 eingegangenen Antworten der Bundesregierung Verzeichnis der Fragenden Abgeordnete Nummer Abgeordnete Nummer der Frage der Frage Amtsberg, Luise (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .... 54 Dehm, Diether, Dr. (DIE LINKE.) ................... 29, 100 Andreae, Kerstin Domscheit-Berg, Anke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ................................ 24 (DIE LINKE.) ...................................... 30, 31, 74, 117 Badum, Lisa Ernst, Klaus (DIE LINKE.) .............................. 75, 118 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ........................ 55, 126 Faber, Marcus, Dr. (FDP) ....................................... 101 Baerbock, Annalena (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Fricke, Otto (FDP) .............................................. 92, 93 ................................................................................. 114 Frömming, Götz, Dr. (AfD) ..................................... 61 Barrientos, Simone (DIE LINKE.) ..................... 1, 2, 3 Gastel, Matthias Bause, Margarete (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ............................. 119 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .................... 25, 56, 57 Hänsel, Heike (DIE LINKE.) ................................... 76 Bayaz, Danyal, Dr. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .... 9, 10, 11, 12, 13, 14 Höferlin, Manuel (FDP) ..................................... 32, 33 Bayram, Canan Holm, Leif-Erik (AfD) ................................. 4, 5, 6, 34 (BÜNDNIS -

GAMING ESPORT Trend Book
GAMING ESPORT & Trend book Wstęp właścicielami drużyn) i w końcu stworzyć i zre- dagować tekst. W ten sposób członkowie projek- W czerwcu 2017 zorganizowana została konfe- tu uczyli się pracy zespołowej, przekonywali jak rencja Esport & Gaming Forum. Organizatorom, ważna jest skrupulatność, punktualność i reali- MediaCom Beyond Advertising i sawik.tv udało zacja powierzonych zadań. Być może najważ- się dotrzeć z wydarzeniem do ponad pół tysią- niejsza była możliwość poznania innych osób ca osób z branży reklamowej, zainteresowa- o podobnych zainteresowaniach i celach. To nie- nych zdobyciem unikatowej wiedzy gamignowej wątpliwie będzie owocować w przyszłości. i esportowej. Finalnie dzięki wspólnemu wysił- kowi wszystkich prelegentów udało się nie tylko Musicie mieć państwo na względzie, że dokument stworzyć jedno z najważniejszych i największych tworzony był przez amatorów, z niewielkim do- tego typu wydarzeń na polskiej arenie, ale także świadczeniem, ale z wielką ambicją. Konsekwen- ustanowić pewne standardy na najbliższy czas. cją jest bardzo nierówny poziom merytoryczny W efekcie powstała także ta publikacja. artykułów. Niektóre teksty mają również wyraźne braki warsztatowe i językowe. Zdecydowaliśmy Raport, który trafia w Państwa ręce to dokument się jednak na publikację raportu w tej formie, bo o szczególnym, eksperymentalnym charakterze. charakter projektu jest eksperymentalny. Ważniejszy bowiem od samej treści jest proces jego powstawania. Prace nad tekstami, research, redakcja, skład, trwały przez ponad 6 miesięcy. W tym czasie -

Drucksache 19/7724
Deutscher Bundestag Drucksache 19/7724 19. Wahlperiode 13.02.2019 Antrag der Abgeordneten Ulrike Schielke-Ziesing, Martin Hebner, Sebastian Münzenmaier, Jürgen Pohl, Jörg Schneider, Martin Sichert, René Springer, Uwe Witt, Marc Bernhard, Stephan Brandner, Marcus Bühl, Petr Bystron, Tino Chrupalla, Joana Cotar, Siegbert Droese, Dr. Michael Espendiller, Peter Felser, Dietmar Friedhoff, Dr. Anton Friesen, Markus Frohnmaier, Wilhelm von Gottberg, Kay Gottschalk, Armin-Paulus Hampel, Verena Hartmann, Dr. Roland Hartwig, Martin Hess, Karsten Hilse, Martin Hohmann, Dr. Bruno Hollnagel, Enrico Komning, Jörn König, Steffen Kotré, Rüdiger Lucassen, Dr. Birgit Malsack-Winkemann, Andreas Mrosek, Volker Münz, Christoph Neumann, Gerold Otten, Frank Pasemann, Martin Reichardt, Dr. Robby Schlund, Uwe Schulz, Thomas Seitz, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, Dr. Harald Weyel, Dr. Christian Wirth und der Fraktion der AfD Sofortmaßnahme Armutsbekämpfung bei Rentnern Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Die Höhe der Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung hängt im Wesentlichen von der Beitragsleistung ab, der sogenannten Beitragsäquivalenz. Die persönlichen Entgeltpunkte (§ 66 SGB VI) bilden dabei den individuellen Faktor der Rentenformel. Aus der grundsätzlich bestehenden Proportionalität zwischen Rentenansprüchen und Beitragszahlungen ergibt sich auch, dass die Verhinderung von Altersarmut system- bezogen nicht im Fokus steht. Dies gilt auch für die durch das „RV-Leistungsverbes- serungsgesetz“ vorgenommenen Verbesserungen hinsichtlich der Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten. Ein Teil der Altersrentner bezieht aus den unterschiedlichsten Gründen nur niedrige Renten, so etwa, weil sie mit Rücksicht auf die Kindererziehung über längere Zeit nicht oder nur in Teilzeit berufstätig waren, einen Familienangehörigen gepflegt haben, die Erwerbsbiografie aus gesundheitlichen Gründen unterbrochen wurde oder weil nur re- lativ niedrige Verdienste erzielt wurden. -
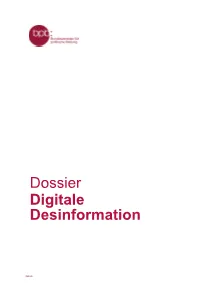
Dossier Digitale Desinformation
Dossier Digitale Desinformation bpb.de Dossier: Digitale Desinformation (Erstellt am 30.09.2021) 2 Einleitung Im Vorfeld von Wahlen stellt sich zunehmend die Frage, welchen Einfluss haben Bots und andere Formen automatisierter Kommunikation auf Meinungsbildung und Wahlentscheidung? Wer kontrolliert den Diskurs in den sozialen Medien? Spielt sich die Diskussion überhaupt noch dort ab? Nutzerinnen und Nutzer wandern zunehmend zu anderen Angeboten ab, in denen gar nicht mehr öffentlich kommuniziert wird. Führt die Verlagerung der Kommunikation in die geschlossene Kanäle der Messenger-Dienste zum Tod der digitalen politischen Öffentlichkeit? Mehr dazu im Dossier "Digitale Desinformation". bpb.de Dossier: Digitale Desinformation (Erstellt am 30.09.2021) 3 Inhaltsverzeichnis 1. Desinformation und Bundestagswahl 2021 5 1.1 Bundestagswahl und digitale Desinformation IV 6 1.2 Bundestagswahl und digitale Desinformation III 8 1.3 Bundestagswahl und digitale Desinformation II 11 1.4 Das Narrativ vom Wahlbetrug 14 1.5 Hybride Bedrohung als internationale Herausforderung 17 1.6 Selbstverpflichtungen für einen fairen digitalen Wahlkampf 20 1.7 Transparenz als Mittel gegen die digitale Verbreitung von Desinformation 24 1.8 Bundestagswahl und digitale Desinformation I 28 2. Desinformation - Der globale Blick 31 2.1 Podcast: Netz aus Lügen – Der Hack (1/7) 33 2.2 Impressum 48 3. Was ist Digitale Desinformation 49 3.1 Desinformation: Vom Kalten Krieg zum Informationszeitalter 50 3.2 Von der Aufmerksamkeits-Ökonomie zur desinformierten Gesellschaft? 54 3.3 -

ANNEXURE A: Sanction Outcomes Findings As at 28 September 2020
ANNEXURE A: Sanction Outcomes Findings as at 28 September 2020 # Concessions Net ban Total rounds # Coach Sanction Tier Team Enemy Team Tournament Date Map Round Start Round End Match Link Video Link cases applied (%) (months) triggered iGame.com Tricked Europe Minor Closed Qualifier - PGL Major Krakow 2017 19-Jul-2017 Nuke 0 - 0 22 - 25 47 Match Link Video Link 1 Twista 2 Tier 1 12.50% 15.75 iGame.com Spirit Academy Hellcase Cup 6 6-Sep-2017 Nuke 18 - 18 20 - 22 6 Match Link Video Link maquinas Ambush ESEA Season 32 Advanced Playoffs 14-Nov-2019 Mirage 0 - 0 16 - 7 23 Match Link Video Link 2 casle 2 Tier 2 0 10 maquinas North WESG 2019 North Europe Closed Qualifier 27-Nov-2019 Overpass 4 - 9 16 - 19 22 Match Link Video Link Furious Gaming Latingamers La Liga Pro Trust 2019 - Apertura 25-Aug-2019 Mirage 0 - 0 0 - 1 1 Match Link Video Link 3 dinamito 2 Tier 2 0 10 Furious Gaming Sinisters Aorus League 2019 #3 Southern Cone 6-Sep-2019 Inferno 0 - 0 11 - 16 27 Match Link Video Link 4 ArnoZ1K4 1 Tier 2 0 10 Evidence Reapers Dell Gaming Liga Pro Season 1 - #4 APR/19 12-Apr-2019 Train 0 - 0 16 - 10 26 Match Link Video Link Tricked pro100 LOOT.BET Cup 2 - cs_summit 2 Qualifier 13-Dec-2017 Mirage 0 - 0 11 - 7 18 Match Link Video Link Tricked EURONICS United Masters League 21-Nov-2018 Dust2 0 - 0 4 - 2 6 Match Link Video Link Tricked LDLC United Masters League 28-Nov-2018 Mirage 0 - 0 16 - 12 28 Match Link Video Link Tier 1 5 Rejin 7 45% 19.8 Tricked HAVU Kalashnikov CUP 29-Nov-2018 Train 0 - 0 10 - 15 25 Aggravated Match Link Video Link Tricked -

Drucksache 19/25305
Deutscher Bundestag Drucksache 19/25305 19. Wahlperiode 16.12.2020 Antrag der Abgeordneten Jörn König, Joana Cotar, Uwe Schulz, Dr. Michael Espendiller, Wolfgang Wiehle, Stephan Brandner, Peter Felser, Dr. Heiko Heßenkemper, Martin Hohmann, Stefan Keuter, Andreas Mrosek, Ulrich Oehme, Gerold Otten, Tobias Matthias Peterka, Dr. Robby Schlund, Uwe Schulz, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, Dr. Christian Wirth und der Fraktion der AfD Steuerverwaltung mit Distributed-Ledger-Technologien – Zukunftsfähig durch Innovation im öffentlichen Sektor Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: In einer immer komplexer werdenden Gesellschaft, bei der Technologie in nahezu al- len Lebensbereichen unerlässlich geworden ist, fist das rühzeitige Erkennen der „Tech- nologie von Morgen“ von zentraler Bedeutung. Bei der Digitalisierung wünschen sich 75 % der Deutschen, dass Deutschland in diesem Bereich Spitzenreiter wird (https://gblogs.cisco.com/de/die-deutschen-wollen-bei-digitalisierung-weltspitze- sein/). In der Realität jedoch ist die Tendenz eine andere. Im aktuellen Cisco Digital Readiness Report von 2019 ist Deutschland von Rang 6 auf Rang 14 gerutscht. Mit- hilfe dieses Indexes kann der digitale Reifegrad eines Landes international gemessen werden. Dies liegt darin begründet, dass andere Länder bessere Rahmenbedingungen für die Digitalisierung schaffen als Deutschland. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, müssen die großen Potentiale der moder- nen Technologien durch den Staat erkannt werden und schnellstmöglich -
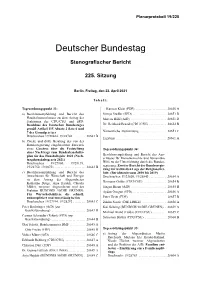
Plenarprotokoll 19/225
Plenarprotokoll 19/225 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 225. Sitzung Berlin, Freitag, den 23. April 2021 Inhalt: Tagesordnungspunkt 33: Karsten Klein (FDP) . 28650 A a) Beschlussempfehlung und Bericht des Svenja Stadler (SPD) . 28651 B Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Marcus Bühl (AfD) . 28651 D Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Beschluss des Deutschen Bundestages Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU) . 28652 B gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes Namentliche Abstimmung . 28653 C Drucksachen 19/28464, 19/28740 . 28643 B Ergebnis . 28661 A b) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung Tagesordnungspunkt 34: eines Nachtrags zum Bundeshaushalts- plan für das Haushaltsjahr 2021 (Nach- Beschlussempfehlung und Bericht des Aus- tragshaushaltsgesetz 2021) schusses für Menschenrechte und humanitäre Drucksachen 19/27800, 19/28139, Hilfe zu der Unterrichtung durch die Bundes- 19/28750, 19/28751 . 28643 B regierung: Zweiter Bericht der Bundesregie- rung zur weltweiten Lage der Religionsfrei- c) Beschlussempfehlung und Bericht des heit: (Berichtszeitraum 2018 bis 2019) Ausschusses für Wirtschaft und Energie Drucksachen 19/23820, 19/28843 . 28654 A zu dem Antrag der Abgeordneten Katharina Dröge, Anja Hajduk, Claudia Hermann Gröhe (CDU/CSU) . 28654 B Müller, weiterer Abgeordneter und der Jürgen Braun (AfD) . 28655 B Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Aydan Özoğuz (SPD) . 28656 A Für Wirtschaftshilfen, die schnell, unkompliziert und zuverlässig helfen Peter Heidt (FDP) . 28657 B Drucksachen 19/27194, 19/28292 . 28643 C Zaklin Nastic (DIE LINKE) . 28658 A Peter Boehringer (AfD) (zur Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 28659 A Geschäftsordnung) . 28643 D Michael Brand (Fulda) (CDU/CSU) . 28659 C Carsten Schneider (Erfurt) (SPD) (zur Sebastian Brehm (CDU/CSU) . -

Drucksache 19/11708 19
Deutscher Bundestag Drucksache 19/11708 19. Wahlperiode 16.07.2019 Kleine Anfrage der Abgeordneten Petr Bystron, Jürgen Braun, Dr. Lothar Maier, Dr. Rainer Kraft, Waldemar Herdt, Dr. Harald Weyel, Udo Theodor Hemmelgarn, Stefan Keuter, Andreas Mrosek, Enrico Komning, Martin Sichert, Paul Viktor Podolay, Jörn König, Uwe Witt, Franziska Gminder, Dr. Heiko Heßenkemper, Kay Gottschalk, Thomas Seitz, Jens Maier, Stephan Protschka, Martin Hess, Joana Cotar, Armin-Paulus Hampel, Wilhelm von Gottberg, Steffen Kotré, Thomas Ehrhorn, Tobias Matthias Peterka, Dietmar Friedhoff, Peter Boehringer und der Fraktion der AfD Hintergründe der Befreiung von Billy Six aus Venezuela Am 18. März 2019 kehrte der deutsche Journalist Billy Six nach Deutschland zu- rück. Zuvor hatte er 119 Tage in venezolanischer Haft verbracht – davon haupt- sächlich im berüchtigten Gefängnis „El Helicoide“, einer Einrichtung des politi- schen Geheimdiensts SEBIN (www.berliner-zeitung.de/32228696?dmcid=sm_tw). Billy Six ist am 17. November 2018 in Venezuela verhaftet worden. Dies auf- grund seiner Tätigkeit als freischaffender Reporter, der über die angespannte Lage des Landes berichtet hatte (www.spiegel.de/politik/ausland/venezuela- deutscher-reporter-billy-six-in-venezuela-verhaftet-a-1244013.html). Als Zivilist ist er vor einem Militärgericht unter anderem wegen „Spionage“ und „Rebellion“ angeklagt worden. Diese Vorwürfe wurden bereits vor seiner Haftentlassung vom 15. März 2019 fallen gelassen (www.tagesspiegel.de/politik/billy-six-deutscher- reporter-aus-haft-in-venezuela-entlassen/24110970.html). -

Esport: Defusing Governance
Esport: Defusing Governance Nicolai Bouet 55466 & Oskar Rørbye Rønn 43062 Master Thesis Pages: 103 Characters including spaces: 233,642 MSc International Business / Cand.merc.International Business Supervisor: Sven Junghagen Co-supervisor: Philippe Bochaton 15/05/2018 Abstract The purpose of this thesis is to explore how esport is governed and to investigate whether governance is an important factor in esports at the professional level. To do this, the methodology developed by Geeraert and co-authors (2014) and AGGIS are combined to create a checklist of governance indicators for esport. Focusing on the relationship between game publishers, event organisers, and esport organisations, a sample of thirteen esports and eleven event organisers are investigated and eight interviews are conducted to obtain industry knowledge directly. Main findings are that esport is governed either by the game publisher, event organiser, or a combination of both, and that currently governance have a limited impact on esport. The potential limitations of this thesis are the lack of diversity across interviewees and lack of game publisher willingness to participate. 2 of 121 Table of Contents ABSTRACT ...................................................................................................................................................... 2 ABBREVIATIONS .......................................................................................................................................... 5 INTRODUCTION .......................................................................................................................................... -

Drucksache 19/2392
Deutscher Bundestag Drucksache 19/2392 19. Wahlperiode 30.05.2018 Antrag der Abgeordneten Dr. Bernd Baumann, Marc Bernhard, Andreas Bleck, Peter Boehringer, Stephan Brandner, Jürgen Braun, Marcus Bühl, Matthias Büttner, Petr Bystron, Tino Chrupalla, Joana Cotar, Dr. Gottfried Curio, Siegbert Droese, Thomas Ehrhorn, Berengar Elsner von Gronow, Dr. Michael Espendiller, Peter Felser, Dietmar Friedhoff, Dr. Anton Friesen, Dr. Götz Frömming, Markus Frohnmaier, Dr. Alexander Gauland, Dr. Axel Gehrke, Albrecht Glaser, Franziska Gminder, Wilhelm von Gottberg, Kay Gottschalk, Armin-Paulus Hampel, Mariana Harder-Kühnel, Verena Hartmann, Dr. Roland Hartwig, Jochen Haug, Martin Hebner, Udo Theodor Hemmelgarn, Waldemar Herdt, Lars Herrmann, Martin Hess, Dr. Heiko Heßenkemper, Karsten Hilse, Nicole Höchst, Martin Hohmann, Dr. Bruno Hollnagel, Leif-Erik Holm, Johannes Huber, Fabian Jacobi, Dr. Marc Jongen, Uwe Kamann, Jens Kestner, Stefan Keuter, Norbert Kleinwächter, Enrico Komning, Jörn König, Steffen Kotré, Dr. Rainer Kraft, Rüdiger Lucassen, Frank Magnitz, Jens Maier, Dr. Lothar Maier, Dr. Birgit Malsack-Winkemann, Corinna Miazga, Andreas Mrosek, Hansjörg Müller, Volker Münz, Sebastian Münzenmaier, Christoph Neumann, Jan Ralf Nolte, Ulrich Oehme, Gerold Otten, Frank Pasemann, Tobias Matthias Peterka, Paul Viktor Podolay, Jürgen Pohl, Stephan Protschka, Martin Reichardt, Martin Erwin Renner, Roman Reusch, Ulrike Schielke-Ziesing, Dr. Robby Schlund, Jörg Schneider, Uwe Schulz, Thomas Seitz, Martin Sichert, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, René Springer, Beatrix von Storch, Dr. Alice Weidel, Dr. Harald Weyel, Wolfgang Wiehle, Dr. Heiko Wildberg, Dr. Christian Wirth, Uwe Witt und der Fraktion der AfD Einsetzung eines Untersuchungsausschusses Asyl- und Migrationspolitik Der Bundestag wolle beschließen: A. Der Deutsche Bundestag beschließt: Es wird ein Untersuchungsausschuss gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes eingesetzt. -

Vorabfassung
Deutscher Bundestag Drucksache 19/30438 19. Wahlperiode 09.06.2021 Beschlussempfehlung und Bericht des Verteidigungsausschusses (12. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Joana Cotar, Uwe Schulz, Dr. Michael Espendiller, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD – Drucksache 19/29783 – Anreizprogramme für IT-Sicherheit bei der Bundeswehr ausbauen A. Problem Die immer weiter voranschreitende Digitalisierung der Bundeswehr betreffe die gesamten Organisationsstrukturen über alle Einheiten hinweg. Für die Streitkräfte sei die Digitalisierung der Schlüssel zur Informations-, Führungs- und Wirkungs- überlegenheit wie auch zur Verbesserung der Durchsetzungs- und Reaktionsfä- higkeit. Die Komplexität der IT-Infrastruktur stelle die Bundeswehr hinsichtlich eines sicheren Betriebs der zum Einsatz kommenden Technologien vor besondere Herausforderungen. Eine wesentliche Gefahr seien Hacker-Angriffe. Es sei davon auszugehen, dass der Umfang an Bedrohungen in Zukunft noch weiter steigen. Um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, betreibe die Bundeswehr seit Okto- ber 2020 ein Bug Bounty-Programm namens Vulnerability Disclosure Policy (VDPBw). Hierbei überprüften sogenannte White Hat Hacker die IT-Infrastruktur auf sicherheitsrelevante Schwachstellen. Momentan sei das Bug Bounty-Pro- gramm der Bundewehr für White Hat Hacker weitestgehend unattraktiv, da die Bundeswehr lediglich eine Danksagung auf ihrer Webseite anbiete. Andere Län- der wie die Vereinigten Staaten von Amerika hätten hier bereits eine Vorreiter- rolle inne. B. Lösung Ablehnung -

Beispiel Studienheft
Leseprobe Modul: e-Sport-Management Studienheft: Management von e-Sport-Events und -Teams Autoren: Niklas Timmermann Auszug aus dem Studienheft 2. Exemplarischer Aufbau eines Profiteams inkl. Problemstellungen 61 Kapitel 2 2. Exemplarischer Aufbau eines Profiteams inkl. Problemstellungen 2.1 Abgrenzung Profiteam zu Nicht-Profiteam 2.1.1 Werksteam 2.1.1.1 Deutsche Werksteams 2.1.1.2 Zielstellung und Eintrittsgründe 2.1.1.3 Vergleich in der Wahrnehmung: Werksteam im Sport vs. im eSport 2.1.2 Sonstige Profiteams 2.1.2.1 Definition 2.1.2.2 Zielstellung und Eintrittsgründe 2.2 Struktur und Aufgabenbereiche in Profiteams 2.2.1 Struktur von Profiteams in der Übersicht 2.2.1.1 Teamleitung 2.2.1.2 General Manager 2.2.1.3 Team Manager 2.2.1.4 Socials (Content) 2.2.1.5 Vertrieb 2.2.1.6 Spieler 2.2.1.7 Influencer 2.2.1.8 Coach und Analyst 2.3 Strategische Vorüberlegungen bei einer Teamgründung 2.3.1 Marke 2.3.2 Sitz 2.3.3 Spielwahl 2.3.4 Spielerwahl 2.3.5 Rechteaufteilung und -knappheit 2.3.6 Preisgelder 2.3.7 Verträge 2.4 Kostenübersicht Profiteam © 08/2020 Leseprobe „Bachelor of Arts e-Sport-Management“ 62 2. Exemplarischer Aufbau eines Profiteams inkl. Problemstellungen Lernorientierung Nach Bearbeitung dieses Kapitels sind Sie in der Lage, • die grundlegenden Unterschiede zwischen Werksteams und sons- tigen Profiteams wiederzugeben; • das notwendige Personal inklusive der groben Aufgabenbereiche für ein Profiteam zu benennen; • relevante strategische Grundsatzentscheidungen bei der Entwick- lung eines Teams zu erklären; • die größten Kostenpunkte inklusive ihrer Gewichtung bei einem Team zu kennen.