Whose Blood Waters Whose Freedom?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report 2015
ANNUAL REPORT 2015 1 TABLE OF CONTENTS 1. BACKGROUND .................................................................................................................. 4 2. PROGRAMME PURPOSE .................................................................................................. 4 3. WHERE WE WORK ............................................................................................................ 5 4. PROGRAMMES .................................................................................................................. 6 4.1 HEALTH AND SOCIAL SERVICE ................................................................................ 6 4.1.1 Malaria ..................................................................................................................... 6 4.1.2 Immunisation ............................................................................................................ 6 4.1.3 HIV/AIDS .................................................................................................................. 6 4.1.4 Tuberculosis ............................................................................................................. 6 4.1.5 First Aid .................................................................................................................... 6 4.1.6 Water, Sanitation and Hygiene Promotion ................................................................ 7 4.2 DISASTER MANAGEMENT ........................................................................................ 8 4.2.1 -
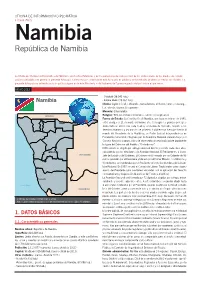
Namibia República De Namibia
OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA FICHA PAÍS Namibia República de Namibia La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comuni- cación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa. MAYO 2013 - Oshakati (36.541 hab.) Namibia - Katima Mulilo (28.362 hab.) Idioma: inglés (oficial), oshivambo, nama-damara, afrikaans, herero, rukavango, lozi, alemán, tswana, bosquimano Moneda: dólar namibio ANGOLA Religión: 90% de cristianos (luteranos, católicos y anglicanos) Forma de Estado: La Constitución de Namibia, aprobada en febrero de 1990, Rundu entró en vigor el 21 de marzo del mismo año. Consagra los grandes principios democráticos: elecciones cada 5 años, economía de mercado, respeto a los derechos humanos y separación de poderes. Establece un Ejecutivo fuerte al mando del Presidente de la República, un Poder Judicial independiente y un Parlamento bicameral, integrado por la Asamblea Nacional (cámara baja) y el Consejo Nacional (cámara alta y de representación regional). Existe igualmente la figura del Defensor del Pueblo u “Ombudsman”. El Presidente es elegido por sufragio universal directo y secreto cada cinco años, Windhoek coincidiendo con las elecciones a la Asamblea Nacional. El Presidente es, a la vez, BOTSUANA Jefe del Estado y del Gobierno. El Gobierno está formado por un Gabinete de Mi- nistros presidido por el Presidente y liderado por el Primer Ministro. -

Namibia Factbook
KAS Office Namibia www.kas.de/namibia Republic of Namibia KAS Factbook August 2010 © Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Independence 21 March 1990 (national holiday) Capital Windhoek [223.529 Inhab., referring to another source 1 400.000] Government Republic (bicameral system), member of the Commonwealth of Nations since 1990 Official Language English (until 1990 also Afrikaans and German) Administration 13 regions: Caprivi, Erongo, Hardap, Karas, Khomas, Kunene, Ohangwena, Okavango, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa Area 824,292 km 2 2 Population 2.108.665 Namibians 3 50% Ovambo, 9% Kavango, 7% Damara, 7% Herero, 6% White (incl. about 20.000 German descendants), 5% Nama, 4% Capri-vians, 3% San (bushmen), 2% Rehoboth Baster, 0,5% Tswana Black 87.5%, White 6%, Mixed 6.5% Population density 2.67 per km 2 Population growth rate 0.95 % (2009 estimate) 4 GNP (2007) 3305 US$ per capita 5 Currency 1 Namibian dollar (NAD) = 0,098 Euro 1 EUR = 10,184 N$ 6 Geographical Angola (north), Zambia (north-east), Zimbabwe (north-east), borders Botswana (east), South Africa (south), Atlantic Ocean (west) Languages English, 48% Oshiwambo, 11% Nama/Damara, 11% Afrikaans, 10% Kavango, 8% Otiherero, Khoekhoe, German Religion 80-90% Christians (among these 62% Protestants and 17% Catholics), 10-20% indigenous religions 1 <http://www.az.com.na/lokales/enormer-zuzug.76346.php>. 2 CIA, The World Factbook , <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>, (8.10.09). 3 CIA, The World Factbook . 4 CIA, The World Factbook . 5 Cf. Worldbank, <http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNI.pdf>. 6 Interbankexchange rate <http://www.bankenverband.de/waehrungsrechner/index-xi.asp?channel=> (21.07.2010). -

12 December 1994.Pdf
* TODAY: FIERCE FIGHTING IN ANGOL.:A * LATEST BONDS GRANTED * NSE UPDATE * Bringing Africa South Vol.3 No.4S7 Cops raid newspaper LUSAKA: Heavily-armed paramilitary police stormed the offices of Zambia's independent bi weekly newspaper, The Post, and seized four unused stories on Thursday. They also confiscated a letter criticising the ~\ inspector-general of police in the five-hour siege, which was witnessed by the German Ambassa dor to Zambia, Peter Schmidt. The police went through all documents and computer files in the hope offinding confidential state documents which might have been handed to the newspaper by disenchanted government continued on page 2 Romanian doctor e gets his President pledges e · job back THE Romanian doc tor locked in battle with the Ministry of Health and Social Services over the un lawful termination of peopl,e .will.dec · e his services, was re instated on Friday. Dr Vlad T raian • CHRIS NDIVANGA able lead with 70 per Vlasiu was preparing cent of votes counted so to make an applica PRESIDENT Sam Nujoma yesterday far compared to DT A tion in Namibia's vowed to call a referendum of all President Mishake Labour Court early Namibians before changing the inde Muyongo's 27 per cent. next month asking pendence constitution. B"y yesterday after that the Minister of noon the indications Health and Social Nujoma told NBC ra amend the constitution. were that only three par Services Minister, Dr dio news that Swapo's So far the official op ties - Swapo, DTA and Nicky Iyambo, be sent politburo would decide position, the DTA, has the UDF - would be rep to jail for failing to on whether the constitu polled 22,3 per cent. -
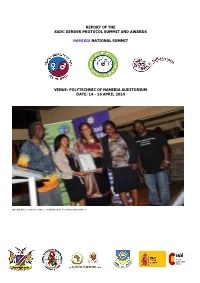
Namibia National Summit Report
REPORT OF THE SADC GENDER PROTOCOL SUMMIT AND AWARDS NAMIBIA NATIONAL SUMMIT VENUE: POLYTECHNIC OF NAMIBIA AUDITORIUM DATE: 14 - 16 APRIL 2014 Laurensia Bukes receives her winner`s certificate under the women rights category 1 Executive summary Quick facts 93 participants: 56 females and 37 males 52 entries: 28 females and 24 males in 8 categories 7 females and 2 males winners 5 civil society organization were represented 12 COE’s and council were represented and 1 none COE council 4 junior councillors from Arandis and Keetmanshoop attended 5 Media Students from PON This report covers the fifth session of the historic Namibia SADC Protocol@ Work Summit that brought together over 100 participants at the Polytechnic of Namibia Media Technology Department from 14 - 16 April 2014. The summit was held under the banner“50/50 by 2015 and a strong Post 2015 Agenda!”. It brought together journalists, local government authorities, municipalities, NGOs and representatives of ministries of gender and local government. A detailed participants list is attached at Annex A outlining the contact details of all the participants who attended the two day summit. The detailed programme of the two days’ activities is attached at Annex B. A SWOT analysis of the summit’s weaknesses, strengths, threats and opportunities is attached at Annex C. 50/50 campaign messages are attached at Annex D. A detailed media log of all the media coverage the summit received is attached at Annex E. The summit also resulted in two media releases and extensive media coverage the press releases are attached at Annex F. -
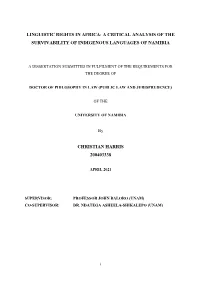
Linguistic Rights in Africa: a Critical Analysis of the Survivability of Indigenous Languages of Namibia
LINGUISTIC RIGHTS IN AFRICA: A CRITICAL ANALYSIS OF THE SURVIVABILITY OF INDIGENOUS LANGUAGES OF NAMIBIA A DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN LAW (PUBLIC LAW AND JURISPRUDENCE) OF THE UNIVERSITY OF NAMIBIA By CHRISTIAN HARRIS 200403338 APRIL 2021 SUPERVISOR: PROFESSOR JOHN BALORO (UNAM) CO-SUPERVISOR: DR. NDATEGA ASHEELA-SHIKALEPO (UNAM) i TABLE OF CONTENTS ABSTRACT ..................................................................................................................................................... XII ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................................................................................ XIII DEDICATION ................................................................................................................................................ XIV SUPERVISOR’S CERTIFICATE .......................................................................................................................... XV DECLARATION .............................................................................................................................................. XVI LIST OF ABBREVIATIONS/ACRONYMS ......................................................................................................... XVII CHAPTER 1: INTRODUCTION AND BACKGROUND OF THE STUDY ................................................................................... 1 1.1 Introduction............................................................................................................................................. -
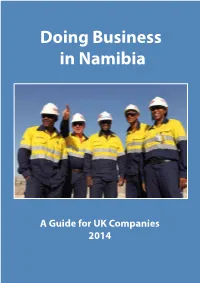
2014 Doing Business in Namibia Guide
Doing Business in Namibia Doing Business in Namibia - A Guide for UK Business Doing Business in Namibia - A Guide for A Guide for UK Companies 2014 Disclaimer: This publication has been produced by an independent economic consultant commissioned by the British High Commission in Windhoek. Whereas every effort has been made to ensure that the information provided is accurate, the Foreign and Commonwealth Office, including its British diplomatic missions resident overseas, accepts no liability for any errors, omissions or misleading statements contained in the publication, and no warranty is given or responsibility accepted as to the standing of any individual, firm, company, international organisation or institution mentioned Cover photo: Rio Tinto’s Rössing Uranium Mine Photos and Graphics: Simon Wilkie (all except where otherwise indicated) Layout: Haiko Bruns Printing: John Meinert Printing (Pty) Ltd Doing Business in Namibia A Guide for UK Companies 2014 Disclaimer This publication has been produced by an independent economic consultant commissioned by the British High Commission in Windhoek. Whereas every effort has been made to ensure that the information provided is accurate, the Foreign and Commonwealth Office, including its British diplomatic missions resident overseas, accepts no liability for any errors, omissions or misleading statements contained in the publication, and no warranty is given or responsibility accepted as to the standing of any individual, firm, company, international organisation or institution mentioned. Foreword by the British High Commissioner in Windhoek The UK Government remains committed to building Britain’s prosperity by increasing exports and investment, opening markets, ensuring access to resources, and promoting sustainable global growth. Trade and investment are absolutely fundamental to rebuilding and rebalancing our economy. -

Government Gazette Republic of Namibia
GOVERNMENT GAZETTE OF THE REPUBLIC OF NAMIBIA N$4.00 WINDHOEK - 30 March 2012 No. 4915 CONTENTS Page PROCLAMATION No. 8 Announcement of certain appointment: Namibian Constitution .......................................................... 2 GOVERNMENT NOTICES No. 89 Notification of cancellation of registration of certain medicines: Medicines and Related Substances Control Act, 2003 ................................................................................................................................. 2 No. 90 Notification of disposal of undesirable medicines: Medicines and Related Substances Control Act, 2003 ...................................................................................................................................................... 3 No. 91 Exemption under section 105 of the Road Traffic and Transport Act, 1999 ........................................ 3 No. 92 Determination of date of commencement: Judges’ Pensions Act, 2011 .............................................. 8 No. 93 Determination of transfer date for purposes of Judges’ Pensions Act: Judges’ Pensions Act, 2011 .... 8 GENERAL NOTICES No. 67 Notice of intention to approve Omaruru Town Planning Amendment Scheme No. 5 ......................... 8 No. 68 Permanent closure of Portion A (a portion of the remainder of Portion 1 of the Farm Okahao Town- lands No. 989) as a street ..................................................................................................................... 9 No. 69 Bank of Namibia: Statement of Assets and Liabilities -

Specialreport Regional Governance.Indd
OCTOBERNOVEMBER 2014 2015 Briefing Paper No. 12 By Nangula Shejavali ELECTRONIC VOTING MACHINES REGIONAL GOVERNORS: THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY DO THE BENEFITS OF APPOINTMENT BY THE PRESIDENT OUTWEIGH THE LOSS OF DEMOCRATIC REPRESENTATION? word processing and spreadsheets to more sophisticated INTRODUCTION data processing tools, such as data base management sys- tems, optical scanning and geographic information systems.”1 At the end of November 2014 Namibia is set to become the first African country to use electronic voting machines (EVMs) in a national election. The Electoral Commission of Namibia is no exception to this ongoing trend, and in its prepa- Namibia’s decision to use EVMs dates back to 2004. Since ration for the 2014 National Assembly and Presidential Elec- then several batches of EVMs have been bought from the tions, the Electoral Commission of Namibia (ECN) has in- Indian company Bharat Technologies. Since Namibia first troduced or made use of various technologies. For one, the decided to buy EVMs, concerns have been raised about the ECN in 2013 launched it use of a Biometric system to ensure need for the machines to have a Voter Verified Paper Audit easier registration of voters. In this regard, 904 machines – Trail (VVPAT). In October 2013, the Indian Supreme Court “which were manufactured in South Africa, have components ruled that a VVPAT was “an indispensable requirement of such as a laptop notebook, a fingerprint scanner, a camera, free and fair elections” as it “ensures the accuracy of the a signature pad and a barcode scanner to ensure that cor- voting system”. -

Parliamentpublication of Namibia Vol.8 No.1, 2010 January-April Parliament Journal Vol.8 No.1 2010 -April January 1
1 Parliament Journal Journal Publication of the Parliament of Namibia Vol.8 No.1, January-April 2010 Vol.8 No.1 January - April 2010 Parliament Vol.8 No.1 January - April 2010 No.1 Vol.8 ParliamentJournal 2 Chairman of the National Council, Hon. Asser Kapere (right) with the Ambassador/Head of Delegation of the European Union to Namibia, Dr. Elisabeth Pape. Dr. Pape paid a courtesy call on Chairman Kapere on 25 February 2010. Publication of the Parliament of Namibia 3 Vol.8 No.1, January-April 2010 From the Editor’s Desk ............................................. The opinions expressed in the Parliament 4 Journal do not necessarily represent the official view point or policy of the Parliament of Namibia. Chief Justice Swears-in Fifth National Assembly ......................................................................5 Editorial Board Economic Crisis Worsened Unemployment and Poverty, President Pohamba ............................7 Editor: Fanuel Katshenye CPPCC Chairman Visits Namibia Members: ..................10 Vincent Mwange Joseph Motinga David Nahogandja Budget Consolidates Fragile Recovery, Ambrosius Amutenja Kuugongelwa-Amadhila .....................................12 Layout: Gavin Damon - Red Sky creations Legislature Plays Role in Poverty Alleviation........................................................ Printing: 14 John Meinert Printing Parliament at Heart of Political Tolerance ..............................................................15 Parliament Journal is published three times annually – April, August and -

Republic of Namibia KAS Factbook March 2011 © Konrad-Adenauer-Stiftung E.V
KAS Office Namibia www.kas.de/namibia Republic of Namibia KAS Factbook March 2011 © Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Independence 21 March 1990 (national holiday) Capital Windhoek (about 243,000 inhabitants, referring to another source1 400,000) Government Republic (bicameral system) member of the Commonwealth of Nations since 1990 Official Language English (until 1990 also Afrikaans and German) Besides tribal languages like Oshivambo, Nama/Damara, Kavango, Otjiherero, Khoekhoe Administration 13 regions: Caprivi, Erongo, Hardap, Karas, Khomas, Kunene, Ohangwena, Okavango, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa President Hifikepunye Pohamba Area 824,292 km2 Geographical borders Angola (north), Zambia (north-east), Zimbabwe (north-east), Botswana (east), South Africa (south), Atlantic Ocean (west) Population 2,128,471 Namibians 50% Ovambo, 9% Kavango, 7% Damara, 7% Herero, 6% White (incl. about 20.000 German descendants), 6,5% mixed, 5% Nama, 4% Caprivians, 3% San (Bushmen), 2% Rehoboth Baster, 0,5% Tswana 37% living in rural areas2 Population density 2.67 per km2 Population growth rate 0.91 % (2010 est.) GDP 4.64 billion US$ (2010 est.) Unemployment rate 51.2% (2008)3 Currency 1 Namibian Dollar (NAD) = 1 ZAR; 1 EUR ≈ 9,81 N$4 Religion 80%-90% Christian (among them at least 50% Lutheran), 10%- 20% indigenous beliefs Cf: CIA, The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html (21.02.11) 1 http://www.az.com.na/lokales/noch-mehr-zuzug.121712.php (28.02.11) 2 The World Health Organisation 2008 http://www.who.int/gho/countries/nam.pdf (22.02.11) 3 Cf. Ministry of Labour and Social Welfare. -

SWAPO's 50/50 Policy in Namibia's National
Strategic Review for Southern Africa, Vol 41, No 2 Nov /Dec 2019 J S Amupanda & E H Thomas SWAPO’s 50/50 Policy in Namibia’s National Assembly (2015-2018): Full of Sound and Fury Signifying Nothing? Job Shipululo Amupanda & Erika Kahelende Thomas Department of Political and Administrative Studies University of Namibia, Namibia Abstract In 2013, Namibia’s ruling party, the South West Africa People’s Organisation (SWAPO), amended its constitution to implement the 50/50 gender policy. This policy required equal representation of men and women in all its leadership structures and in its representation in institutions such as the National Assembly. The party had been zigzagging on this policy it had adopted at its 2002 congress. Four years since the implementation of SWAPO’s 50/50, an analysis of the impact of this policy in the National Assembly paints a troubling picture. At the level of substance by looking at parliamentary motions tabled, we find that SWAPO’s 50/50 policy in the National Assembly – which resulted in increased number of women in the legislature - did not lead to meaningful agenda setting in favour of women political participation. This article reflects critically on the gender policy in the 6th parliament’s National Assembly, which is the principal law-making and policy-setting arm of parliament with a view to assess whether there have been successes in facilitating women empowerment and participation in a meaningful way. 1. Introduction There is hardly a discourse of women empowerment that does not make reference to patriarchy. This can be understood for women empowerment discourse is inherently responding to women disempowerment brought about by patriarchy.