Lise Meitner Zur 125
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Physics Teaching and Research at Göttingen University 2 GREETING from the PRESIDENT 3
Physics Teaching and Research at Göttingen University 2 GREETING FROM THE PRESIDENT 3 Greeting from the President Physics has always been of particular importance for the Current research focuses on solid state and materials phy- Georg-August-Universität Göttingen. As early as 1770, Georg sics, astrophysics and particle physics, biophysics and com- Christoph Lichtenberg became the first professor of Physics, plex systems, as well as multi-faceted theoretical physics. Mathematics and Astronomy. Since then, Göttingen has hos- Since 2003, the Physics institutes have been housed in a new ted numerous well-known scientists working and teaching physics building on the north campus in close proximity to in the fields of physics and astronomy. Some of them have chemistry, geosciences and biology as well as to the nearby greatly influenced the world view of physics. As an example, Max Planck Institute (MPI) for Biophysical Chemistry, the MPI I would like to mention the foundation of quantum mecha- for Dynamics and Self Organization and the MPI for Solar nics by Max Born and Werner Heisenberg in the 1920s. And System Research. The Faculty of Physics with its successful Georg Christoph Lichtenberg and in particular Robert Pohl research activities and intense interdisciplinary scientific have set the course in teaching as well. cooperations plays a central role within the Göttingen Cam- pus. With this booklet, the Faculty of Physics presents itself It is also worth mentioning that Göttingen physicists have as a highly productive and modern faculty embedded in an accepted social and political responsibility, for example Wil- attractive and powerful scientific environment and thus per- helm Weber, who was one of the Göttingen Seven who pro- fectly prepared for future scientific challenges. -

Göttinger Geschichten Für Das Erste Physikalische Institut Gesammelt Von Manfred Achilles 2012
Göttinger Geschichten für das Erste Physikalische Institut gesammelt von Manfred Achilles 2012 1 Manfred Achilles, TU Berlin Im Januar 2012 Eosanderstr. 17, 10587 Berlin achilles.manfred@t~online.de Episoden und Anekdoten aus der Göttinger Physik Die Geschichten und Anekdoten, die der Autor zu diesem Thema zusammengetragen hat, verdankt er zum großen Teil seinem verehrten Lehrer Prof. Dr. Walther Bünger (1905-1988), der in unzähligen Kaffeepausen seit 1965 bis wenige Tage vor seinem Tod mir und den anderen Angehörigen des "Institutes für Fachdidaktik und Lehrerbildung" der TU Berlin (vorher Pädagogische Hochschule) von den Ereignissen in der Göttinger Physik voller Freude berichtet hat. Als Pohlschüler fühlte er sich seinem alten Chef höchst verbunden. Es war für ihn und viele andere eine Selbstverständlichkeit, Pohl alljährlich zum Geburtstag zu gratulieren. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Pohlschule war so intensiv, dass es ein wenig auf den Autor übertragen wurde, obwohl dieser Pohl nie kennengelernt hat. Nur so ist es zu verstehen, dass diese Sammlung zu Stande gekommen ist, an deren Zusammenstellung ich seit zehn Jahren arbeite. Weitere Quellen sind die Herren E. Mollwo, W.Flechsig, F.Hund, L.Hagedorn (Arzt), Pohls Sohn, R.O.Pohl, u..a., die ich im Verlauf vieler Jahre interviewed hatte. Nach Möglichkeit nenne ich den Erzähler. Bei der Herstellung der hier vorliegenden Sammlung, und vor allem der Einfügung weiterer Geschichten, die zum Teil aus der Auflage vom November 2010 stammen, hat mir R.O.Pohl mit seinem Rechner geholfen. Mir ist natürlich bewusst, dass diese Sammlung keine Wissenschaft ist und keinesfalls einigermaßen erschöpfend sein kann. Manche der Anekdoten sind auch wie "Stille Post" durch mehrere Münder und Ohren gegangen, sind verändert worden oder aus der Erinnerung heraus nicht korrekt berichtet und aus dem Zusammenhang gerissen. -

Das Göttinger Nobelpreiswunder Ł 100 Jahre Nobelpreis
1 Göttinger Bibliotheksschriften 21 2 3 Das Göttinger Nobelpreiswunder 100 Jahre Nobelpreis Herausgegeben von Elmar Mittler in Zusammenarbeit mit Monique Zimon 2., durchgesehene und erweiterte Auflage Göttingen 2002 4 Umschlag: Die linke Bildleiste zeigt folgende Nobelpreisträger von oben nach unten: Max Born, James Franck, Maria Goeppert-Mayer, Manfred Eigen, Bert Sakmann, Otto Wallach, Adolf Windaus, Erwin Neher. Die abgebildete Nobelmedaille wurde 1928 an Adolf Windaus verliehen. (Foto: Ronald Schmidt) Gedruckt mit Unterstützung der © Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 2002 Umschlag: Ronald Schmidt, AFWK • Satz und Layout: Michael Kakuschke, SUB Digital Imaging: Martin Liebetruth, GDZ • Einband: Burghard Teuteberg, SUB ISBN 3-930457-24-5 ISSN 0943-951X 5 Inhalt Grußworte Thomas Oppermann ............................................................................................. 7 Horst Kern ............................................................................................................ 8 Herbert W. Roesky .............................................................................................. 10 Jürgen Danielowski ............................................................................................ 11 Elmar Mittler ...................................................................................................... 12 Fritz Paul Alfred Nobel und seine Stiftung ......................................................................... 15 Wolfgang Böker Alfred Bernhard Nobel ...................................................................................... -
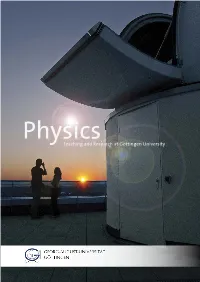
Physics Teaching and Research at Göttingen University 2 G R E E T I N G from the President 3
1 Physics Teaching and Research at Göttingen University 2 GREETIN G FROM THE PRESIDENT 3 Greeting from the President Physics has always been of particular importance for the Current research focuses on solid state and materials phy- Georg-August Universität Göttingen. As early as 1770, Georg sics, astrophysics and particle physics, biophysics and com- Christoph Lichtenberg became the first professor of Physics, plex systems, as well as multi-faceted theoretical physics. Mathematics and Astronomy. Since then, Göttingen has hos- Since 2003 the Physics institutes have been housed in a new ted numerous well-known scientists working and teaching physics building on the north campus with the natural sci- in the fields of physics and astronomy. Some of them have ence faculties, in close proximity to chemistry, geosciences greatly influenced the world view of physics. As an example, and biology as well as to the Max Planck Institute (MPI) for I would like to mention the foundation of quantum mecha- Biophysical Chemistry, the MPI for Dynamics and Self Orga- nics by Max Born and Werner Heisenberg in the 1920s. Göt- nization and soon the MPI for Solar Systems and Beyond. tingen physicists such as Georg Christoph Lichtenberg and This is also associated with intense interdisciplinary scien- in particular Robert Pohl have set the course in teaching as tific cooperation, exemplified by two collaborative research well. It is also worth mentioning that Göttingen physicists centers, the Bernstein Center for Computational Neurosci- have accepted social and political responsibility, for example ence (BCCN) and the Center for Molecular Physiology of the Wilhelm Weber, who was one of the Göttingen Seven who Brain (CMBP). -

Mitteilungen 2 Technical and Scientific Journal of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt 2012
MITTEILUNGEN 2 TECHNICAL AND SCIENTIFIC JOURNAL OF THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT 2012 PTR/PTB: 125 Years of Metrological Research MITTEILUNGEN JOURNAL OF THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT Special Journal for the Economy and Science Official Information Bulletin of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig and Berlin Advance copy from: 122nd volume, issue 2, June 2012 Contents PTR/PTB: 125 Years of Metrological Research Chronology 1887–2012 6–61 • Ernst O. Göbel: Preface 3 • Wolfgang Buck: The Intention 4 • Helmut Rechenberg: Helmholtz and the Founding Years 8 • Jörg Hollandt: The “Black Body” and the Quantization of the World 12 • Robert Wynands: The “Kuratorium”, PTB’s Advisory Board 16 • Wolfgang Buck: “New Physics” and a New Structure 20 • Dieter Hoffmann: The Einstein Case 22 • Wolfgang Buck: The Merging of the RMG and the PTR 26 • Dieter Hoffmann: The Physikalisch-Technische Reichsanstalt in the Third Reich 30 • Dieter Hoffmann: The PTR, PTA and DAMG: the Post-war Era 34 • Peter Ulbig, Roman Schwartz: Legal Metrology and the OIML 38 • Wolfgang Schmid: European Metrology 46 • Dieter Kind: The Reunification of Metrology in Germany 50 • Roman Schwartz, Harald Bosse: PTB – A Provider of Metrological Services and a Partner of Industry, Science and Society 56 • Ernst O. Göbel, Jens Simon: PTB at the Beginning of the 21st Century 62 Authors 66 Picture credits 67 Literature 68 Title picture: Together with Werner von Siemens and others, Hermann von Helmholtz campaigned personally for the foundation of the PTR and became its first presi- dent from 1888 to 1894. Imprint The PTB-Mitteilungen are the metrological specialist journal and official infor- mation bulletin of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig and Berlin. -
![Physiker]Innen [Physiker]Innen Eine Auswahl Eine Auswahl](https://docslib.b-cdn.net/cover/8472/physiker-innen-physiker-innen-eine-auswahl-eine-auswahl-9268472.webp)
Physiker]Innen [Physiker]Innen Eine Auswahl Eine Auswahl
Daniela Angetter – Michael Martischnig Daniela Angetter – Michael Martischnig Biografien österreichischer Biografien österreichischer [Physiker]innen [Physiker]innen Eine Auswahl Eine Auswahl HERAUSGEGEBEN VOM ÖSTERREICHISCHEN HERAUSGEGEBEN VOM ÖSTERREICHISCHEN STAATSARCHIV STAATSARCHIV Zur Information: Zur Information: Biografisches Handbuch österreichischer Physiker und Biografisches Handbuch österreichischer Physiker und Physikerinnen anlässlich einer Ausstellung des Österreichischen Physikerinnen anlässlich einer Ausstellung des Österreichischen Staatsarchivs. Staatsarchivs. Herausgeber: Österreichisches Staatsarchiv, A-1030 Wien, Herausgeber: Österreichisches Staatsarchiv, A-1030 Wien, Nottendorfergasse 2 Nottendorfergasse 2 Idee: Gertrude Enderle-Burcel Idee: Gertrude Enderle-Burcel Redaktion und Layout: Michaela Follner Redaktion und Layout: Michaela Follner Inhalt: Für die Inhalte der einzelnen Biografien zeichnen die Inhalt: Für die Inhalte der einzelnen Biografien zeichnen die Autoren selbst verantwortlich. Autoren selbst verantwortlich. © Österreichisches Staatsarchiv, Generaldirektion © Österreichisches Staatsarchiv, Generaldirektion Alle Rechte vorbehalten Alle Rechte vorbehalten Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers ist es nicht gestattet, das Werk oder Genehmigung des Herausgebers ist es nicht gestattet, das Werk oder auch nur Teile davon, unter Verwendung mechanischer, elektronischer auch nur Teile davon, unter -

Hermann Haken: from the Laser to Synergetics a SCIENTIFIC BIOGRAPHY of the EARLY YEARS 123 Hermann Haken: from the Laser to Synergetics Bernd Kröger
Bernd Kröger Hermann Haken: From the Laser to Synergetics A SCIENTIFIC BIOGRAPHY OF THE EARLY YEARS 123 Hermann Haken: From the Laser to Synergetics Bernd Kröger Hermann Haken: From the Laser to Synergetics A Scientific Biography of the Early Years ABC Bernd Kröger Tübingen Germany ISBN 978-3-319-11688-4 ISBN 978-3-319-11689-1 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-11689-1 Library of Congress Control Number: 2014949170 Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London c Springer International Publishing Switzerland 2015 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. Printed on acid-free paper Springer International Publishing AG Switzerland is part of Springer Science+Business Media (www.springer.com) Contents Tables and Figures ....................................................................................... -

Biographische Notizen Von Robert Wichard Pohl
GOEDOC - Dokumenten- und Publikationsserver der Georg-August-Universität Göttingen 2013 Biographische Notizen von Robert Wichard Pohl Erinnerungen an die Anfänge der Festkörperphysik in Göttingen und Lebenslauf und politische Haltung von R. W. Pohl zusammengestellt und bearbeitet von Robert Otto Pohl Biographische Notizen von Robert Wichard Pohl : Erinnerungen an die Anfänge der Festkörperphysik in Göttingen und Lebenslauf und politische Haltung von R. W. Pohl / zusammengestellt und und bearbeitet von Robert Otto Pohl Göttingen : GOEDOC, Dokumenten- und Publikationsserver der Georg-August-Universität, 2013 Verfügbar: PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl/?webdoc-3896 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Es steht unter Creative Commons Lizenz 3.0 „by-nc-nd“ als freie Onlineversion über den GOEDOC – Dokumentenserver der Georg-August-Universität Göttingen bereit und darf gelesen, heruntergeladen sowie als Privatkopie ausgedruckt werden. Es ist nicht gestattet, Kopien oder gedruckte Fassungen der freien Onlineversion zu veräußern. Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar. Kurzfassung: Der Stuttgarter Physikprofessor Heinz Pick (1912 – 1983) besucht im Juni 1974 seinen Doktorvater Robert Wichard Pohl (1884 – 1976). In einem Interview sprechen die beiden über die Anfänge von Pohls Arbeit in Göttingen. Von der Photoleitung in Isolatoren kommen sie auf die F-Zentren als Donatoren und auf die Bedeutung sorgfältiger Kristallherstellung. Bei den Untersuchungen an F-Donatoren spielt die optische Spektroskopie für R. W. Pohl eine ganz wesentliche Rolle. Mit Kollegen wie dem Chemiker Adolf Windaus arbeitet Pohl zusammen, die Entdeckung Karl Baedekers, der als Erster Elektronenleitung in Isolatoren beschrieben hat, beeinflusst seine Arbeit. -
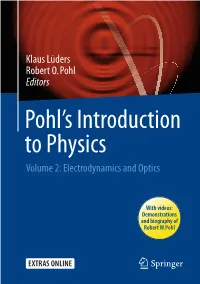
Pohl's Introduction to Physics
Klaus Lüders Robert O. Pohl Editors Pohl’s Introduction to Physics Volume 2: Electrodynamics and Optics With videos: Demonstrations and biography of Robert W.Pohl Pohl’s Introduction to Physics Klaus Lüders Robert Otto Pohl Editors Pohl’s Introduction to Physics Volume 2: Electrodynamics and Optics Editors Klaus Lüders Robert Otto Pohl Fachbereich Physik Department of Physics Freie Universität Berlin Cornell University Berlin, Germany Ithaca, NY, USA Translated by Prof. William D. Brewer, PhD, Fachbereich Physik, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany Additional material to this book can be downloaded from http://extras.springer.com. ISBN 978-3-319-50267-0 ISBN 978-3-319-50269-4 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-319-50269-4 Library of Congress Control Number: 2017944730 © Springer International Publishing AG 2018 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, repro- duction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. -

Physicists at the University of Go¨Ttingen, 1945–1955
Phys. perspect. 3 (2001) 189–209 © Birkha¨user Verlag, Basel, 2001 1422–6944/01/020189–21 $ 1.50+0.20/0 Physicists at the University of Go¨ttingen, 1945–1955 Klaus Hentschel and Gerhard Rammer* With a focus on the issue of continuity 6ersus change, we present an overview for the immediate postwar years of many aspects of academic physics in one local context. Based on new archival findings, we discuss academic staffing, research topics, course offerings, student statistics, and two complementary biographical case studies of physicists at this former international center for experimental and theoretical physics. Key words: University of Go¨ttingen; physics education; denazification; Germany under Allied control; Kurt Hohenemser; Max Schuler. Introduction The momentous events of the recent past also compel the University of Go¨ttin- gen to make a fundamental change in course from that of the past twelve years.1 Thus opens the draft of an official statement by the University Council (Senat)at Go¨ttingen dated April 27, 1945. It was authored by the physical chemist Arnold Eucken, then Dean of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Six weeks later, when the new Rector of the Georgia Augusta University of Go¨ttingen, Rudolf Smend, proposed ‘‘a statement on the ethical and political problems of the times, especially in view of the concentration-camp atrocities and the related propaganda,’’ the temperature rose again in the University boardroom. The Senat minutes of June 6, 1945, record: ‘‘Eucken warns against drifting off into the war-guilt issue. Weber underscores the necessity of a basic rethinking. The discus- sion is broken off.’’2 Such proceedings raise questions about the mentality, interests, and actions of those who guided science policy after the collapse of the Third Reich, both in general in the Federal Republic of Germany, and in the mundane local affairs of a university department.