Fanny & Felix Mendelssohn
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rising Stars of Orion an Evening of Chamber Music Introduced by Artistic Director Toby Purser
Tuesday 24 March 2015 at 7 pm Concert Rising Stars of Orion An evening of chamber music introduced by Artistic Director Toby Purser Tuesday 24 March 2015 at 7 pm at the Embassy of Switzerland, 16–18 Montagu Place, London W1H 2BQ The Orion Orchestra Patron HRH Princess Michael of Kent President Lady Solti Conductor Toby Purser will introduce members of the Orion Orchestra. The audience will be able to enjoy music from Schubert, Mozart, Mendelssohn, Brahms as well as Ernest Bloch, Swiss composer. We are very pleased to welcome back amongst the talented musicians of the Orion Orchestra, Samuel Justitz, Swiss pianist and cellist. The concert will be followed by a reception I/we would like to attend the event on Tuesday 24 March 2015 at 7 pm at the Embassy of Switzerland, 16–18 Montagu Place, LondonW1H 2BQ. Entry price: £12.00 for NSH members. £20.00 per person for non-members. Name(s): Address: Email: Tel.No.: As booking is essential, please return this slip with your cheque made payable to New Helvetic Society to Daniel Pedroletti, 16 Thorne Way, Buckland, Aylesbury HP22 5TL. Queries to: [email protected] Registration deadline: 19 March 2015. Please note that no tickets or confirmations of booking are issued. New Helvetic Society, c/o Embassy of Switzerland, 16–18 Montagu Place, London W1H 2BQ Website: www.newhelveticsociety.org.uk | Email: [email protected] Tuesday 24 March 2015 at 7 pm The Orion Orchestra Patron HRH Princess Michael of Kent President Lady Solti The Orion Orchestra has built a reputation as one of the most Little, Susan Gritton, Anne Murray, Nicola Benedetti, Valeriy dynamic orchestras on the UK’s music scene. -

Sally Matthews Is Magnificent
` DVORAK Rusalka, Glyndebourne Festival, Robin Ticciati. DVD Opus Arte Sally Matthews is magnificent. During the Act II court ball her moral and social confusion is palpable. And her sorrowful return to the lake in the last act to be reviled by her water sprite sisters would melt the winter ice. Christopher Cook, BBC Music Magazine, November 2020 Sally Matthews’ Rusalka is sung with a smoky soprano that has surprising heft given its delicacy, and the Prince is Evan LeRoy Johnson, who combines an ardent tenor with good looks. They have great chemistry between them and the whole cast is excellent. Opera Now, November-December 2020 SCHUMANN Paradies und die Peri, Cincinnati Symphony Orchestra, Paolo Bortolameolli Matthews is noted for her interpretation of the demanding role of the Peri and also appears on one of its few recordings, with Rattle conducting. The soprano was richly communicative in the taxing vocal lines, which called for frequent leaps and a culminating high C … Her most rewarding moments occurred in Part III, particularly in “Verstossen, verschlossen” (“Expelled again”), as she fervently Sally Matthews vowed to go to the depths of the earth, an operatic tour-de-force. Janelle Gelfand, Cincinnati Business Courier, December 2019 Soprano BARBER Two Scenes from Anthony & Cleopatra, Chicago Symphony Orchestra, Juanjo Mena This critic had heard a fine performance of this music by Matthews and Mena at the BBC Proms in London in 2018, but their performance here on Thursday was even finer. Looking suitably regal in a glittery gold form-fitting gown, the British soprano put her full, vibrant, richly contoured voice fully at the service of text and music. -

Swr2 Programm Kw 41
SWR2 PROGRAMM - Seite 1 - KW 41 / 09. - 15.10.2017 Domenico Gallo: 9.00 Nachrichten, Wetter Montag, 09. Oktober Sonate Nr. 4 G-Dur Parnassi musici 9.05 SWR2 Musikstunde 0.05 ARD-Nachtkonzert Wolfgang Amadeus Mozart: Gefangen, verschleppt, verkauft – Franz Seraph von Destouches: Sinfonie B-Dur KV 182 Wege der Sklaverei (1) Sinfonia D-Dur Philharmonia Orchestra London Musikalische Zeugnisse der Unfreiheit Staatskapelle Weimar Leitung: Riccardo Muti Mit Jan Ritterstaedt Leitung: Peter Gülke Antonín Dvorák: Richard Wagner: Polonaise A-Dur Wahrscheinlich gibt es die Sklaverei ”Das Liebesmahl der Apostel” WWV 69 Heinrich Schiff (Violoncello) schon so lange wie die Menschheit. Sächsischer Staatsopernchor Dresden Elisabeth Leonskaja (Klavier) Erste Belege für diese Praxis tauchen Sächsische Staatskapelle Dresden Camille Saint-Saëns: schon gut 2000 Jahre v. Chr. auf, Leitung: Christian Thielemann Morceau de Concert G-Dur op. 154 ausführlich dokumentiert ist sie dann Georg Friedrich Händel: Nicanor Zabaleta (Harfe) aber vor allem im antiken Griechenland Suite g-Moll HWV 432 Orchestre de l’ORTF und im Römischen Reich. Von da an Ragna Schirmer (Klavier) Leitung: Jean Martinon zieht sich der Handel mit Menschen Carl Nielsen: Vincent d’Indy: und deren Arbeitskraft wie ein roter Flötenkonzert D-Dur op. 119 Sérénade et Valse op. 28 Faden durch die Jahrhunderte. Die Aurèle Nicolet (Flöte) Isländisches Sinfonieorchester SWR2 Musikstunde nimmt sich in Gewandhausorchester Leipzig Leitung: Rumon Gamba dieser Woche diesem dunklen Kapitel Leitung: Kurt Masur der Menschheitsgeschichte an und Camille Saint-Saëns: 6.00 SWR2 am Morgen folgt dabei den Hauptrouten des ”Saltarelle” op. 74 darin bis 8.00 Uhr: Sklavenhandels. Es wird Musik aus ensemble amarcord u. -

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Georg Friedrich Händel (1685-1759) Sämtliche Werke / Complete works in MP3-Format Details Georg Friedrich Händel (George Frederic Handel) (1685-1759) - Complete works / Sämtliche Werke - Total time / Gesamtspielzeit 249:50:54 ( 10 d 10 h ) Titel/Title Zeit/Time 1. Opera HWV 1 - 45, A11, A13, A14 116:30:55 HWV 01 Almira 3:44:50 1994: Fiori musicali - Andrew Lawrence-King, Organ/Harpsichord/Harp - Beate Röllecke Ann Monoyios (Soprano) - Almira, Patricia Rozario (Soprano) - Edilia, Linda Gerrard (Soprano) - Bellante, David Thomas (Bass) - Consalvo, Jamie MacDougall (Tenor) - Fernando, Olaf Haye (Bass) - Raymondo, Christian Elsner (Tenor) - Tabarco HWV 06 Agrippina 3:24:33 2010: Akademie f. Alte Musik Berlin - René Jacobs Alexandrina Pendatchanska (Soprano) - Agrippina, Jennifer Rivera (Mezzo-Soprano) - Nerone, Sunhae Im (Soprano) - Poppea, Bejun Mehta (Counter-Tenor) - Ottone, Marcos Fink (Bass-Bariton) - Claudio, Neal Davis (Bass-Bariton) - Pallante, Dominique Visse (Counter-Tenor) - Narciso, Daniel Schmutzhard (Bass) - Lesbo HWV 07 Rinaldo 2:54:46 1999: The Academy of Ancient Music - Christopher Hogwood Bernarda Fink (Mezzo-Sopran) - Goffredo, Cecilia Bartoli (Mezzo-Sopran) - Almirena, David Daniels (Counter-Tenor) - Rinaldo, Daniel Taylor (Counter-Tenor) - Eustazio, Gerald Finley (Bariton) - Argante, Luba Orgonasova (Soprano) - Armida, Bejun Mehta (Counter-Tenor) - Mago cristiano, Ana-Maria Rincón (Soprano) - Donna, Sirena II, Catherine Bott (Soprano) - Sirena I, Mark Padmore (Tenor) - Un Araldo HWV 08c Il Pastor fido 2:27:42 1994: Capella -

CHAN 9653 FRONT.Qxd 24/10/07 12:20 Pm Page 1
CHAN 9653 FRONT.qxd 24/10/07 12:20 pm Page 1 Chan 9653 CHANDOS THE GRAINGER EDITION VOLUME NINE Works for Chorus and Orchestra 3 SUSAN GRITTON soprano PAMELA HELEN STEPHEN mezzo MARK TUCKER tenor STEPHEN VARCOE baritone TIM HUGH cello JOYFUL COMPANY OF SINGERS CITY OF LONDON SINFONIA RICHARD HICKOX GGRAINGER CHAN 9653 BOOK.qxd 24/10/07 12:24 pm Page 2 Percy Grainger (1882–1961) 1 Mock Morris [RMTB No. 1] 3:21 premiere recording in this version Trad. 2 The Power of Love [DFMS No. 4]*|| 4:23 (edited by Barry Peter Ould) premiere recording in this version 3 Died For Love [BFMS No. 10] 1:29 (edited by Dana Paul Perna) The Percy Grainger Society Grainger The Percy Trad. 4 Love Verses from The Song of Solomon†‡|| 6:45 5 Shepherd’s Hey! [BFMS No. 3] 2:07 premiere recording in this version 6 Early One Morning [BFMS Unnum.] 2:02 (edited by Barry Peter Ould) Percy Grainger Trad. 7 The Three Ravens [BFMS No. 41]§|| 4:04 premiere recording 8 Scherzo [YTW Unnum.] 1:40 (edited by Barry Peter Ould) 3 CHAN 9653 BOOK.qxd 24/10/07 12:24 pm Page 4 9 Youthful Rapture [RMTB Unnum.]¶ 5:11 Trad. 16 Dollar and a Half a Day [SCS No. 2]‡§|| 3:21 premiere recording 17 10 Random Round (Set version) [RMTB No. 8]*†‡ 6:01 Molly on the Shore [BFMS No. 1] 4:08 (edited by Barry Peter Ould) TT 62:34 premiere recording in this version Susan Gritton soprano* 11 The Merry King [BFMS No. -

NEWSLETTER of the American Handel Society
NEWSLETTER of The American Handel Society Volume XXVII, Number 2 Summer 2012 FROM THE PRESIDENT’S DESK SUMMER 2012 I would like to thank all the members of the Society who have paid their membership dues for 2012, and especially those who paid to be members of the Georg-Friedrich-Händel Gesellschaft and/or friends of The Handel Institute before the beginning of June, as requested by the Secretary/Treasurer. For those of you who have not yet renewed your memberships, may I urge you to do so. Each year the end of spring brings with it the Handel Festivals in Halle and Göttingen, the latter now regularly scheduled around the moveable date of Pentecost, which is a three-day holiday in Germany. Elsewhere in this issue of the Newsletter you will find my necessarily selective Report from Halle. While there I heard excellent reports on the staging of Amadigi at Göttingen. Perhaps other members of the AHS would be willing to provide reports on the performances at Göttingen, and also those at Halle that I was unable to attend. If so, I am sure that the Newsletter Angelica Kauffmann, British, born in Switzerland, 1741-1807 Portrait of Sarah Editor would be happy to receive them. Harrop (Mrs. Bates) as a Muse ca. 1780-81 Oil on canvas 142 x 121 cm. (55 7/8 x 47 5/8 in.) Princeton University Art Museum. Museum purchase, Surdna Fund The opening of the festival in Halle coincided and Fowler McCormick, Class of 1921, Fund 2010-11 photo: Bruce M. White with the news of the death of the soprano Judith Nelson, who was a personal friend to many of us. -

GRITTON Sings Britten Finzi Delius
SUSAN GRITTON sings Britten Finzi Delius BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Benjamin Britten, right, with Peter Pears at Long Island, New York, 1939 © The Lotte Jacobi Collection, University of New Hampshire/ AKG Images, London Gerald Finzi (1901–1956) Dies natalis, Op. 8 26:00 Cantata for high voice and string orchestra 1 I Intrada. Andante con moto – 5:11 2 II Rhapsody (Recitativo stromentato). Andante con moto 7:19 3 III The Rapture (Danza). Allegro vivace e giojoso 4:00 4 IV Wonder (Arioso). Andante 4:55 5 V The Salutation (Aria). Tempo comodo 4:23 Benjamin Britten (1913–1976) Les Illuminations, Op. 18 22:59 for soprano or tenor and string orchestra For Sophie Wyss 6 I Fanfare. Maestoso (poco presto) – 2:00 7 II Villes. Allegro energico 2:32 8 IIIa Phrase. Lento ed estatico – 1:01 9 IIIb Antique. To K.H.W.S. Allegretto, un poco mosso 1:59 10 IV Royauté. Allegro maestoso 1:41 11 V Marine. Allegro con brio 1:06 12 VI Interlude. To E.M. Moderato ma comodo – 2:54 13 VII Being Beauteous. To P.N.L.P. Lento ma comodo 4:18 14 VIII Parade. Alla marcia 2:56 15 IX Départ. Largo mesto 2:31 3 Quatre Chansons françaises 13:24 for high voice and orchestra Edited by Colin Matthews 16 1 Nuits de juin. Lento e molto rubato 3:02 17 2 Sagesse. Lento ma non troppo 3:14 18 3 L’Enfance. Animato – Lento 4:42 19 4 Chanson d’automne. Moderato con molto moto ma sempre colla voce 2:15 Frederick Delius (1862–1934) 20 A Late Lark 5:20 Edited by Sir Thomas Beecham and Eric Fenby Prepared for publication by Robert Threlfall Slow TT 68:15 Susan Gritton soprano BBC Symphony Orchestra Stephen Bryant leader Edward Gardner Susan Gritton would like to dedicate her recording of Dies natalis on this disc to the loving memory of Richard Hickox. -

Handel: Messiah
LSO Live Handel Messiah Sir Colin Davis Susan Gritton Sara Mingardo Mark Padmore Alastair Miles Tenebrae Choir London Symphony Orchestra George Frideric Handel (1685–1759) Page Index Messiah (1741–42) 3 Track listing 6 English notes 8 French notes 10 German notes Susan Gritton soprano 12 Composer biography Sara Mingardo alto 13 Text Mark Padmore tenor 16 Conductor biography Alastair Miles bass 17 Artist biographies 19 Orchestra and Chorus personnel lists Sir Colin Davis conductor London Symphony Orchestra 20 LSO biography Tenebrae Choir Nigel Short choir director James Mallinson producer Daniele Quilleri casting consultant Classic Sound Ltd recording, editing and mastering facilities Jonathan Stokes and Neil Hutchinson for Classic Sound Ltd balance engineers Ian Watson and Jenni Whiteside for Classic Sound Ltd editors A high density DSD (Direct Stream Digital) recording Recorded live at the Barbican, London 10 and 12 December 2006 © 2007 London Symphony Orchestra, London UK P 2007 London Symphony Orchestra, London UK 2 Track listing Track Part I 1 No 1 Sinfonia (Overture) 3’44’’ p16 2 No 2 Comfort ye My people (tenor) 2’59’’ p16 3 No 3 Ev’ry valley shall be exalted (tenor) 3’34’’ p16 4 No 4 And the glory of the Lord (chorus) 2’45’’ p16 5 No 5 Thus saith the Lord (bass) 1’30’’ p16 6 No 6 But who may abide the day of His coming? (alto) 4’17’’ p16 7 No 7 And He shall purify (chorus) 2’21’’ p16 8 No 8 Behold, a virgin shall conceive (alto) 0’24’’ p16 9 No 9 O thou that tellest good tidings to Zion (alto) 3’56’’ p16 10 O thou that tellest good -

Italian Conductor Gianluca Marcianò Returns To
Italian conductor Gianluca Marcianò returns to Grange Park Opera this summer to conduct a new production of Saint- Saëns’ Samson et Dalila and Stephen Medcalf’s production of Tchaikovsky’s Onegin Saint-Saëns Samson et Dalila Grange Park Opera June 20, 24 & 28 | July 4, 9, & 16 Director Patrick Mason Conductor Gianluca Marcianò Tchaikovsky Eugene Onegin Grange Park Opera July 10, 12, 15 & 18 Director Stephen Medcalf Conductor Gianluca Marcianò Full listings below “Behind the boyish charm, he is clearly a little wild at heart. His career has been entirely and delightfully unconventional to date, and his music-making is infused with a wide-eyed sense of discovery.” Opera Now Italian conductor Gianluca Marcianò returns to Grange Park Opera this summer for his fifth consecutive year to conduct Saint-Saëns’ Samson et Dalila in a new production by Irish director Patrick Mason, opening on 20 June. Marcianò will also be conducting the revival of Stephen Medcalf’s production of Tchaikovsky’s Onegin, opening on 10 July. Following the first run in 2013, Stephen Medcalf’s “intelligently traditional” (Robert Hugill) production of Onegin returns with Canadian baritone Brett Polegato and soprano Susan Gritton as the same lead roles. To watch a trailer from the 2013 production click he Marcianò also has strong ties with the opera houses in Zagreb, Minsk, Sassari and Prague. Director of Samson et Dalila Patrick Mason explains: “Writing at a time of rising anti-Semitism in Europe and the corresponding emergence of the Zionist movement, Saint-Saëns turned to the biblical story of the catastrophic passion of the Hebrew warrior Samson, and the Philistine princess Dalila to create his most famous opera. -
Pdf-Dokument
MUSIK - CDs CD.Sbo 2 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Arcadian duets / Georg Friedrich Händel. Natalie Dessay ; Gens, Veronique …[s.l.] : Erato Disques, 2018. – 2 CDs Interpr.: Dessay, Natalie ; Veronique Gens CD. Sbo 2 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Cembalosuiten (1720) Nr. 1 – 8 / Georg Friedrich Händel. Laurence Cummings.- [s.l.] : Somm, 2017. – 2 CDs Interpr.: Cummings, Laurence ; London Handel Orchestre CD. Sbo 2 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Cembalowerke /Georg Friedrich Händel. Philippe Grisvard ; William Babell ; Friedrich Wilhelm Zachow … [s.l.] : audax, 2017.- Interpr.: Grisvard, Philippe ; Babell, William ; Zachow, Friedrich Wilhelm CD. Sbs 2 / Haen Händel Händel, Georg Friedrich: Arien / Georg Friedrich Händel. Bernadette Greevy ; Joan Sutherland … [s.l.] : Decca, 2017.- 2 CDs Interpr.: Greevy, Bernadette ; Sutherland, Joan CD. Sbs 2 / Haen Händel Händel, Georg Friedrich: Silla / Georg Friedrich Händel. James Bowman ; Simon Baker… [s.l.] : Somm, 2017.- 2 CDs Interpr.: Bowman, James ; Baker, Simon CD. Sbs 2 /Haen Händel Händel, Georg Friedrich: Instrumentalmusiken aus Opern & Oratorien / Georg Friedrich Händel. London Handel Players [s.l.] : Somm, 2017.- 1 CD Interpr.: London Handel Players 1 CD.Sbq 3 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Aci, Galatea e Polifemo : Serenata. Napoli, 1708 / Handel. Roberta Invernizzi ... La Risonanza. Fabio Bonizzoni. - San Lorenzo de El Escorial : note 1 music, 2013. - 2 CDs + Beih. Interpr.: Bonizzoni, Fabio [Dir.] ; Invernizzi, Roberta ; La Risonanza CD.Sbs 2 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Alessandro : live recorded at Badisches Staatstheater Karlsruhe / G. F. Handel. Lawrence Zazzo ... Deutsche Händel-Solisten on period instruments. Michael Form. - [S.l.] : note 1 music, 2012. - 3 CDs + Beih. Interpr.: Form, Michael; Zazzo, Lawrence; Deutsche Händel-Solisten CD.Sbs 2 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Alessandro / Handel. -
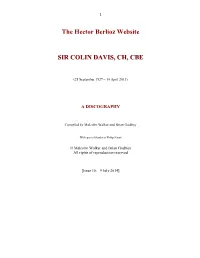
Sir Colin Davis Discography
1 The Hector Berlioz Website SIR COLIN DAVIS, CH, CBE (25 September 1927 – 14 April 2013) A DISCOGRAPHY Compiled by Malcolm Walker and Brian Godfrey With special thanks to Philip Stuart © Malcolm Walker and Brian Godfrey All rights of reproduction reserved [Issue 10, 9 July 2014] 2 DDDISCOGRAPHY FORMAT Year, month and day / Recording location / Recording company (label) Soloist(s), chorus and orchestra RP: = recording producer; BE: = balance engineer Composer / Work LP: vinyl long-playing 33 rpm disc 45: vinyl 7-inch 45 rpm disc [T] = pre-recorded 7½ ips tape MC = pre-recorded stereo music cassette CD= compact disc SACD = Super Audio Compact Disc VHS = Video Cassette LD = Laser Disc DVD = Digital Versatile Disc IIINTRODUCTION This discography began as a draft for the Classical Division, Philips Records in 1980. At that time the late James Burnett was especially helpful in providing dates for the L’Oiseau-Lyre recordings that he produced. More information was obtained from additional paperwork in association with Richard Alston for his book published to celebrate the conductor’s 70 th birthday in 1997. John Hunt’s most valuable discography devoted to the Staatskapelle Dresden was again helpful. Further updating has been undertaken in addition to the generous assistance of Philip Stuart via his LSO discography which he compiled for the Orchestra’s centenary in 2004 and has kept updated. Inevitably there are a number of missing credits for producers and engineers in the earliest years as these facts no longer survive. Additionally some exact dates have not been tracked down. Contents CHRONOLOGICAL LIST OF RECORDING ACTIVITY Page 3 INDEX OF COMPOSERS / WORKS Page 125 INDEX OF SOLOISTS Page 137 Notes 1. -

Der Händel-Festspiele
AUSGABE 2013 AUSGABE MAGAZIN DER HÄNDEL-FESTSPIELE Photo: Beetroot MACHT UND MUSIK | DAS THEMA DER FESTSPIELE FESTSPIEL-NEWS | DIE HÄNDEL-OPER ALESSANDRO AUF EINEN BLICK | KALENDARIUM MIT ALLEN FESTSPIELTERMINEN UND KÜNSTLERVERZEICHNIS DIE STIFTUNG HÄNDEL-HAUS DANKT IHREN FÖRDERERN UND SPONSOREN IHREN PARTNERN STADTMARKETING IHREN MEDIEN- UND KULTURPARTNERN Inhalt Händel, Komponist Händel als Staatskomponist? Die Händel-Preisträgerin 2013 Akustisches Klonen im Umfeld der Macht Die Jahresausstellung 2013 Seite 18 Seite 36 Seite 10 im Händel-Haus Seite 14 FESTSPIELTHEMA: MACHT UND MUSIK 1010 Händel, Komponist im Umfeld der Macht Das neue Erscheinungsbild der Händel-Festspiele 2014 Prof. Dr. Wolfgang Hirschmann Seite 34 1414 Händel als Staatskomponist? Zur Jahresausstellung 2013 im Händel-Haus HÄNDEL-NEWS Dr. Lars Klingberg 36 Akustisches Klonen Neue Wege zum Schutze des Originals FESTSPIEL-NEWS Christiane Barth 1818 Magdalena Kožená 40 Neu: Studien der Stiftung Händel-Haus Die Händel-Preisträgerin 2013 Dr. Konstanze Musketa Patricia Reese 42 Musikalische Schatzkammer 2020 Die Händel-Oper Alessandro Die Sammlung früher Händel-Notendrucke Krieg der Töne der Stiftung Händel-Haus Patricia Reese Jens Wehmann 2222 Vorgestellt! Schloss und Patronatskirche Ostrau KOMPENDIUM Eine neue Spielstätte im Festspielprogramm Dr. Erik Dremel 4466 Festspielkalender Alle Veranstaltungen auf einen Blick 26 […nach Luther…] 26 56 Künstlerverzeichnis Dr. Erik Dremel 56 der Händel-Festspiele 2013 2828 Festspielsplitter 58 Veranstaltungsorte 34 Händel verzaubert 58 Rund um die Händel-Festspiele 34 Das neue Erscheinungsbild 59 60 Museumsshop im Händel-Haus der Händel-Festspiele 2014 60 Anja Telzer 62 Impressum Händel-Festspiele Magazin 2013 3 www.saalesparkasse.de Gut für die Musikfreunde des Barock und das Kulturleben in der Region.