Journal for Hymenoptera Aculeata Research
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bienen (Hymenoptera: Aculeata: Apiformes) Bestandsentwicklung 2
Bienen (Hymenoptera: Aculeata: Apiformes) Bestandsentwicklung 2. Fassung, Stand: Mai 2014 Christoph Saure & Eckart Stolle (unter Mitarbeit von Frank Burger, Frank Creutzburg, Tobias Meitzel & Christian Schmid-Egger) Bedeutung der Bienen Arten sind überregional in ihrem Bestand gefährdet oder bereits ausgestorben, z. B. sind in Deutschland 53 % Bienen sind eine außerordentlich formenreiche Grup- aller Bienenarten in der Roten Liste enthalten (West- pe, deren Artenzahl weltweit auf etwa 30.000 geschätzt rich et al. 2011). wird (Michener 2007). Im Gegensatz zu den verwand- ten Wespengruppen benötigen Bienen nicht nur für die Bienen reagieren auf Umweltveränderungen beson- eigene Ernährung, sondern auch für die Ernährung ih- ders empfindlich. Viele Arten sammeln Blütenpollen rer Larven große Mengen an Pollen und Nektar. Blüten ausschließlich auf einer Pflanzengattung oder -familie müssen daher sehr häufig besucht werden, wobei es in und sind damit an bestimmte Pflanzen in ausreichend der Regel zu einer Bestäubung kommt. Damit sind die großen Beständen gebunden. Außerdem werden be- Bienen die wichtigsten Bestäuberinsekten. Sie erbrin- sonnte Kleinstrukturen als Nisthabitate benötigt. Da- gen nicht nur eine enorme ökologische Leistung für die für kommen artspezifisch vegetationsarme Bodenstel- Erhaltung der Pflanzendiversität, sondern auch eine oft len, Böschungen, Totholz, dürre Pflanzenstängel, leere unterschätzte ökonomische Leistung. Von den weltweit Schneckengehäuse und anderes in Betracht (Westrich 124 wichtigsten Kulturpflanzen sind 87 Arten vollstän- 1989). Die Erhaltung und Neuanlage von Kleinstruktu- dig auf Bienen und andere tierische Bestäuber angewie- ren und blütenreichen Flächen ist dringend notwendig, sen (Klein et al. 2007). Der Wert der Bestäuberleistung um den Rückgang der Wildbienengemeinschaften im für die globale Landwirtschaft wird auf 153 Milliarden Offenland aufzuhalten. Dabei ist auch auf ein kontinu- Euro pro Jahr geschätzt (Gallai et al. -

Hymenoptera: Apoidea: Anthophila: Andrenidae) – the New Wild Bee Species for the Polish Fauna
POLISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY POLSKIE P I S M O ENTOMOLOGICZNE VOL. 78 : 369-376 Bydgoszcz 30 December 2009 Redescription of Andrena stragulata ILLIGER , 1806 (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila: Andrenidae) – the new wild bee species for the Polish fauna WALDEMAR CELARY *, BOGDAN WIŚNIOWSKI ** * Department of Ecology and Environment Protection, Institute of Biology, Jan Kochanowski University, Świ ętokrzyska 15, 25-406 Kielce, Poland, e-mail: [email protected] ** Ojców National Park, 32-047 Ojców, Poland, e-mail: [email protected] ABSTRACT. First record of Andrena stragulata ILLIGER , 1806 (Apoidea: Anthophila: Andrenidae) from Poland is presented. Information on morphology (diagnosis and redescription), bionomics and dis- tribution of the species is given. KEY WORDS: Hymenoptera, Apoidea: Andrenidae, Andrena stragulata , new records, biology, distri- bution, Poland. INTRODUCTION During research on the biodiversity of wild bees of the Magurski National Park (south- eastern Poland) two males of Andrena sp. were collected. They were identified as A. stragulata ILLIGER , 1806 - the species not recorded previously from Poland (BANASZAK 2000, DYLEWSKA 1997). It was the starting point for research of specimens in Polish col- lections of wild bees and their results indicate that Andrena stragulata ILL . is a good spe- cies. Untill present, A. stragulata ILL . was recognized as the first generation of Andrena rosae PANZER , 1801 (DYLEWSKA 1987, GUSENLEITNER , SCHWARZ 2002, W ESTRICH 1990). This paper gives diagnosis, redescription and data on bionomics and distribution (some of the data after: ELSE & ROBERTS 2009, GUSENLEITNER & SCHWARZ 2002, MONSEVI ČIUS 370 Polish Journal of Entomology 78 (4) 1995, W ESTRICH 1990) of A. stragulata ILL . -

Rote Liste Wildbienen
154496_IH.qxp 06.12.2005 14:49 Seite 1 Vorwort Rote Listen gefährdeter Organismen dokumentieren den Kenntnisstand über die Gefährdung der einzelnen Arten und über den Anteil gefährdeter Arten der betrach- teten Sippe. Sie sind damit sowohl ein Instrument der Umweltindikation als auch der Fachplanung des Naturschutzes, z. B. Grundlage für Arten- und Biotopschutz- programme. Nicht zuletzt dienen sie zur Information der Öffentlichkeit. Rote Listen erleichtern es auch, Landschaften, Landschaftsteile und Biotope anhand der Vorkommen gefährdeter Arten zu bewerten. Bei der Einstufung der Gefährdung innerhalb der Artengruppen werden feste Bewertungskriterien angelegt, die den Vergleich mit anderen Bundesländern ermöglichen. Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten Sachsens werden entsprechend dem Bearbeitungsstand in loser Folge und nach einheitlicher Gliederung herausge- geben. Eine spätere Aktualisierung dieser Listen ist notwendig und geplant. Anregungen hierzu werden von uns gern entgegengenommen. Hartmut Biele Präsident des Sächsischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 1 154496_IH.qxp 06.12.2005 14:49 Seite 2 Rote Liste Wildbienen 1 Einleitung material von mineralischen Substraten über pflanzliches Material bis zu Wildbienen sind eigentlich populär und Drüsensekreten, wie dem Wachs der trotzdem in ihrer gesamten Vielfalt Hummeln und der Honigbiene. Die mei- wenig bekannt, denn außer der heimi- sten Wildbienenarten nisten solitär (ein- sche Honigbiene und den Hummeln zeln), wobei die Nestversorgung allein gehören ca. 550 in Deutschland heimi- dem Weibchen obliegt. Daneben exi- sche Arten zu dieser Artengruppe stieren verschiedene Sozialitätsstufen. (WESTRICH & DATHE 1997, 1998; Die höchste Form der Staatenbildung WESTRICH 1999). Durch neuere Bestim- erreichen die hoch sozialen (eusozialen) mungswerke haben sich die auftreten- Hummeln und Honigbienen, die eine den Bestimmungsprobleme erheblich Kastendifferenzierung mit eierlegender verringert. -

Kommentierte Rote Liste Der Bienen Hessens – Artenliste, Verbreitung, Gefährdung
Kommentierte Rote Liste der Bienen Hessens – Artenliste, Verbreitung, Gefährdung. 1. Fassung Stefan Tischendorf, Ulrich Frommer, Hans-Joachim Flügel, Karl-Heinz Schmalz, Wolfgang H.O. Dorow im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV). 3 Inhaltsübersicht 1. Zusammenfassung 4 2. Einleitung 5 3. Lebensraum, Nistweise und Nahrungsangebot 7 4. Geomorphologie, Naturräume und Klima 9 5. Bewertungsgrundlagen zur Roten Liste 12 6. Kenntnisstand zur Bienenfauna Hessens 19 7. Artenliste der Wildbienen Hessens 32 8. Kommentierte Arten 51 9. Statistische Auswertung zur Roten Liste 111 10. Besondere Verantwortung Hessens für bestandsgefährdete Arten in Deutschland 112 11. Verbreitungstypen von Bienen in Hessen 114 12. Danksagung 133 13. Literaturanhang 134 14. Impressum 151 4 1. Zusammenfassung Die Erfassung der Bienenfauna in den Grenzen des heutigen Bundeslandes Hessen hat eine lange Tradition. Um etwa 1850 beginnt mit der intensiven Feldarbeit von Adolph Schenck und Carl Ludwig Kirschbaum die systemati- sche Erfassung und Beschreibung der Hymenopterenfauna im Herzogtum Nassau, das bis 1866 bestand und im Gebiet der heutigen Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz lag. Das Herzogtum Nassau bzw. das spätere „Hessen-Nassau“ gingen 1945 im neu gegründeten Bundesland Hessen auf, wodurch bei der Bestandsaufnahme der Bienenfauna in Hessen auf Daten zurückgegriffen werden kann, die bis in die erste Hälfte des 19ten Jahrhun- derts zurückreichen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird nun erstmals die Landesfauna der Bienen Hessens beschrieben. Von 560 in Deutschland nachgewiesenen Bienenarten (WESTRICH et al. 2008) können demnach 424 zur Fauna Hessens gerechnet werden. Davon werden nachfolgend 264 Arten (62%) kommentiert dargestellt und mit Hin- weisen zur Lebensweise, Verbreitung und Gefährdung in Hessen versehen. -
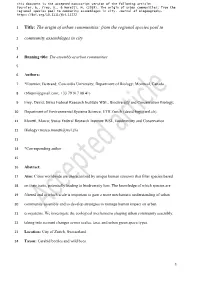
Accepted Version
This document is the accepted manuscript version of the following article: Fournier, B., Frey, D., & Moretti, M. (2019). The origin of urban communities: from the regional species pool to community assemblages in city. Journal of Biogeography. https://doi.org/10.1111/jbi.13772 1 Title: The origin of urban communities: from the regional species pool to 2 community assemblages in city 3 4 Running title: The assembly of urban communities 5 6 Authors: 7 *Fournier, Bertrand; Concordia University; Department of Biology; Montreal, Canada 8 ([email protected]; +33 79 917 08 41) 9 Frey, David; Swiss Federal Research Institute WSL, Biodiversity and Conservation Biology; 10 Department of Environmental Systems Science, ETH Zurich ([email protected]) 11 Moretti, Marco; Swiss Federal Research Institute WSL, Biodiversity and Conservation 12 Biology ([email protected]) 13 14 *Corresponding author 15 16 Abstract: 17 Aim: Cities worldwide are characterized by unique human stressors that filter species based 18 on their traits, potentially leading to biodiversity loss. The knowledge of which species are 19 filtered and at which scale is important to gain a more mechanistic understanding of urban 20 community assembly and to develop strategies to manage human impact on urban 21 ecosystems. We investigate the ecological mechanisms shaping urban community assembly, 22 taking into account changes across scales, taxa, and urban green space types. 23 Location: City of Zurich, Switzerland 24 Taxon: Carabid beetles and wild bees 1 25 Methods: We use a large species occurrence and trait dataset with a high spatial resolution to 26 assess the filtering effect of a medium-sized city on a regional pool of potential colonists. -

Taxonomie Assessment of Andrena Rosae and a Stragulata by DNA-Sequencing (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae)
Stuttgart: 2008-04 ISSN: 0171-8177 EGT-Nr 1.260 111 Taxonomie Assessment of Andrena rosae and A stragulata by DNA-Sequencing (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) M REEMER, DSJ GROENENBERG, C VAN ACHTERBERG &TMJ PEETERS Received: 2008-02-01 Accepted: 2008-02-24 REEMERM,GROENENBERGDS J &ACHTERBERGCVAN[Nat Mus Natur Rist, Europ Invertebr Surv, 2300 RA Leiden]; PEETERSTM J [Bargerveen Found / Dep Anim Eco1, Radboud Univ, 6500 GL Nijmegen]: Taxonomie Assessment of Andrena rosae and A stragu1ata by DNA-Sequencing (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). - Entomo1 Gener 31(1): 021-032; Stuttgart 2008-04. - - - [Article] Two taxa of the genus Andrena Fabricius 1775 (subgenus Hoplandrena Pérez 1890): A rosae Panzer 1801 andA stragulata Illiger 1806, are considered species by some authors; others consider A stragulata as the early spring generation of A rosae. In this paper the taxonomical status of both taxa is studied by comparing nuclear and mitochondrial DNA-sequences of spring and summer specimens trom the Biesbosch National Park in the Netherlands. Despite the differences in morphology, eidonomy and nesting sites, no consistent differences could be found in the DNA-sequences of both supposed species. Therefore, Andrena rosae is considered to be a bivoltine species: with a spring and a summer generation. Andrena stragulata is considered ajunior synonym of A rosae. This view is also supported by the distributional data of spring and summer specimens in the Netherlands. Key words: Andrena eximia Smith 1847 - A rosae Panzer 1801 - A stragulata Illiger 1806 - syno• nyms - spring generation - summer generation - Netherlands - DNA - COl REEMERM, GROENENBERGDS J & ACHTERBERGCVAN[National-Mus Naturgesch, Abtg Invertebrata, 2300 RA Leiden), PEETERSTM J [Bargervee Stiftung / Inst Tierökol, Radboud Univ, 6500 RA Ni• jmegen]: Taxonomische Betrachtung von Andrena rosae und A stragulata durch DNA -Sequencing (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). -

Apidae (Insecta: Hymenoptera) Fritz GUSENLEITNER, Max SCHWARZ & Karl MAZZUCCO
Apidae (Insecta: Hymenoptera) Apidae (Insecta: Hymenoptera) Fritz GUSENLEITNER, Max SCHWARZ & Karl MAZZUCCO Summary: Currently 690 species of Apidae (six subfamilies) are recorded from Austria. Zusammenfassung: Aus Österreich sind derzeit 690 Arten von Bienen (Apidae) aus sechs Unterfamilien bekannt. Key words: Hymenoptera, Apidae, Austria, checklist, biodiversity. 9 F. Gusenleitner, M. Schwarz & K. Mazzucco I Einleitung Bienen gehören zu den Hautfl üglern (Hymenoptera), der artenreichsten Insektenordnung Europas. Allein aus Mitteleuropa sind ca. 11.500 Arten bekannt, mit mindestens 12.000 ist jedoch zu rechnen, da laufend neue Arten gefunden bzw. beschrieben werden. Die Hymenoptera unterteilt man in Symphyta (Pfl anzenwespen) und Apocrita (Taillenwespen), letztere wiederum in Terebrantia (Schlupfwespen und Verwandte) und Aculeata (Stechimmen). Zu den Aculeaten zählen neben den Bienen Grab-, Weg-, Falten– und Goldwespen etc. sowie die Ameisen. Viele Aculeaten, so auch die Bienen, betreiben Brutvor– oder -fürsorge, manche sind Brutparasiten. Im Gegensatz zu allen anderen Aculeaten (Ausnahme Masarinae, Honigwespen, mit ei- ner Art in Österreich) ernähren Bienen jedoch ihren Nachwuchs mit Pollen, manch- mal ergänzt durch Nektar (bzw. Honig). Nach MICHENER 2007 sind weltweit 17.533 Bienenarten aus 443 Gattungen be- kannt. Da ständig weitere Arten beschrieben werden, ist jedoch eher von mindestens 20.000 Spezies auszugehen. In Österreich leben nach heutigem Stand 690 Arten in 48 Gattungen, aufgeteilt auf 6 Unterfamilien. Damit weist das Land die höch- ste Bienen-Biodiversität aller mitteleuropäischen Staaten auf. Allein im Bundesland Niederösterreich wurden mehr Bienenarten verzeichnet als in ganz Deutschland, in Polen, in der Schweiz oder in Ungarn. Grund dafür ist das Zusammentreffen von zwei großen europäischen Klimazonen in diesem Raum, nämlich dem ozeanisch getönten westeuropäischen und dem pannonischen Klima. -
Regional Red List of Irish Bees
REGIONAL RED LIST OF IRISH BEES 2006 Ú. Fitzpatrick, T.E. Murray, A. Byrne, R.J. Paxton & M.J.F. Brown THE CONSERVATION OF BEES IN IRELAND Table of contents INTRODUCTION 3 SECTION A: REGIONAL RED LIST OF IRISH BEES Development process 4 National red list summary 7 Checklist of Irish bees stating their national red list status 9 Regional red list (102 species) 10 SECTION B: IUCN CONSERVATION ACTIONS TEMPLATE FILE Conservation actions necessary for all threatened, near threatened and data deficient species 24 Summary of conservation actions required 31 SECTION C: NATIONAL PRIORITY SPECIES LIST National priority species list 33 Methodology 34 2006 2 INTRODUCTION In 2003 the Higher Education Authority awarded funding for a three year project on the conservation of native Irish bees under their North-South programme for collaborative research. This work was undertaken by Dr. Úna Fitzpatrick and Dr. Mark Brown in the School of Natural Sciences, Trinity College Dublin and by Mr. Tomás Murray and Dr. Rob Paxton in the School of School of Biological Sciences, Queen’s University Belfast. One important element of this research has been the documentation of the conservation status of native bees in Ireland. A three-step sequential process has been used to document the status of each of the native species, indicate the conservation action required, and highlight those species of most importance from a conservation perspective: (1) Identification of the threatened species using internationally recognized methodology - production of an IUCN regional red list for the island of Ireland. (2) Documentation of the total conservation actions required for the assessed group - completed IUCN conservation action authority files for threatened, near threatened and data deficient species. -

Complexul Muzeal De Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău STUDII ŞI COMUNICĂRI 2010 23 Editura „Ion Borcea” Bacău – 2010 1 http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro 2 http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău STUDII ŞI COMUNICĂRI 2010 23 Editura „Ion Borcea” Bacău – 2010 3 http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro 4 http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro CUPRINS PART I – VEGETAL BIOLOGY Anca TUDOR-ANDREI - QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF ALGAL FLORA’S GALBENI LAKE, BACĂU COUNTY .......................................... 7 Otilia Carmen PAVEL - PRELIMINARY RESEARCH CONCERNING THE DIVERSITY OF MACROMYCETES IN PRALEA BROOK BASIN (BACĂU COUNTY) ............................................................................................................................... 14 Ortansa JIGĂU - BIOMASS STUDY OF TWO EDIBLE MACROMYCETES SPECIES ................................................................................................................................. 24 Irina - Mădălina ARDEI - FLORISTIC DIVERSITY OF CORMOPHYTAE IN BERZUNŢI MOUNTAINS, BACĂU COUNTY................................................................. 27 Daniel – Ioan MAFTEI, Cosmin Teodor MIHAI, Diana-Elena MAFTEI - COMPARATIVE STUDY OF THE GLUCOSE AMOUNT IN CONVENTIONAL AND IN VITRO CULTURES OF STACHYS SIEBOLDII MIQ.......................................... 30 PART II – ANIMAL BIOLOGY -

Inwentaryzacja I Waloryzacja Przyrodnicza Popradzkiego Parku Krajobrazowego Na Terenie Gmin Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Pi
INWENTARYZACJA I WALORYZACJA PRZYRODNICZA POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO NA TERENIE GMIN KRYNICA-ZDRÓJ, ŁABOWA, MUSZYNA, PIWNICZNA- ZDRÓJ, RYTRO I STARY SĄCZ W RAMACH PROJEKTU PN. „SPOSOBY POSZUKIWANIA SYNERGII POMIĘDZY DZIEDZICTWEM PRZYRODNICZYM POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO, A ROZWOJEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM OBSZARU ORAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA” Cz.II Kielce 2017/2018 1 2 Wykaz osób biorących udział w wykonaniu opracowania: Redakcja: dr Alojzy Przemyski Opracowanie GIS i kartograficzne: mgr Piotr Przemyski, mgr Jan Starus Prace redakcyjne: dr Paweł Paciorek, mgr Aleksandra Chmaruk Autor zdjęcia na okładce: mgr Jan Starus Wykaz osób realizujących badania terenowe: - zbiorowiska roślinne i flora naczyniowa: dr Alojzy Przemyski, dr Grzegorz Łazarski, dr Donata Suder, dr Maria Janicka, mgr Aleksandra Chmaruk, mgr Jan Starus, mgr Anna Orlik-Zastępa - mszaki: dr hab. Adam Stebel - grzyby: mgr inż. Piotr Chachuła - porosty: dr hab. Beata Krzewicka - fauna: ssaków: dr Paweł Paciorek, mgr inż. Jolanta Jurkiewicz nietoperzy: Wojciech J. Gubała ptaków: dr hab. Łukasz Kajtoch, dr Tomasz Wilk, mgr inż. Piotr Guzik, mgr Jakub Hasny, mgr Marcin Urbański, Tomasz Baziak, Rafał Bobrek płazów i gadów: dr hab. Sebastian Hofman, dr hab. Artur Osikowski ryb: mgr Krzysztof Tatoj mięczaków: mgr Anna Lipińska motyli: mgr Andrzej Staśkowiak trzmieli i chrząszczy: dr Krzysztof Werstak Fotopułapki: - montaż fotopułapek: mgr Henryk Benkowski (B2B Security), mgr inż. Jolanta Jurkiewicz, dr Paweł Paciorek - obsługa techniczna: mgr inż. Jolanta Jurkiewicz 3 4 -

Rote Liste Der Bienen Hessen 2009
HessischesMinisteriumfürUmwelt,Energie LandwirtschaftundVerbraucherschutz KommentierteRoteListe derBienenHessens– Artenliste,Verbreitung,Gefährdung. Kommentierte Rote Liste der Bienen Hessens – Artenliste, Verbreitung, Gefährdung. 1. Fassung Stefan Tischendorf, Ulrich Frommer, Hans-Joachim Flügel, Karl-Heinz Schmalz, Wolfgang H.O. Dorow im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV). 3 Inhaltsübersicht 1. Zusammenfassung 4 2. Einleitung 5 3. Lebensraum, Nistweise und Nahrungsangebot 7 4. Geomorphologie, Naturräume und Klima 9 5. Bewertungsgrundlagen zur Roten Liste 12 6. Kenntnisstand zur Bienenfauna Hessens 19 7. Artenliste der Wildbienen Hessens 32 8. Kommentierte Arten 51 9. Statistische Auswertung zur Roten Liste 111 10. Besondere Verantwortung Hessens für bestandsgefährdete Arten in Deutschland 112 11. Verbreitungstypen von Bienen in Hessen 114 12. Danksagung 133 13. Literaturanhang 134 14. Impressum 151 4 1. Zusammenfassung Die Erfassung der Bienenfauna in den Grenzen des heutigen Bundeslandes Hessen hat eine lange Tradition. Um etwa 1850 beginnt mit der intensiven Feldarbeit von Adolph Schenck und Carl Ludwig Kirschbaum die systemati- sche Erfassung und Beschreibung der Hymenopterenfauna im Herzogtum Nassau, das bis 1866 bestand und im Gebiet der heutigen Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz lag. Das Herzogtum Nassau bzw. das spätere „Hessen-Nassau“ gingen 1945 im neu gegründeten Bundesland Hessen auf, wodurch bei der Bestandsaufnahme der Bienenfauna in Hessen auf Daten zurückgegriffen werden kann, die bis in die erste Hälfte des 19ten Jahrhun- derts zurückreichen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird nun erstmals die Landesfauna der Bienen Hessens beschrieben. Von 560 in Deutschland nachgewiesenen Bienenarten (WESTRICH et al. 2008) können demnach 424 zur Fauna Hessens gerechnet werden. Davon werden nachfolgend 264 Arten (62%) kommentiert dargestellt und mit Hin- weisen zur Lebensweise, Verbreitung und Gefährdung in Hessen versehen. -

Downloaded 2021-09-29T16:00:55Z
Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title Regional red list of Irish bees Authors(s) Fitzpatrick, Ú.; Murray, T. E.; Byrne, Andrew W.; Paxton, R. J.; Brown, M. J. F. Publication date 2006 Publisher National Parks and Wildlife Service (Ireland) and Environment and Heritage Service (N. Ireland) Link to online version http://www.npws.ie/publications/redlists/Fitzpatrick_et_al_2006_Bee_Red_List.pdf Item record/more information http://hdl.handle.net/10197/5341 Notes The National Parks and Wildlife Service Red Lists are available online at http://www.npws.ie/publications/redlists/ Downloaded 2021-09-29T16:00:55Z The UCD community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters! (@ucd_oa) © Some rights reserved. For more information, please see the item record link above. REGIONAL RED LIST OF IRISH BEES 2006 Ú. Fitzpatrick, T.E. Murray, A. Byrne, R.J. Paxton & M.J.F. Brown THE CONSERVATION OF BEES IN IRELAND Table of contents INTRODUCTION 3 SECTION A: REGIONAL RED LIST OF IRISH BEES Development process 4 National red list summary 7 Checklist of Irish bees stating their national red list status 9 Regional red list (102 species) 10 SECTION B: IUCN CONSERVATION ACTIONS TEMPLATE FILE Conservation actions necessary for all threatened, near threatened and data deficient species 24 Summary of conservation actions required 31 SECTION C: NATIONAL PRIORITY SPECIES LIST National priority species list 33 Methodology 34 2006 2 INTRODUCTION In 2003 the Higher Education Authority awarded funding for a three year project on the conservation of native Irish bees under their North-South programme for collaborative research.