Dissertation Mag. Kamila Labas 11 03 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Orontids of Armenia by Cyril Toumanoff
The Orontids of Armenia by Cyril Toumanoff This study appears as part III of Toumanoff's Studies in Christian Caucasian History (Georgetown, 1963), pp. 277-354. An earlier version appeared in the journal Le Muséon 72(1959), pp. 1-36 and 73(1960), pp. 73-106. The Orontids of Armenia Bibliography, pp. 501-523 Maps appear as an attachment to the present document. This material is presented solely for non-commercial educational/research purposes. I 1. The genesis of the Armenian nation has been examined in an earlier Study.1 Its nucleus, succeeding to the role of the Yannic nucleus ot Urartu, was the 'proto-Armenian,T Hayasa-Phrygian, people-state,2 which at first oc- cupied only a small section of the former Urartian, or subsequent Armenian, territory. And it was, precisely, of the expansion of this people-state over that territory, and of its blending with the remaining Urartians and other proto- Caucasians that the Armenian nation was born. That expansion proceeded from the earliest proto-Armenian settlement in the basin of the Arsanias (East- ern Euphrates) up the Euphrates, to the valley of the upper Tigris, and espe- cially to that of the Araxes, which is the central Armenian plain.3 This expand- ing proto-Armenian nucleus formed a separate satrapy in the Iranian empire, while the rest of the inhabitants of the Armenian Plateau, both the remaining Urartians and other proto-Caucasians, were included in several other satrapies.* Between Herodotus's day and the year 401, when the Ten Thousand passed through it, the land of the proto-Armenians had become so enlarged as to form, in addition to the Satrapy of Armenia, also the trans-Euphratensian vice-Sa- trapy of West Armenia.5 This division subsisted in the Hellenistic phase, as that between Greater Armenia and Lesser Armenia. -

Religion in the South Caucasus
CAUCASUS ANALYTICAL DIGEST No. 20, 11 October 2010 7 The Role of the Armenian Church During Military Conflicts By Harutyun Harutyunyan, Yerevan Abstract Throughout its history, Armenia frequently has been a battlefield for foreign forces. Consequently, Armenians have repeatedly been forced to fight for their freedom. Society highly valued such resistance and Church lead- ers glorified these combatants as heroes. During the Armenian–Persian war in the th5 century, the death of Christian soldiers was defined as self-sacrifice and the Church canonized them as “fighting martyrs.” This attitude towards sacred militarism continued to be evident from that time through the present. The main focus of the following article is to examine how the Armenian Church legitimized the use of violence, espe- cially during the Nagorno-Karabakh conflict (1988–1994). For the future, it suggests a critical analysis of traditional Church–State relations and a complete separation between politics and religion. A History of Invasions the state religion and, with the blessing of the bishops, Since the beginning of the first millennium, Armenia started a campaign of compulsory conversion. One hun- has struggled to preserve its existence between power- dred years later, Armenian clerical historians started to ful empires. For this reason, every century of Armenian write about “defensive and liberating wars.” Such resis- history is filled with armed conflicts. In the 4th century, tance was glorified as heroism. In contrast, foreign con- Eastern Rome and Sassanid Persia divided the kingdom querors were demonized and classified as fiends and between them. After a long period of resistance, the Arme- brutes. -

Georgian Country and Culture Guide
Georgian Country and Culture Guide მშვიდობის კორპუსი საქართველოში Peace Corps Georgia 2017 Forward What you have in your hands right now is the collaborate effort of numerous Peace Corps Volunteers and staff, who researched, wrote and edited the entire book. The process began in the fall of 2011, when the Language and Cross-Culture component of Peace Corps Georgia launched a Georgian Country and Culture Guide project and PCVs from different regions volunteered to do research and gather information on their specific areas. After the initial information was gathered, the arduous process of merging the researched information began. Extensive editing followed and this is the end result. The book is accompanied by a CD with Georgian music and dance audio and video files. We hope that this book is both informative and useful for you during your service. Sincerely, The Culture Book Team Initial Researchers/Writers Culture Sara Bushman (Director Programming and Training, PC Staff, 2010-11) History Jack Brands (G11), Samantha Oliver (G10) Adjara Jen Geerlings (G10), Emily New (G10) Guria Michelle Anderl (G11), Goodloe Harman (G11), Conor Hartnett (G11), Kaitlin Schaefer (G10) Imereti Caitlin Lowery (G11) Kakheti Jack Brands (G11), Jana Price (G11), Danielle Roe (G10) Kvemo Kartli Anastasia Skoybedo (G11), Chase Johnson (G11) Samstkhe-Javakheti Sam Harris (G10) Tbilisi Keti Chikovani (Language and Cross-Culture Coordinator, PC Staff) Workplace Culture Kimberly Tramel (G11), Shannon Knudsen (G11), Tami Timmer (G11), Connie Ross (G11) Compilers/Final Editors Jack Brands (G11) Caitlin Lowery (G11) Conor Hartnett (G11) Emily New (G10) Keti Chikovani (Language and Cross-Culture Coordinator, PC Staff) Compilers of Audio and Video Files Keti Chikovani (Language and Cross-Culture Coordinator, PC Staff) Irakli Elizbarashvili (IT Specialist, PC Staff) Revised and updated by Tea Sakvarelidze (Language and Cross-Culture Coordinator) and Kakha Gordadze (Training Manager). -

Distribution and a Comparative Analysis of the Aquatic Invertebrate
A peer-reviewed open-access journal Subterranean BiologyDistribution 18: 49–70 (2016) and a comparative analysis of the aquatic invertebrate fauna... 49 doi: 10.3897/subtbiol.18.8648 RESEARCH ARTICLE Subterranean Published by http://subtbiol.pensoft.net The International Society Biology for Subterranean Biology Distribution and a comparative analysis of the aquatic invertebrate fauna in caves of the western Caucasus Elena S. Chertoprud1, Dmitry M. Palatov2, Rostislav R. Borisov2, Vadim V. Marinskiy1, Michail S. Bizin3, Roman S. Dbar4 1 Department of Hydrobiology, Faculty of Biology, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1/12, 119991, Moscow, Russia 2 Institute of Fisheries and Oceanography, Verchnjaja Krasnoselskaja, 17, 107140, Moscow, Russia 3 Department of Soil Biology, Faculty of Soil Sciences, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1/12, 119991, Moscow, Russia 4 Institute of Ecology Academy of Science Abkhazia, Kra- snojamskaya, 67, 384905 Sukhumi, Abkhazia Corresponding author: Elena S. Chertoprud ([email protected]) Academic editor: O. Moldovan | Received 30 March 2016 | Accepted 31 May 2016 | Published 17 June 2016 http://zoobank.org/AAA68ABB-945E-421B-9B45-7C3FAE3AA2C3 Citation: Chertoprud ES, Palatov DM, Borisov RR, Marinskiy VV, Bizin MS, Dbar RS (2016) Distribution and a comparative analysis of the aquatic invertebrate fauna in caves of the western Caucasus. Subterranean Biology 18: 49–70. doi: 10.3897/subtbiol.18.8648 Abstract The freshwater fauna of nine caves in central Abkhazia, western Caucasus, revealed 35 species of stygo- bionts, including 15 new species to be described elsewhere. The number of species per station increased from the depth towards the entrance in caves Golova Otapa and Abrskila, becoming the highest in the epi- gean part. -

Armenian Church Timeline
“I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people, whose history is ended, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled, whose literature is unread, whose music is unheard, whose prayers are no longer uttered. Go ahead, destroy this race. Let us say that it is again 1915. There is war in the world. Destroy Armenia. See if you can do it. Send them from their homes into the desert. Let them have neither bread nor water. Burn their houses and their churches. See if they will not live again. See if they will not laugh again.” –William Saroyan ARMENIAN CHURCH TIMELINE 1. Birth of the Holy Savior Jesus Christ in Bethlehem. Years later, an Armenian prince, Abqar of Edessa (Urfa), invites Jesus to his court to cure him of an illness. Abgar’s messengers encounter Jesus on the road to Calvary and receive a piece of cloth impressed with the image of the Lord. When the cloth is brought back to Edessa, Abgar is healed. 33. Crucifixion, Resurrection and Ascension of Jesus Christ On the 50th day after the Resurrection (Pentecost)the Holy Spirit descends upon the Apostles gathered in Jerusalem. 43. The Apostle Thaddeus comes to Armenia to preach Christianity. He is martyred in Artaz in southeastern Armenia. 66-68. The Apostle Bartholomew preaches in Armenia. He is martyred in Albac, also in southeastern Armenia. The Armenian Church is apostolic because of the preaching of the Apostles Thaddeus and Bartholomew in Armenia. 75. King Sanatruk and his daughter, Sandoukht convert to Christianity. -

Armenian Tourist Attraction
Armenian Tourist Attractions: Rediscover Armenia Guide http://mapy.mk.cvut.cz/data/Armenie-Armenia/all/Rediscover%20Arme... rediscover armenia guide armenia > tourism > rediscover armenia guide about cilicia | feedback | chat | © REDISCOVERING ARMENIA An Archaeological/Touristic Gazetteer and Map Set for the Historical Monuments of Armenia Brady Kiesling July 1999 Yerevan This document is for the benefit of all persons interested in Armenia; no restriction is placed on duplication for personal or professional use. The author would appreciate acknowledgment of the source of any substantial quotations from this work. 1 von 71 13.01.2009 23:05 Armenian Tourist Attractions: Rediscover Armenia Guide http://mapy.mk.cvut.cz/data/Armenie-Armenia/all/Rediscover%20Arme... REDISCOVERING ARMENIA Author’s Preface Sources and Methods Armenian Terms Useful for Getting Lost With Note on Monasteries (Vank) Bibliography EXPLORING ARAGATSOTN MARZ South from Ashtarak (Maps A, D) The South Slopes of Aragats (Map A) Climbing Mt. Aragats (Map A) North and West Around Aragats (Maps A, B) West/South from Talin (Map B) North from Ashtarak (Map A) EXPLORING ARARAT MARZ West of Yerevan (Maps C, D) South from Yerevan (Map C) To Ancient Dvin (Map C) Khor Virap and Artaxiasata (Map C Vedi and Eastward (Map C, inset) East from Yeraskh (Map C inset) St. Karapet Monastery* (Map C inset) EXPLORING ARMAVIR MARZ Echmiatsin and Environs (Map D) The Northeast Corner (Map D) Metsamor and Environs (Map D) Sardarapat and Ancient Armavir (Map D) Southwestern Armavir (advance permission -
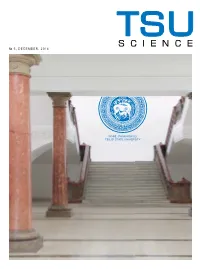
Tsutsu Sciencem E C N I E R E B a № 6, DECEMBER, 2014Dekemberi/2014/6
TSUTsu SCIENCEm e c n i e r e b a № 6, DECEMBER, 2014dekemberi/2014/6 IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY ISSN 2233-3657 9 772233 365003 Exhibition of rare books from the TSU library Erasmus of Rotterdam, Talks in Amsterdam, 1526 The Book of Hours, Kutaisi Typography, 1808 Gospel, Moscow Synod Typography, 1828 Georgian alphabet with prayers, Rome, 1629 TSU SCIENCE CONTENTS TSU SCIENCE • 2 0 1 4 7% 93% 7% 18% • THE COMET 26% 17 2011 2012 2013 EXPERIMENT AT 74% J-PARC: A STEP 82% 93% TOWARDS SOLVING TSU – A Brief Overview 3 THE MUON ENIGMA OF SCIENTIFIC ACTIVITY AND26% GRANTS Over 200 scientific projects are 74% presently being implemented at 28• THE GERMAN WAY OF LIFE IN THE CAUCASUS TSU. 31• THE IVIRON MONASTERY DURING THE OTTOMAN EMPIRE • 6 TWENTY YEARS OF JOINT RESEARCH 21• THE ECOLOGICAL 10• INTERFACIAL BIONANO- CONDITION OF 34• LAFFER-KEYNESIAN SCIENCE AT TBILISI THE BLACK SEA – SYNTHESIS AND STATE UNIVERSITY: ASSESSMENTS BY TSU MACROECONOMIC ACHIEVEMENTS AND SCIENTISTS EQUILIBRIUM PERSPECTIVES FOR GEORGIA 13• THE IMPACT OF MAD- NEULI MINING ON THE SOIL AND WATER OF THE BOLNISI REGION 39• THE STOCK MARKET IN GEORGIA: THE CURRENT REALITY AND AN UNCERTAIN FUTURE 25• FOOD AND VEGETATION IN KARTLI IN THE 5th-4th CC BC: FINDINGS ON GRAKLIANI HILL TSU CONTENTS SIENCEC Scientific-Popular Journal №6, 2014 Editorial Board: Vladimer Papava – Rector, Academician of the Georgian Na- • • tional Academy of Sciences, Chairman of the Editorial Board 41 T OHE R LE OF SOCIAL 52 EPIZOOTIC Levan Aleksidze – Deputy Rector, Academician of the -

The South Caucasus 2018
THE SOUTH CAUCASUS 2018 FACTS, TRENDS, FUTURE SCENARIOS Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) is a political foundation of the Federal Republic of Germany. Democracy, peace and justice are the basic principles underlying the activities of KAS at home as well as abroad. The Foundation’s Regional Program South Caucasus conducts projects aiming at: Strengthening democratization processes, Promoting political participation of the people, Supporting social justice and sustainable economic development, Promoting peaceful conflict resolution, Supporting the region’s rapprochement with European structures. All rights reserved. Printed in Georgia. Konrad-Adenauer-Stiftung Regional Program South Caucasus Akhvlediani Aghmarti 9a 0103 Tbilisi, Georgia www.kas.de/kaukasus Disclaimer The papers in this volume reflect the personal opinions of the authors and not those of the Konrad Adenauer Foundation or any other organizations, including the organizations with which the authors are affiliated. ISBN 978-9941-0-5882-0 © Konrad-Adenauer-Stiftung e.V 2013 Contents Foreword ........................................................................................................................ 4 CHAPTER I POLITICAL TRANSFORMATION: SHADOWS OF THE PAST, FACTS AND ANTICIPATIONS The Political Dimension: Armenian Perspective By Richard Giragosian .................................................................................................. 9 The Influence Level of External Factors on the Political Transformations in Azerbaijan since Independence By Rovshan Ibrahimov -

Wikivoyage Georgia.Pdf
WikiVoyage Georgia March 2016 Contents 1 Georgia (country) 1 1.1 Regions ................................................ 1 1.2 Cities ................................................. 1 1.3 Other destinations ........................................... 1 1.4 Understand .............................................. 2 1.4.1 People ............................................. 3 1.5 Get in ................................................. 3 1.5.1 Visas ............................................. 3 1.5.2 By plane ............................................ 4 1.5.3 By bus ............................................. 4 1.5.4 By minibus .......................................... 4 1.5.5 By car ............................................. 4 1.5.6 By train ............................................ 5 1.5.7 By boat ............................................ 5 1.6 Get around ............................................... 5 1.6.1 Taxi .............................................. 5 1.6.2 Minibus ............................................ 5 1.6.3 By train ............................................ 5 1.6.4 By bike ............................................ 5 1.6.5 City Bus ............................................ 5 1.6.6 Mountain Travel ....................................... 6 1.7 Talk .................................................. 6 1.8 See ................................................... 6 1.9 Do ................................................... 7 1.10 Buy .................................................. 7 1.10.1 -

Some Notes on the Topography of Eastern Pontos Euxeinos in Late Antiquity and Early
Andrei Vinogradov SOME NOTES ON THE TOPOGRAPHY OF EASTERN PONTOS EUXEINOS IN LATE ANTIQUITY AND EARLY BYZANTIUM BASIC RESEARCH PROGRAM WORKING PAPERS SERIES: HUMANITIES WP BRP 82/HUM/2014 This Working Paper is an output of a research project implemented within NRU HSE’s Annual Thematic Plan for Basic and Applied Research. Any opinions or claims contained in this Working Paper do not necessarily reflect the views of HSE. Andrei Vinogradov1 SOME NOTES ON THE TOPOGRAPHY OF EASTERN PONTOS EUXEINOS IN LATE ANTIQUITY AND EARLY BYZANTIUM2 This paper clarifies some issues of late antique and early Byzantine topography of Eastern Pontos Euxeinos. These questions can be divided into two large groups: the ecclesiastical topography and the locations of Byzantine fortresses. The earliest testimony of Apostolic preaching on the Eastern black sea coast—the list of the apostles by Pseudo- Epiphanius—following the ‘Chronicon’ of Hyppolitus of Rome, unsuccessfully connects South- Eastern Pontos Euxeinos to Sebastopolis the Great (modern Sukhumi), which subsequently gives rise to an itinerary of the apostle Andrew. The Early Byzantine Church in the region had a complicated arrangement: the Zekchians, Abasgians and possibly Apsilians had their own bishoprics (later archbishoprics); the Lazicans had a metropolitan in Phasis (and not in their capital Archaeopolis) with five bishop-suffragans. Byzantine fortresses, mentioned in 7th c sources, are located mostly in Apsilia and Missimiania, in the Kodori valley, which had strategic importance as a route from -

Arrival in Baku Itinerary for Azerbaijan, Georgia
Expat Explore - Version: Thu Sep 23 2021 16:18:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Page: 1/15 Itinerary for Azerbaijan, Georgia & Armenia • Expat Explore Start Point: End Point: Hotel in Baku, Hotel in Yerevan, Please contact us Please contact us from 14:00 hrs 10:00 hrs DAY 1: Arrival in Baku Start in Baku, the largest city on the Caspian Sea and capital of Azerbaijan. Today you have time to settle in and explore at leisure. Think of the city as a combination of Paris and Dubai, a place that offers both history and contemporary culture, and an intriguing blend of east meets west. The heart of the city is a UNESCO World Heritage Site, surrounded by a fortified wall and pleasant pedestrianised boulevards that offer fantastic shopping opportunities. Attractions include the local Carpet Museum and the National Museum of History and Azerbaijan. Experiences Expat Explore - Version: Thu Sep 23 2021 16:18:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Page: 2/15 Arrival. Join up with the tour at our starting hotel in Baku. If you arrive early you’ll have free time to explore the city. The waterfront is a great place to stroll this evening, with a cooling sea breeze and plenty of entertainment options and restaurants. Included Meals Accommodation Breakfast: Lunch: Dinner: Hotel Royal Garden DAY 2: Baku - Gobustan National Park - Mud Volcano Safari - Baku Old City Tour After breakfast, dive straight into exploring the history of Azerbaijan! Head south from Baku to Gobustan National Park. This archaeological reserve is home to mud volcanoes and over 600,000 ancient rock engravings and paintings. -

CJSS Second Issue:CJSS Second Issue.Qxd
Caucasus Journal of Social Sciences The University of Georgia 2009 Caucasus Journal of Social Sciences UDC(uak)(479)(06) k-144 3 Caucasus Journal of Social Sciences Caucasus Journal of Social Sciences EDITOR IN CHIEF Julieta Andghuladze EDITORIAL BOARD Edward Raupp Batumi International University Giuli Alasania The University of Georgia Janette Davies Oxford University Ken Goff The University of Georgia Kornely Kakachia Associate Professor Michael Vickers The University of Oxford Manana Sanadze The University of Georgia Mariam Gvelesiani The University of Georgia Marina Meparishvili The University of Georgia Mark Carper The University of Alaska Anchorage Natia Kaladze The University of Georgia Oliver Reisner The Humboldt University Sergo Tsiramua The University of Georgia Tamar Lobjanidze The University of Georgia Tamaz Beradze The University of Georgia Timothy Blauvelt American Councils Tinatin Ghudushauri The University of Georgia Ulrica Söderlind Stockholm University Vakhtang Licheli The University of Georgia 4 Caucasus Journal of Social Sciences Printed at The University of Georgia Copyright © 2009 by the University of Georgia. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, in any form or any means, electornic, photocopinying, or otherwise, without prior written permission of The University of Georgia Press. No responsibility for the views expressed by authors in the Caucasus Journal of Social Sciences is assumed by the editors or the publisher. Caucasus Journal of Social Sciences is published annually by The University