Dynastie Im Bild
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser Und Gärten Berlin-Brandenburg
Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Band 2 1997/1998 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online- Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Berichte Generaldirektion Schwerpunkte in der öffentlich wirksamen Arbeit der Generaldirektion, zu der das Büro des Generaldirektors, der persönliche Referent, das Pressereferat, das Referat für Publikationen und der Stiftungskonservator gehören, waren neben der Koordination und Planung der Publikationstätigkeit der Stiftung wiederum die Organisation protokollarischer Veranstaltungen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In den Berichtsjahren wurden insgesamt 40 (1997: 18; 1998: 22) Pressetermine durchgeführt. Dazu gehörten Pressekonferenzen beziehungsweise Pressevorbesichtigungen, Fototermine und Hintergrundgespräche. Außerdem gab die Pressestelle insgesamt 104 (1997: 46; 1998: 58) Presseinformationen heraus. Über die regelmäßigen Berichte und Reportagen in den regionalen Tageszeitungen -

11. Heine and Shakespeare
https://www.openbookpublishers.com © 2021 Roger Paulin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt the text and to make commercial use of the text providing attribution is made to the authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: Roger Paulin, From Goethe to Gundolf: Essays on German Literature and Culture. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2021, https://doi.org/10.11647/OBP.0258 Copyright and permissions for the reuse of many of the images included in this publication differ from the above. Copyright and permissions information for images is provided separately in the List of Illustrations. In order to access detailed and updated information on the license, please visit, https://doi.org/10.11647/OBP.0258#copyright Further details about CC-BY licenses are available at, https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ All external links were active at the time of publication unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Updated digital material and resources associated with this volume are available at https://doi.org/10.11647/OBP.0258#resources Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. ISBN Paperback: 9781800642126 ISBN Hardback: 9781800642133 ISBN Digital (PDF): 9781800642140 ISBN Digital ebook (epub): 9781800642157 ISBN Digital ebook (mobi): 9781800642164 ISBN Digital (XML): 9781800642171 DOI: 10.11647/OBP.0258 Cover photo and design by Andrew Corbett, CC-BY 4.0. -

Swedish Royal Ancestry Book 4 1751-Present
GRANHOLM GENEALOGY SWEDISH ANCESTRY Recent Royalty (1751 - Present) INTRODUCTION Our Swedish ancestry is quite comprehensive as it covers a broad range of the history. For simplicity the information has been presented in four different books. Book 1 – Mythical to Viking Era (? – 1250) Book 2 – Folkunga Dynasty (1250 – 1523) Book 3 – Vasa Dynasty (1523 – 1751) Book 4 – Recent Royalty (1751 – Present) Book 4 covers the most recent history including the wars with Russia that eventually led to the loss of Finland to Russia and the emergence of Finland as an independent nation as well as the history of Sweden during World Wars I and II. A list is included showing our relationship with the royal family according to the lineage from Nils Kettilsson Vasa. The relationship with the spouses is also shown although these are from different ancestral lineages. Text is included for those which are highlighted in the list. Lars Granholm, November 2009 Recent Swedish Royalty Relationship to Lars Erik Granholm 1 Adolf Frederick King of Sweden b. 14 May 1710 Gottorp d. 1771 Stockholm (9th cousin, 10 times removed) m . Louisa Ulrika Queen of Sweden b. 24 July 1720 Berlin d. 16 July 1782 Swartsjö ( 2 2 n d c o u s i n , 1 1 times removed) 2 Frederick Adolf Prince of Sweden b. 1750 d. 1803 (10th cousin, 9 times removed) 2 . Sofia Albertina Princess of Sweden b, 1753 d. 1829 (10th cousin, 9 times removed) 2 . Charles XIII King of Sweden b. 1748 d. 1818 (10th cousin, 9 times removed) 2 Gustav III King of Sweden b. -

Schmidt, Georg Friedrich
Gefördert durch die www.digiporta.net Schmidt, Georg Friedrich Porträtdarstellung: Schmidt, Georg Friedrich Verweisung: Schmidt, Georg F. Schmid, Georg F. Schmidt, George F. Schmidt, G. F. PT_10095_GF G. F. S. Kurzbiografie: Preussischer Kupferstecher Lebensdaten: 24.01.1712 - 25.01.1775 Geburtsort: Schönerlinde Sterbeort: Berlin Land: Deutschland Russland Frankreich Berufsindex: Kupferstecher, Maler Normdaten: DNB: 104160802 DBpedia: Georg_Friedrich_Schmidt VIAF: 19946384 Quellen: Deutsche Nationalbibliothek Wikipedia Deutsche Digitale Bibliothek Deutsche Biographie, NDB/ADB www.digiporta.net Seite 1 von 4 Beschreibung: Doppelporträt mit einem Ehepaar an einem runden Tisch sitzend, links die Frau auf einem Sessel mit hoher Rückenlehne, etwas nach vorn gebeugt und an ein Kissen gelehnt, nach links gewandt, den Kopf im Halbprofil, das Kinn auf die rechte Hand gestützt, mit weitem Kleid, Armband, Ohrringen und Haarschmuck, rechts der Mann, ebenfalls auf einem Sessel mit hoher Rückenlehne, an den sich eine Katze klammert. Bei dem Ehepaar handelt es sich um den Maler und Kupferstecher Georg Friedrich Schmidt und seiner Frau Dorothea Luise, geb. Videbant. Der Dargestellte ist nach rechts gewandt und über den Tisch gebeugt, Kopf im Halbprofil, Blick nach vorn zum Betrachter, beide Arme auf eine Kupferplatte gelegt, die auf dem Tisch liegt, in der linken Hand ein aufgeschlagenes Buch haltend, darin zu lesen der Titel der zwei Seiten: "LA IMPOSSIBLE", mit dem rechten Zeigefinger auf die Druckplatte weisend. Auf dem Tisch im Bildvordergrund Utensilien eines Kupferstechers, wie Grabstichel, Schneidnadel, Lupe und Tuch. Im Hintergrund eine dunkle Zimmerecke. Oberhalb des rechteckigen Bildfeldes aufgedruckt die Angabe: "Museum in Berlin", unten links und rechts die Künstleradressen, weiter unten die Namen der Dargestellten mit Beruf desselben auf Englisch ("G. -

9. Gundolf's Romanticism
https://www.openbookpublishers.com © 2021 Roger Paulin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt the text and to make commercial use of the text providing attribution is made to the authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: Roger Paulin, From Goethe to Gundolf: Essays on German Literature and Culture. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2021, https://doi.org/10.11647/OBP.0258 Copyright and permissions for the reuse of many of the images included in this publication differ from the above. Copyright and permissions information for images is provided separately in the List of Illustrations. In order to access detailed and updated information on the license, please visit, https://doi.org/10.11647/OBP.0258#copyright Further details about CC-BY licenses are available at, https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ All external links were active at the time of publication unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Updated digital material and resources associated with this volume are available at https://doi.org/10.11647/OBP.0258#resources Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. ISBN Paperback: 9781800642126 ISBN Hardback: 9781800642133 ISBN Digital (PDF): 9781800642140 ISBN Digital ebook (epub): 9781800642157 ISBN Digital ebook (mobi): 9781800642164 ISBN Digital (XML): 9781800642171 DOI: 10.11647/OBP.0258 Cover photo and design by Andrew Corbett, CC-BY 4.0. -
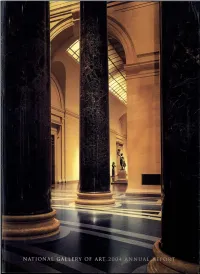
Annual Report 2004
mma BOARD OF TRUSTEES Richard C. Hedreen (as of 30 September 2004) Eric H. Holder Jr. Victoria P. Sant Raymond J. Horowitz Chairman Robert J. Hurst Earl A. Powell III Alberto Ibarguen Robert F. Erburu Betsy K. Karel Julian Ganz, Jr. Lmda H. Kaufman David 0. Maxwell James V. Kimsey John C. Fontaine Mark J. Kington Robert L. Kirk Leonard A. Lauder & Alexander M. Laughlin Robert F. Erburu Victoria P. Sant Victoria P. Sant Joyce Menschel Chairman President Chairman Harvey S. Shipley Miller John W. Snow Secretary of the Treasury John G. Pappajohn Robert F. Erburu Sally Engelhard Pingree Julian Ganz, Jr. Diana Prince David 0. Maxwell Mitchell P. Rales John C. Fontaine Catherine B. Reynolds KW,< Sharon Percy Rockefeller Robert M. Rosenthal B. Francis Saul II if Robert F. Erburu Thomas A. Saunders III Julian Ganz, Jr. David 0. Maxwell Chairman I Albert H. Small John W. Snow Secretary of the Treasury James S. Smith Julian Ganz, Jr. Michelle Smith Ruth Carter Stevenson David 0. Maxwell Roselyne C. Swig Victoria P. Sant Luther M. Stovall John C. Fontaine Joseph G. Tompkins Ladislaus von Hoffmann John C. Whitehead Ruth Carter Stevenson IJohn Wilmerding John C. Fontaine J William H. Rehnquist Alexander M. Laughlin Dian Woodner ,id Chief Justice of the Robert H. Smith ,w United States Victoria P. Sant John C. Fontaine President Chair Earl A. Powell III Frederick W. Beinecke Director Heidi L. Berry Alan Shestack W. Russell G. Byers Jr. Deputy Director Elizabeth Cropper Melvin S. Cohen Dean, Center for Advanced Edwin L. Cox Colin L. Powell John W. -

CHAPTER ONE Page 23
FREDERICK THE GREAT‟S PORCELAIN DIVERSION: THE CHINESE TEA HOUSE AT SANSSOUCI Tania Solweig Shamy Department of Art History and Communication Studies McGill University, Montreal October 2009 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of doctor of philosophy. ©Tania Solweig Shamy 2009 Abstract This thesis signals a new approach in the study of the Chinese Tea House at Sanssouci. It argues that Frederick the Great‟s exotic pavilion, although made of sandstone and stucco, is porcelain in essence. The garden building reflects the many meanings of this highly valued commodity and art form in the privileged society of the king and his contemporaries. The pavilion is unique in that it was inspired by the type of sculptural ornament designed to decorate the eighteenth- century table of the nobility. The Tea House is a thematically integrated structure that demonstrates the influence of porcelain on interior décor and architecture. The designation of the garden building as a Gesamtkunstwerk acknowledges the blending of architecture, painting, and sculpture; characteristics shared by porcelain centerpieces. They exemplify the intermediality associated with the development of eighteenth- century porcelain and the interpretation of Frederick‟s pavilion. ii Résumé Cette thèse annonce une approche nouvelle dans l‟étude de la Maison de Thé Chinoise à Sans-Souci. Elle soutient que le pavillon exotique de Frédéric Le Grand, fait de pierre et de stuc, représentait intrinsèquement la porcelaine. Ainsi, cette construction de jardin refléterait de fait les sens multiples accordés par la société privilégiée du Roi et de ses contemporains à cette commodité de luxe et à cette forme d‟art. -

Art and Power in the Reign of Catherine the Great: the State Portraits
Art and Power in the Reign of Catherine the Great: The State Portraits Erin McBurney Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2014 © 2014 Erin McBurney !All rights reserved ABSTRACT Art and Power in the Reign of Catherine the Great: The State Portraits Erin McBurney This dissertation examines the relationship between art and power in the reign of Catherine II of Russia (1762-1796). It considers Catherine’s state portraits as historical texts that revealed symbolic manifestations of autocratic power, underscoring the close relationship between aesthetics and politics during the reign of Russia’s longest serving female ruler. The Russian empress actively exploited the portrait medium in order to transcend the limitations of her gender, assert legitimacy and display herself as an exemplar of absolute monarchy. The resulting symbolic representation was protean and adaptive, and it provided Catherine with a means to negotiate the anomaly of female rule and the ambiguity of her Petrine inheritance. In the reign of Catherine the Great, the state portraits functioned as an alternate form of political discourse. TABLE OF CONTENTS List of Illustrations…………………………………………………..ii-v Introduction………………………………………………………...1-33 I. Ennui and Solitude……………………………………………...34-105 II. Seizing the Stage of Power…………………………………….106-139 III. Minerva Ascendant……………………………………………..140-212 IV. “Victorieuse et Legislatrice”…………………………………...213-279 V. Picturing the Greek Project…………………………………...280-340 VI. The Judgment of History…………………………………....…341-393 Conclusion……………………………………………………….394-397 Bibliography……………………………………………………,..398-426 i McBurney Art and Power List of Illustrations Figure 1. Godfrey Kneller, Peter I of Russia, 1698 2. -

Antoine Watteau, Originator of the Fête Galante Painting Style
1 CONTENTS Page 3 Press release Page 4 Introduction by Bruno Monnier, Founder and Chairman of Culturespaces Page 5 An exceptional loan from the Banque de France : la Fête à Saint-Cloud Page 6 Tour of the exhibition Page 10 Biography of the major artists included in the exhibition Page 12 The curatorial team Page 18 The scenography Page 19 Culturespaces, producer and director of the exhibition Page 20 Visitor aids Page 20 Publications Page 21 Media partners of the exhibition Page 26 The Musée Jacquemart-André Page 27 Visuals available for the press Page 30 Practical information 2 Musée Jacquemart-André Paris From Watteau to Fragonard, les fêtes galantes The age of insouciance At the Musée Jacquemart-André 14 March– 21 July, 2014 The Musée Jacquemart-André is delighted to be holding the exhibition "From Watteau to Fragonard, les fêtes galantes". There will be approximately sixty works on display, mostly paintings lent for the occasion by major collections, predominantly public, from countries including France, Germany, the UK and the USA. The poetical term fête galante refers to a new genre of paintings and drawings that blossomed in the early 18th century during the Regency period (1715-1723) and whose central figure was Jean-Antoine Watteau (1684-1721). Inspired by images of bucolic merrymaking in the Flemish tradition, Watteau and his followers created a new form, with a certain timelessness, characterised by greater subtlety and nuance. These depict amorous scenes in settings garlanded with luxuriant vegetation, real or imaginary: idealised dancers, women and shepherds are shown engaged in frivolous pursuits or exchanging confidences. -

Charlottenburg Palace Royal Prussia in Berlin
STIFTUNG PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN-BRANDENBURG Rudolf G. Scharmann Charlottenburg Palace Royal Prussia in Berlin Prestel Munich · Berlin · London · New York CONTENTS 3 Charlottenburg Palace: Prussian Splendour in Berlin 3 History and significance 4 Charlottenburg Palace: The Beginnings 4 From an electoral hunting lodge to a royal summer palace—Sophia Charlotte’s “Court of the Muses” 12 Charlottenburg Palace up to 1713 12 Baroque magnificence—the Old Palace as the country residence of King Frederick I 24 Charlottenburg Palace in the 18th Century 24 Prussian Rococo—the New Wing as the residence of Frederick the Great 33 An unused apartment for an unloved queen: Elizabeth Christine and Charlottenburg 35 Charlottenburg Palace in the Late 18th Century 35 Exotic worlds and early Prussian Neoclassicism—the apartments of King Frederick William II in the New Wing 40 The Belvedere and the Theatre 41 Charlottenburg Palace in the 19th Century 41 The royal family idyll— Frederick William III and Louisa at Charlottenburg 43 The Mausoleum and the New Pavilion 48 The life of a grand seigneur in the country—Frederick William IV and Queen Elizabeth at Charlottenburg 52 Imperial Charlottenburg from 1871 to 1918 54 The Court Silver Chamber 55 Charlottenburg Palace in the 20th Century 55 The end of Hohenzollern rule 55 The palaces under state management 55 War damage and post-war reconstruc- tion 57 Charlottenburg Palace Gardens 57 Baroque garden design, an “English” landscape garden, post-war restora- tion Charlottenburg Palace: Prussian Splendour in Berlin History and significance In spite of devastating damage during the Second World War and a lengthy period of reconstruction, Charlottenburg is today the largest former residence of the Hohenzollern dynasty in the German capital. -

Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser Und Gärten Berlin-Brandenburg
Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Band 7 2005 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver- folgt werden. Burkhardt Göres Schloss Charlottenburg – Geschichte des Wiederaufbaus und der Restaurierung in chronologischer Abfolge1 1943 In der Nacht vom 22. zum 23. November werden bei einem Bombenangriff auf Berlin Schloss und Park Charlottenburg von Brand- und Sprengbomben schwer getroffen. Der Neringbau des Alten Schlosses, der Mittelbau und die Osthälfte der Großen Orangerie, der größte Teil des Neuen Flügels bis auf wenige Räume am westlichen Ende, der Neue Pavillon und das Belvedere brennen aus. Das bewegliche Inventar war bereits zuvor größtenteils ausgelagert worden. 1945 Bei einem Bombenangriff auf Berlin am 20. Februar wird auch die bis dahin weniger be- schädigte Schlosskapelle bis auf die Außenmauern und geringe Reste der Dekoration zer- stört. Durch Beschuss bei der Besetzung Berlins entstehen weitere Schäden. Am 22. Juli stellt Stadtbaurat Hans Scharoun beim Magistrat von Berlin den Antrag auf Mit- tel für die Sicherung des Berliner und Charlottenburger Schlosses, der jedoch abgelehnt und auf den Weg begründeter Einzelanträge verwiesen wird. Ein konkreter Antrag vom 20. August wird ebenfalls vom Magistrat abgelehnt. -

Education Programs
Education Programs Bernardo Bellotto, The Zwinger Complex in Dresden (detail), 1751/52, oil on canvas. Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Photo: Elke Estel/Hans-Peter Klut TABLE OF CONTENTS Preparing Students in Advance p. 2 Pronunciation Guide pp. 3–4 About the Exhibition p. 5 The Magnificent Court at Dresden pp. 6–8 Canaletto and the Venetian Veduta pp. 9–11 Johann Alexander Thiele and the Panorama oF Dresden pp. 12–14 Bernardo Bellotto and the Marvels of Dresden pp. 15–17 Bernardo Bellotto’s Majestic Views of Pirna pp. 18–20 Bernardo Bellotto: A Timeline pp. 21–22 The Age of August II and August III: A Timeline pp. 23–24 Building Baroque Dresden: A Timeline pp. 25–26 1 PREPARING STUDENTS IN ADVANCE We look Forward to welcoming your school group to the Museum. Here are a Few suggestions For teachers to help to ensure a successFul, productive learning experience at the Museum. LOOK, DISCUSS, CREATE Use this resource to lead classroom discussions and related activities prior to the visit. (Suggested activities may also be used aFter the visit.) REVIEW MUSEUM GUIDELINES For students: • Touch the works of art only with your eyes, never with your hands. • Walk in the Museum—do not run. • Use a quiet voice when sharing your ideas. • No flash photography is permitted in special exhibitions or permanent collection galleries. • Write and draw only with pencils—no pens or markers, please. Additional inFormation For teachers: • Please review the bus parking inFormation provided with your tour conFirmation. • Backpacks, umbrellas, or other bulky items are not allowed in the galleries.