Kultur Von Allen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Shane Dedman, B. 1993
Shane Dedman, B. 1993 Filmmaker + Writer Education + PA Academy with Linda Burns, Atlanta, 2020 + Audit, Film 4750: Film Theory & Criticism, Daren Fowler, GSU, Atlanta, 2019 + Bachelors of Fine Arts in Photography, Georgia State University, Atlanta, 2016 Solo Exhibition + Fidgette: Watercolor Improvisations, Mammal Gallery, Atlanta, 2018 Select Group Exhibitions + Virtual Remains, Atlanta Biennial, Atlanta Contemporary, Atlanta, 2021 + I'm Looking Forward to Tomorrow, Good News Arts, High Springs, FL 2020 + Mass Hysteria, The Bakery, Atlanta, GA, 2018 + The Gathering curated by Iman Person, WonderRoot, Atlanta, 2018 + Radiopolis, Theater Kefalos, Argostoli, with Craig Dongoski, Kefalonia, Greece, 2017 + Got It For Cheap, Zero Zero LA, Atlanta Contemporary, Atlanta, 2017 + WonderRoots’ Imaginary Million, The Forum at Defoor, Atlanta, 2017 + Dear Atlanta... Artists for Liliana Bakhtiari, Big Tree Arts Atlanta, 2017 + Verde // Clutch, Midtown Player’s Club, Atlanta, 2017 + The Hambidge Center Auction, Colony Square, Atlanta, 2017 + You are Welcome, You're Welcome, Mint Gallery for Hambidge Hive, Atlanta, 2017 + The MANologues, BECOMING hu-MAN, Switchyards Downtown Club, Atlanta, 2017 + Burnaway’s Art Crush, Gallery 874, Atlanta, 2017 + Love and Death, Kibbee Gallery, Atlanta, 2017 + BFA Exiting Show, Fall 2016, Ernest G. Welch Gallery, Georgia State University, 2016 + Percolate, Facing Race Conference, WonderRoot, Atlanta, 2016 + Identity Crisis, Eyedrum Gallery, Atlanta, 2016 + SOUTH Annual Exhibition, Kibbee Gallery, Atlanta, 2016 + Becoming -

Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation “We’re Punk as Fuck and Fuck like Punks:”* Queer-Feminist Counter-Cultures, Punk Music and the Anti-Social Turn in Queer Theory Verfasserin Mag.a Phil. Maria Katharina Wiedlack angestrebter akademischer Grad Doktorin der Philosophie (Dr. Phil.) Wien, Jänner 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 343 Studienrichtung lt. Studienblatt: Anglistik und Amerikanistik Betreuerin / Betreuer: Univ. Prof.in Dr.in Astrid Fellner Earlier versions and parts of chapters One, Two, Three and Six have been published in the peer-reviewed online journal Transposition: the journal 3 (Musique et théorie queer) (2013), as well as in the anthologies Queering Paradigms III ed. by Liz Morrish and Kathleen O’Mara (2013); and Queering Paradigms II ed. by Mathew Ball and Burkard Scherer (2012); * The title “We’re punk as fuck and fuck like punks” is a line from the song Burn your Rainbow by the Canadian queer-feminist punk band the Skinjobs on their 2003 album with the same name (released by Agitprop Records). Content 1. Introduction .......................................................................................................... 1 2. “To Sir With Hate:” A Liminal History of Queer-Feminist Punk Rock ….………………………..…… 21 3. “We’re punk as fuck and fuck like punks:” Punk Rock, Queerness, and the Death Drive ………………………….………….. 69 4. “Challenge the System and Challenge Yourself:” Queer-Feminist Punk Rock’s Intersectional Politics and Anarchism……...……… 119 5. “There’s a Dyke in the Pit:” The Feminist Politics of Queer-Feminist Punk Rock……………..…………….. 157 6. “A Race Riot Did Happen!:” Queer Punks of Color Raising Their Voices ..……………..………… ………….. 207 7. “WE R LA FUCKEN RAZA SO DON’T EVEN FUCKEN DARE:” Anger, and the Politics of Jouissance ……….………………………….…………. -
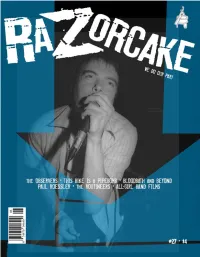
Read Razorcake Issue #27 As A
t’s never been easy. On average, I put sixty to seventy hours a Yesterday, some of us had helped our friend Chris move, and before we week into Razorcake. Basically, our crew does something that’s moved his stereo, we played the Rhythm Chicken’s new 7”. In the paus- IInot supposed to happen. Our budget is tiny. We operate out of a es between furious Chicken overtures, a guy yelled, “Hooray!” We had small apartment with half of the front room and a bedroom converted adopted our battle call. into a full-time office. We all work our asses off. In the past ten years, That evening, a couple bottles of whiskey later, after great sets by I’ve learned how to fix computers, how to set up networks, how to trou- Giant Haystacks and the Abi Yoyos, after one of our crew projectile bleshoot software. Not because I want to, but because we don’t have the vomited with deft precision and another crewmember suffered a poten- money to hire anybody to do it for us. The stinky underbelly of DIY is tially broken collarbone, This Is My Fist! took to the six-inch stage at finding out that you’ve got to master mundane and difficult things when The Poison Apple in L.A. We yelled and danced so much that stiff peo- you least want to. ple with sourpusses on their faces slunk to the back. We incited under- Co-founder Sean Carswell and I went on a weeklong tour with our aged hipster dancing. -

Zehn Jahre Ladyfest P Art Icipate 01.2012
KULTUR AKTIV GESTALTEN ISSUE 10 | Seite 1 Zehn Jahre Ladyfest p art icipate 01.2012 //Elke Zobl Zehn Jahre Ladyfest Kulturelle Produktion und rhizomatische Netzwerke junger Frauen Eine der interessantesten Transformationen in der Jugendkultur seit den 1990er Jahren ist die steigende Zahl an Jugendlichen, die als aktive kulturelle ProduzentInnen eine große Vielfalt an Filmen, Musik und Medien hervorbringen *( 2 ). Ein neues Phänomen in der weiblichen Jugendkultur ist das Wachstum von queer- feministischen Festivals, den so genannten Ladyfesten. Ladyfeste sind nicht- kommerzielle, kulturelle Festivals, die von und für junge Frauen organisiert werden, um ihren künstlerischen und politischen Arbeiten ein Forum zu bieten. In diesem Artikel argumentiere ich, dass die lokalen, transnationalen und virtuellen Ladyfest- Szenen einen fruchtbaren Ausgangspunkt bieten, um Einblick in die rhizomatischen Netzwerke kultureller Produktion von jungen Frauen zu gewinnen. Nach einer Netzwerk-Begriffsklärung und einer kurzen Beschreibung der Entwicklung der Ladyfeste analysiere ich diese Netzwerke und weise zum Schluss auf offene Fragen hin. In dem Artikel werden Ergebnisse des Forschungsprojektes “Young women as creators of new cultural spaces” (gefördert vom Fonds für wissenschaftliche Forschung Österreich, 2007–2011) präsentiert und diskutiert. Das Projekt – angesiedelt am Fachbereich Kommunikationswissenschaft sowie am Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst der Universität Salzburg – nahm transnationale Ladyfeste als Beispiel und Ausgangspunkt, um die kulturellen Praktiken junger Frauen zu untersuchen (s. www.grassrootsfeminism.net). Bildet Rhizome und keine Wurzeln, pflanzt nichts an! Sät nichts aus, sondern nehmt Ableger! Seid weder eins noch multipel, seid Mannigfaltigkeiten! Zieht Linien, setzt nie einen Punkt! Geschwindigkeit macht den Punkt zur Linie! Seid schnell, auch im Stillstand! Glückslinie, Hüftlinie, Fluchtlinie. Lasst den General in euch aufkommen! Ihr braucht keine richtigen Ideen zu haben, nur habt eine Idee (Godard). -

Personal Histories of the Second Wave of Feminism
Personal Histories of the Second Wave of Feminism summarised from interviews by Viv Honeybourne and Ilona Singer Volumes One and Two 1 Feminist Archive Oral History Project Foreword by the Oral History Project Workers Ilona Singer and Viv Honeybourne The Oral History Project has been a fantastic opportunity to explore feminist activism from the 1970's onwards from the unique perspectives of women who were involved. We each conducted ten in depth qualitative interviews which were recorded (the minidisks will be kept at the archive as vital pieces of history themselves) and written up as an oral history. We used the open-ended questions (listed as an appendix), so as to let the women speak for themselves and not to pre-suppose any particular type of answer. We tried to involve our interviewees as much as possible in every stage of the research process. Many interviewees chose to review and amend the final write-ups and we were happy to let them do this so that they could have control over how they wished to be represented. The use of a snowball sampling method and the fact that our interviewees were willing volunteers means that these histories (herstories) are not meant to be representative in a strictly scientific sense. Some women were more publicly active in the period than others, but all our of interviewees had important stories to tell and vital reflections on the period. The oral histories have been included in alphabetical order. They are of differing lengths because some women spoke for longer than others and we felt that to strive excessively to limit their words would be imposing an artificial limit on their account of their own lives . -

Download PDF > Riot Grrrl \\ 3Y8OTSVISUJF
LWSRQOQGSW3L / Book ~ Riot grrrl Riot grrrl Filesize: 8.18 MB Reviews Unquestionably, this is actually the very best work by any article writer. It usually does not price a lot of. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding. (Augustine Pfannerstill) DISCLAIMER | DMCA GOKP10TMWQNH / Kindle ~ Riot grrrl RIOT GRRRL To download Riot grrrl PDF, make sure you refer to the button under and download the document or gain access to other information which might be related to RIOT GRRRL book. Reference Series Books LLC Jan 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x189x10 mm. Neuware - Source: Wikipedia. Pages: 54. Chapters: Kill Rock Stars, Sleater-Kinney, Tobi Vail, Kathleen Hanna, Lucid Nation, Jessicka, Carrie Brownstein, Kids Love Lies, G. B. Jones, Sharon Cheslow, The Shondes, Jack O Jill, Not Bad for a Girl, Phranc, Bratmobile, Fih Column, Caroline Azar, Bikini Kill, Times Square, Jen Smith, Nomy Lamm, Huggy Bear, Karen Finley, Bidisha, Kaia Wilson, Emily's Sassy Lime, Mambo Taxi, The Yo-Yo Gang, Ladyfest, Bangs, Shopliing, Mecca Normal, Voodoo Queens, Sister George, Heavens to Betsy, Donna Dresch, Allison Wolfe, Billy Karren, Kathi Wilcox, Tattle Tale, Sta-Prest, All Women Are Bitches, Excuse 17, Pink Champagne, Rise Above: The Tribe 8 Documentary, Juliana Luecking, Lungleg, Rizzo, Tammy Rae Carland, The Frumpies, Lisa Rose Apramian, List of Riot Grrl bands, 36-C, Girl Germs, Cold Cold Hearts, Frightwig, Yer So Sweet, Direction, Viva Knievel. Excerpt: Riot grrrl was an underground feminist punk movement based in Washington, DC, Olympia, Washington, Portland, Oregon, and the greater Pacific Northwest which existed in the early to mid-1990s, and it is oen associated with third-wave feminism (it is sometimes seen as its starting point). -

Gender, Ethnicity, and Identity in Virtual
Virtual Pop: Gender, Ethnicity, and Identity in Virtual Bands and Vocaloid Alicia Stark Cardiff University School of Music 2018 Presented in partial fulfilment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Musicology TABLE OF CONTENTS ABSTRACT i DEDICATION iii ACKNOWLEDGEMENTS iv INTRODUCTION 7 EXISTING STUDIES OF VIRTUAL BANDS 9 RESEARCH QUESTIONS 13 METHODOLOGY 19 THESIS STRUCTURE 30 CHAPTER 1: ‘YOU’VE COME A LONG WAY, BABY:’ THE HISTORY AND TECHNOLOGIES OF VIRTUAL BANDS 36 CATEGORIES OF VIRTUAL BANDS 37 AN ANIMATED ANTHOLOGY – THE RISE IN POPULARITY OF ANIMATION 42 ALVIN AND THE CHIPMUNKS… 44 …AND THEIR SUCCESSORS 49 VIRTUAL BANDS FOR ALL AGES, AVAILABLE ON YOUR TV 54 VIRTUAL BANDS IN OTHER TYPES OF MEDIA 61 CREATING THE VOICE 69 REPRODUCING THE BODY 79 CONCLUSION 86 CHAPTER 2: ‘ALMOST UNREAL:’ TOWARDS A THEORETICAL FRAMEWORK FOR VIRTUAL BANDS 88 DEFINING REALITY AND VIRTUAL REALITY 89 APPLYING THEORIES OF ‘REALNESS’ TO VIRTUAL BANDS 98 UNDERSTANDING MULTIMEDIA 102 APPLYING THEORIES OF MULTIMEDIA TO VIRTUAL BANDS 110 THE VOICE IN VIRTUAL BANDS 114 AGENCY: TRANSFORMATION THROUGH TECHNOLOGY 120 CONCLUSION 133 CHAPTER 3: ‘INSIDE, OUTSIDE, UPSIDE DOWN:’ GENDER AND ETHNICITY IN VIRTUAL BANDS 135 GENDER 136 ETHNICITY 152 CASE STUDIES: DETHKLOK, JOSIE AND THE PUSSYCATS, STUDIO KILLERS 159 CONCLUSION 179 CHAPTER 4: ‘SPITTING OUT THE DEMONS:’ GORILLAZ’ CREATION STORY AND THE CONSTRUCTION OF AUTHENTICITY 181 ACADEMIC DISCOURSE ON GORILLAZ 187 MASCULINITY IN GORILLAZ 191 ETHNICITY IN GORILLAZ 200 GORILLAZ FANDOM 215 CONCLUSION 225 -

Whipping Girl
Table of Contents Title Page Dedication Introduction Trans Woman Manifesto PART 1 - Trans/Gender Theory Chapter 1 - Coming to Terms with Transgen- derism and Transsexuality Chapter 2 - Skirt Chasers: Why the Media Depicts the Trans Revolution in ... Trans Woman Archetypes in the Media The Fascination with “Feminization” The Media’s Transgender Gap Feminist Depictions of Trans Women Chapter 3 - Before and After: Class and Body Transformations 3/803 Chapter 4 - Boygasms and Girlgasms: A Frank Discussion About Hormones and ... Chapter 5 - Blind Spots: On Subconscious Sex and Gender Entitlement Chapter 6 - Intrinsic Inclinations: Explaining Gender and Sexual Diversity Reconciling Intrinsic Inclinations with Social Constructs Chapter 7 - Pathological Science: Debunking Sexological and Sociological Models ... Oppositional Sexism and Sex Reassignment Traditional Sexism and Effemimania Critiquing the Critics Moving Beyond Cissexist Models of Transsexuality Chapter 8 - Dismantling Cissexual Privilege Gendering Cissexual Assumption Cissexual Gender Entitlement The Myth of Cissexual Birth Privilege Trans-Facsimilation and Ungendering 4/803 Moving Beyond “Bio Boys” and “Gen- etic Girls” Third-Gendering and Third-Sexing Passing-Centrism Taking One’s Gender for Granted Distinguishing Between Transphobia and Cissexual Privilege Trans-Exclusion Trans-Objectification Trans-Mystification Trans-Interrogation Trans-Erasure Changing Gender Perception, Not Performance Chapter 9 - Ungendering in Art and Academia Capitalizing on Transsexuality and Intersexuality -

Contributors
CONTRIBUTORS Thomas Allen studied English and Philosophy at Newcastle University and at the University of Sussex. He is currently living in Berlin and pre- paring papers on Adorno’s aesthetics, as well as an extended thesis on the Frankfurt School and photography. Photographic attempts can be witnessed at http://www.tomallenphotography.net./ Email: t.callen1@ya- hoo.co.uk. Alexa Athelstan ([email protected]) is a University of Leeds Research Scholarship funded PhD student at the Centre for Interdisciplinary Gen- der Studies, supervised by Dr. Shirley Anne Tate and Professor Ian Law from the Centre for Ethnicity and Racism Studies. Her PhD research theorises queer, alternative and subversive modes of feminine embodi- ment and subjectivity in everyday life. Further research interests pertain to gender, feminist and queer theory, critical femininity studies, everyday experiences and representations of embodiment and identity, intersec- tional approaches to power and identity, visual methodologies, as well as discursive formations and daily practices of age and ageism. Alexa was one of the editors of the October 2011 GJSS special edition ‘Thriving on the Edge of Cuts: Inspirations and Innovations in Gender Studies’, GJSS Vol. 8 (2). Currently, Alexa Athelstan edits the Graduate Journal of Social Science in collaboration with Rosemary Deller (Manchester University). Email: [email protected] Gwendolyn Beetham received her PhD from the Gender Institute at the London School of Economics, where her work examined the reproduc- tion of gender stereotypes in international development programming. She currently lives in Brooklyn, New York, where she does consulting for gender justice organizations, edits the column The Academic Feminist at Feministing.com and participates in feminist, queer and food justice ac- tivism. -

'Race Riot' Within and Without 'The Grrrl One'; Ethnoracial Grrrl Zines
The ‘Race Riot’ Within and Without ‘The Grrrl One’; Ethnoracial Grrrl Zines’ Tactical Construction of Space by Addie Shrodes A thesis presented for the B. A. degree with Honors in The Department of English University of Michigan Winter 2012 © March 19, 2012 Addie Cherice Shrodes Acknowledgements I wrote this thesis because of the help of many insightful and inspiring people and professors I have had the pleasure of working with during the past three years. To begin, I am immensely indebted to my thesis adviser, Prof. Gillian White, firstly for her belief in my somewhat-strange project and her continuous encouragement throughout the process of research and writing. My thesis has benefitted enormously from her insightful ideas and analysis of language, poetry and gender, among countless other topics. I also thank Prof. White for her patient and persistent work in reading every page I produced. I am very grateful to Prof. Sara Blair for inspiring and encouraging my interest in literature from my first Introduction to Literature class through my exploration of countercultural productions and theories of space. As my first English professor at Michigan and continual consultant, Prof. Blair suggested that I apply to the Honors program three years ago, and I began English Honors and wrote this particular thesis in a large part because of her. I owe a great deal to Prof. Jennifer Wenzel’s careful and helpful critique of my thesis drafts. I also thank her for her encouragement and humor when the thesis cohort weathered its most chilling deadlines. I am thankful to Prof. Lucy Hartley, Prof. -

Abstract This Article Considers the Spatial Politics of Contemporary
Abstract This article considers the spatial politics of contemporary performance spaces constructed through DIY, improvised noise scenes. Noise (as something performed) is often categorized as “experimental,” “free,” or “avant garde.” It carries associations of emancipation, eschewing as it does conventional musical training, and the constraints of formal compositional and linguistic expression. Unfolding as a debate between the two authors, this article reflects on the contributions post-structural feminist theory brings to an understanding of where and how women practitioners negotiate noise-performance spaces. By considering noise as a conceptual object as well as noise as sonic performance, and by reflecting on debates around radical democracy, the authors debate the issue of female-only performance spaces and their implications on what we can express and how we might be understood. This contribution seeks to initiate further debate on the inherent complexities of how women create and negotiate spaces of noise performance in the face of normative assumptions and associations that have simplified the debate – for example, that the loud, discordant, and arrhythmic is obnoxious, dangerous, and historically a masculine domain. Keywords Free Improvisation, noise, spatial politics, gender, pre-figurative politics Susan: The following exchange considers the gender and spatial politics at work in the performance of experimental free improvised noise at DIY events in the UK and Europe. It takes the form of a conversation which took place over email from March to April 2013. I asked Marie if she would be prepared to write collaboratively with me because I thought it would help me clarify what I am doing as an improviser in sound and music. -

Rock 'N' Roll Camp for Girls and Feminist Quests for Equity, Community, and Cultural Production
Georgia State University ScholarWorks @ Georgia State University Institute for Women's, Gender, and Sexuality Women's, Gender, and Sexuality Studies Theses Studies 7-31-2006 I'm Not Loud Enough to be Heard: Rock 'n' Roll Camp for Girls and Feminist Quests for Equity, Community, and Cultural Production Stacey Lynn Singer Follow this and additional works at: https://scholarworks.gsu.edu/wsi_theses Part of the Feminist, Gender, and Sexuality Studies Commons Recommended Citation Singer, Stacey Lynn, "I'm Not Loud Enough to be Heard: Rock 'n' Roll Camp for Girls and Feminist Quests for Equity, Community, and Cultural Production." Thesis, Georgia State University, 2006. https://scholarworks.gsu.edu/wsi_theses/2 This Thesis is brought to you for free and open access by the Institute for Women's, Gender, and Sexuality Studies at ScholarWorks @ Georgia State University. It has been accepted for inclusion in Women's, Gender, and Sexuality Studies Theses by an authorized administrator of ScholarWorks @ Georgia State University. For more information, please contact [email protected]. I’M NOT LOUD ENOUGH TO BE HEARD: ROCK ‘N’ ROLL CAMP FOR GIRLS AND FEMINIST QUESTS FOR EQUITY, COMMUNITY, AND CULTURAL PRODUCTION By STACEY LYNN SINGER Under the Direction of Susan Talburt ABSTRACT Because of what I perceive to be important contributions to female youth empowerment and the construction of culture and community, I chose to conduct a qualitative case study that explores the methods utilized in the performance of Rock ‘n’ Roll Camp for Girls, as well as the experiences of camp administrators, participants, and volunteers, in order to identify feminist constructs, aims, and outcomes of Rock ‘n’ Roll Camp for Girls.