Männlichkeit Verhandeln. Von Lüstlingen, Kriegern Und Wahren
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Subjects of the Visual Arts: Hermaphrodites a Roman Copy of a Greek Sculpture of by Martin D
Subjects of the Visual Arts: Hermaphrodites A Roman copy of a Greek sculpture of by Martin D. Snyder Hermaphroditus (ca 200 C. E.). Encyclopedia Copyright © 2015, glbtq, Inc. This photograph appears under the the CeCILL Entry Copyright © 2002, glbtq, Inc. license and is attributed Reprinted from http://www.glbtq.com to Rama. In classical mythology, the nymph Salmacis loved the handsome but unresponsive Hermaphroditus, son of Hermes and Aphrodite. When he bathed in her spring, she forcibly embraced him. As Hermaphroditus struggled to free himself, Salmacis prayed that they never part. The gods granted her wish, and the two became a single being with both male and female sexual characteristics. (Ovid, Metamorphoses, 4.285 ff.) In ancient art Hermaphroditus, either specifically or as a generalized type, is a common subject. He is either nude or lifts his garment to expose his genitals; alternatively, a satyr, who mistakes him for a woman, assaults him. The most famous portrayal represents Hermaphroditus asleep, lying on his stomach, head turned to the side, and torso twisted just enough to reveal his breast and genitals. (National Museum of the Terme, Rome, and the Louvre, Paris.) Hermaphrodites disappear from post-classical art history until the Renaissance, when writers of alchemical treatises rediscovered them as non-erotic symbols for the union of opposites (a potent image for later Jungian psychology), and emblem books portrayed them as symbols of marriage. (For a modern interpretation, see Marc Chagall's Homage to Appollinaire, 1911.) The tale of Hermaphroditus and Salmacis was portrayed occasionally in Renaissance and Neoclassical art. Among the depictions are the following: Jan Gossaert [Jan de Mabuse], The Metamorphosis of Hermaphroditus and the Nymph Salmacis (1505), Bartholomaeus Spranger, Salmacis and Hermaphroditus (1581), Francesco Albani, Salmacis Falling in Love with Hermaphroditus (ca 1660) and Salmacis Kissing Hermaphroditus in the Water (1660), and François-Joseph Navez, The Nymph Salmacis and Hermaphroditus (1829). -

TRANSGENDER JEWS and HALAKHAH1 Rabbi Leonard A
TRANSGENDER JEWS AND HALAKHAH1 Rabbi Leonard A. Sharzer MD This teshuvah was adopted by the CJLS on June 7, 2017, by a vote of 11 in favor, 8 abstaining. Members voting in favor: Rabbis Aaron Alexander, Pamela Barmash, Elliot Dorff, Susan Grossman, Reuven Hammer, Jan Kaufman, Gail Labovitz, Amy Levin, Daniel Nevins, Avram Reisner, and Iscah Waldman. Members abstaining: Rabbis Noah Bickart, Baruch Frydman- Kohl, Joshua Heller, David Hoffman, Jeremy Kalmanofsky, Jonathan Lubliner, Micah Peltz, and Paul Plotkin. שאלות 1. What are the appropriate rituals for conversion to Judaism of transgender individuals? 2. What are the appropriate rituals for solemnizing a marriage in which one or both parties are transgender? 3. How is the marriage of a transgender person (which was entered into before transition) to be dissolved (after transition). 4. Are there any requirements for continuing a marriage entered into before transition after one of the partners transitions? 5. Are hormonal therapy and gender confirming surgery permissible for people with gender dysphoria? 6. Are trans men permitted to become pregnant? 7. How must healthcare professionals interact with transgender people? 8. Who should prepare the body of a transgender person for burial? 9. Are preoperative2 trans men obligated for tohorat ha-mishpahah? 10. Are preoperative trans women obligated for brit milah? 11. At what point in the process of transition is the person recognized as the new gender? 12. Is a ritual necessary to effect the transition of a trans person? The Committee on Jewish Law and Standards of the Rabbinical Assembly provides guidance in matters of halkhhah for the Conservative movement. -

The Transgender-Industrial Complex
The Transgender-Industrial Complex THE TRANSGENDER– INDUSTRIAL COMPLEX Scott Howard Antelope Hill Publishing Copyright © 2020 Scott Howard First printing 2020. All rights reserved. No part of this publication may be copied, besides select portions for quotation, without the consent of its author. Cover art by sswifty Edited by Margaret Bauer The author can be contacted at [email protected] Twitter: @HottScottHoward The publisher can be contacted at Antelopehillpublishing.com Paperback ISBN: 978-1-953730-41-1 ebook ISBN: 978-1-953730-42-8 “It’s the rush that the cockroaches get at the end of the world.” -Every Time I Die, “Ebolarama” Contents Introduction 1. All My Friends Are Going Trans 2. The Gaslight Anthem 3. Sex (Education) as a Weapon 4. Drag Me to Hell 5. The She-Male Gaze 6. What’s Love Got to Do With It? 7. Climate of Queer 8. Transforming Our World 9. Case Studies: Ireland and South Africa 10. Networks and Frameworks 11. Boas Constrictor 12. The Emperor’s New Penis 13. TERF Wars 14. Case Study: Cruel Britannia 15. Men Are From Mars, Women Have a Penis 16. Transgender, Inc. 17. Gross Domestic Products 18. Trans America: World Police 19. 50 Shades of Gay, Starring the United Nations Conclusion Appendix A Appendix B Appendix C Introduction “Men who get their periods are men. Men who get pregnant and give birth are men.” The official American Civil Liberties Union (ACLU) Twitter account November 19th, 2019 At this point, it is safe to say that we are through the looking glass. The volume at which all things “trans” -

Gender-Aspekte Bei Der Einführung Und Akkreditierung Gestufter Studiengänge: Eine Handreichung
www.ssoar.info Gender-Aspekte bei der Einführung und Akkreditierung gestufter Studiengänge: eine Handreichung Veröffentlichungsversion / Published Version Monographie / monograph Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: GESIS-IZ Sozialwissenschaften Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS). (2007). Gender- Aspekte bei der Einführung und Akkreditierung gestufter Studiengänge: eine Handreichung. (cews.publik, 9). Bonn. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-244219 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the above-stated vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder conditions of use. -

General Editors' Introduction
General Editors’ Introduction SUSAN STRYKER and PAISLEY CURRAH ince its inception, one of our primary goals for TSQ has been to make it a S journal that, within the constraints of being published in English at a US university press, is attentive to the transnational circulations of “transgender”— to the outright resistances to that term as well as to its adoption, dubbing, hybrid- ization, and strategic use, with all the complex negotiations of power and culture those crossings and roadblocks imply. How better to further the goal of putting pressure on the anglophone biases of the field of transgender studies than to explicitly explore the languages through which “transgender,” as an analytic lens or identitarian label, does and does not reproduce itself, how names and concepts change in the translation from one context to another, or how they remain incommensurable and untranslatable? (Of course, we recognize that this repli- cates at another level the very anglonormativity we seek to contest.) Much of the work collected here was first presented in rough form at “Translating Transgender,” an international scholarly workshop convened by translation studies scholar David Gramling, January 11–15, 2015, at the University of Arizona, with the explicit intent of including that work in a special issue of TSQ, to be coedited by Gramling and TSQ editorial board member Aniruddha Dutta. For those in attendance, the Tucson workshop was a truly remarkable intellectual and emotional experience, which one senior scholar characterized as “without a doubt the single most stimulating academic event I’ve ever partici- pated in.” We hope that some of that excitement shines through in the works from the workshop that ultimately were submitted and selected for publication, as well as the works submitted through the regular call for papers process. -

Intersex Conditions and Differences of Sex Development
Intersex conditions and differences of sex development: Theology, ethics, and care Author: Erik Lenhart Persistent link: http://hdl.handle.net/2345/bc-ir:105008 This work is posted on eScholarship@BC, Boston College University Libraries. Boston College Electronic Thesis or Dissertation, 2015 Copyright is held by the author, with all rights reserved, unless otherwise noted. Lenhart 1 Intersex Conditions and Differences of Sex Development: Theology, Ethics, and Care A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the S.T.L. Degree of Boston College School of Theology and Ministry by Erik Lenhart, OFM Cap. Director: Lisa Sowle-Cahill Reader: Andrea Vicini, S.J. Spring 2015 Lenhart 2 Table of Contents Thesis Abstract 3 Acknowledgements 4 Preface 5 Foreword: A Word on Words 7 Introduction: Fiction and Reality 10 Chapter 1: Defining Intersexuality 12 Chapter 2: History of Care and Classification 20 Chapter 3: Theories and Practice in the 21st Century 31 Chapter 4: Catholic Responses: Foundations of 39 Anthropology and Prudent Reflections on Intersex Chapter 5: Hearing Intersex Voices and 70 Promoting Flourishing and Vocation Conclusion: Variation in the Body of Christ 81 Bibliography 83 Lenhart 3 Abstract Intersex conditions (ICs) or disorders of sex development (DSDs) are biological variations that cause difficulties in determining whether a person is male or female at birth. In the 1950s, cosmetic surgery aimed to “normalize” the infant’s body became the standard of care when a child is born with an IC/DSD. Many adults who were operated on as infants, however, have begun to voice their dissatisfaction with the surgeries, which have caused tremendous long-term physical and emotional pain. -
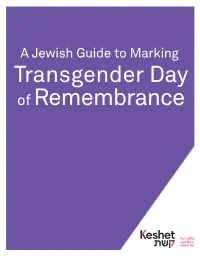
A Jewish Guide to Marking Transgender Day of Remembrance Contents Introduction
A Jewish Guide to Marking Transgender Day of Remembrance Contents Introduction .................................................................................................... 3 Readings for Services ...................................................................................... 4 I Am: Trans People Speak ............................................................................... 6 My Jewish Transgender Journey .................................................................. 8 Rabbinical Testimony in Support of the Massachusetts Transgender Equal Rights Bill .............................................13 Sermon ..........................................................................................................20 Text Study: Gender Diversity in Jewish Sacred Texts .................................23 Ways to Take Action in Your Community ....................................................33 it is our role as religious leaders to ensure that our “communities are places where everyone can embrace their whole selves and live up to their divine potential. — R. Joseph Berman ” keshet | 1 | www.keshetonline.org one of the most important teachings in the Jewish tradition “is that every human being is created b’tzelem elohim, “in God’s image,” which is interpreted to mean that every person must be treated with dignity and respect. unfortunately, transgender people have too often been the victims of blatant discrimination and of violence, their humanity and Godliness denied. And as a congregational rabbi, i have had congregants, -

Bechoros 042.Pub
כ"ד אייר תשע“ח Wednesday, May 29 2019 מ“ב בכורות OVERVIEW of the Daf Distinctive INSIGHT 1) Clarifying the dispute (cont.) A bechor which is a tumtum or androgynos אפילו תימא רבנן הואיל ואישתני אישתני -Rava finishes his unsuccessful challenge to R’ Chis da’s assertion that the dispute in the Mishnah is limited ambam writes (Hilchos Isurei Mizbe’ach 3:3) that an to an androgynos. R animal which is a tumtum or androgynos is considered to Numerous other unsuccessful challenges to R’ Chis- be an animal with a blemish. Rambam adds that these da’s position are presented. types of animals are not valid to be brought as offerings due It is suggested that R’ Chisda’s assertion is subject to to a more basic reason, and that is that they are neither a dispute between Tannaim. male nor female, so they are in a category by themselves, a This suggestion is rejected. type proscribed for an offering. Therefore, a bird which is a R’ Yochanan challenges R’ Ilai’s earlier ruling. tumtum or androgynos may also not be brought as an offer- R’ Yochanan’s objection is unsuccessfully challenged. ing, even though blemishes are not a disqualifying factor R’ Ila’i’s opinion is clarified. for birds. Lechem Mishnah points out that once Rambam writes 2) Tumtum that an animal’s very being a tumtum or androgynos de- R’ Oshaya challenges the position about determining fines it as being blemished, Rambam’s ruling in Hilchos whether a tumtum is considered a definite female. Bechoros (2:5) has to be understood. -

Geschlechtergerechte Akkreditierung Und Qualitätssicherung
GESCHLECHTERGERECHTE AKKREDITIERUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG – EINE HANDREICHUNG ANALYSEN, HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN & GENDER CURRICULA Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 14 GESCHLECHTERGERECHTE AKKREDITIERUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG – EINE HANDREICHUNG ANALYSEN, HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN & GENDER CURRICULA Dritte aktualisierte, überarbeitete und veränderte Auflage (2012) erarbeitet von: Meike Hilgemann, Beate Kortendiek und Anne Knauf, Essen 2012 Erste und zweite Auflage erarbeitet von: Ruth Becker, Bettina Jansen-Schulz, Beate Kortendiek und Gudrun Schäfer, Dortmund 2006 und 2007: Becker, Ruth/Jansen-Schulz, Bettina/Kortendiek, Beate/Schäfer, Gudrun (2006): Gender-Aspekte bei der Einführung und Akkreditierung gestufter Studiengänge – eine Handreichung. Studien Netzwerk Frauenforschung NRW Nr. 7. Dortmund 2., erweiterte Auflage 2007 als Cews.public.no 9. Impressum Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Koordinations- und Forschungsstelle Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Prof. Dr. Anne Schlüter Dr. Beate Kortendiek c/o Universität Duisburg-Essen Bildungswissenschaften Berliner Platz 6–8 45127 Essen Tel.: (0201) 183-6134 Fax: (0201) 183-2118 Lektorat: Dr. Mechthilde Vahsen Gestaltung: hassinger & hassinger & spiler Copyright Titelabbildung: Monika Ortmann Druck: WAZ Druck www.netzwerk-fgf.nrw.de ISBN: 978-3-936199-13-0 Essen, 2012 Vorwort Die geschlechtergerechte Gestaltung des Bologna-Prozesses und damit die geschlechtergerechte Aus- gestaltung der gestuften Studiengangsstruktur ist eine große -

Queer and Trans Analyses of Torah and Talmud
Torah and Talmud Flier for Kolot Chayeinu Class Announcement—2007 Gender Diversity in Aggada—Rabbi Elliot Kukla—2007 (used in Kolot class) Gender Diversity in Halacha-- Rabbi Elliot Kukla—2007 (used in Kolot class) Genesis of Gender—Joy Laden To Wear Is Human: Parshat Ki Teitze--Rabbi Elliot Kukla and Reuben Zellman, 2006 Curious About Judaism’s Take on Gender? The sages gave this some serious thought. Jewish sacred texts recognize six different categories for gender diversity. Now, it’s our turn to think and learn. “A Created Being of Its Own” A Seminar with Rabbi Elliot Kukla1 March 15, 22 and 29th at 7 P.M. At Kolot Chayeinu, 1012 8th Avenue, (between 10th & 11th Streets) Brooklyn Co-sponsored by Jews for Racial and Economic Justice The Kolot Chayeinu community needs knowledge to be a comfortable place for transgender, gender non- conforming and intersex people who participate (or might want to) in our congregation,. Develop a fuller understanding of gender and sex in Judaism, and get the information that will help us all be at ease. • Explore the spiritual implications of a broadened understanding of sex and gender in Judaism • Discover how Jewish sacred texts can help us create a community that has the knowledge to be truly welcoming of transgender, gender non-conforming and intersex people • Look at the theological implications of the texts for people of all genders The sessions on March 15th and 22nd are open to the public. March 29 is for Kolot members only. Kolot members are encouraged to join all three sessions. If that’s impossible, be there on March 29th (Kolot members only) for Trans “Tachchlis” (practicalities), aka “Trans 101.” We’ll also be developing practical action steps for the congregation. -

Julie Greenberg, Defining Male and Female: Intersexuality and The
+(,121/,1( Citation: 41 Ariz. L. Rev. 265 1999 Provided by: Sponsored By: Thomas Jefferson School of Law Content downloaded/printed from HeinOnline Tue Dec 13 13:31:41 2016 -- Your use of this HeinOnline PDF indicates your acceptance of HeinOnline's Terms and Conditions of the license agreement available at http://heinonline.org/HOL/License -- The search text of this PDF is generated from uncorrected OCR text. -- To obtain permission to use this article beyond the scope of your HeinOnline license, please use: Copyright Information DEFINING MALE AND FEMALE: INTERSEXUALITY AND THE COLLISION BETWEEN LAW AND BIOLOGY Julie A. Greenberg* Table of Contents I. INTRODUCTION ....................................................................................................... 266 1I. A BINARY SEX AND GENDER PARADIGM ............................................................... 270 A . Sex ....................................................................................................271 B . G ender ............................................................................................... 274 C. Binary Assumptions .......................................................................... 275 H. INTERSEXED MEDICAL CONDITIONS ..................................................................... 278 A. Sexual Differentiation-The Typical Path ........................................ 279 B. Sexual Differentiation-Intersexuals: The Paths Less Followed ...... 281 1. Ambiguity Within a Factor ........................................... 281 2. -

Queer Jews Studying Talmud
for separate-but-equal status; transgender half cannot be exempted, so must, for this persons argue that sex and gender are no moment, be equivalent to a man. The rabbis longer “real enough” categories to classify have opened a door. If half a body can humans. Everything a person does to be change gender without having the requisite Jewish is based on categories, then, that genitals, perhaps it is no great stretch to don’t work. change the gender (and not the sex) of a Mishnah Androgynos is a rabbinic text ad- whole body. For the hermaphrodite, gender dressing the exceptional case of a hermaph- is a “both, and” proposition. The hermaph- rodite human (a person with two complete rodite has a fuzzy dual gender that wobbles sets of genitals, one male and one female). around an always dual sex (continuous state) Androgynos prescribes a legal alternative to and at the same time a series of single-gen- the one-sex-one-gender binary system. In this ders within each narrow legal context (dis- alternative, an individual regularly appears in crete state). Today, wherein a gender binary the garb of one gender even though only half is competing with newer non-binary forms of of the individual’s body maps to that gender’s gender identification, a “two-state solution” norms. The hermaphrodite, then, is directly to gender seems like a responsible — and enabled by the community to function as a achievable — strategy. unique member. A similar adaptation might The deeper question raised by “trans- be useful in communities working to include gender” is this: Since a dual-to-many rela- transgender Jews.