Methodenhandbuch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Politique D'opposition À Déclaration En Moselle
PREFET DE LA MOSELLE POLITIQUE D’OPPOSITION A DECLARATION EN MOSELLE 1. OBJET L’article L. 214-3 du code de l’environnement permet au préfet de s’opposer dans un délai de deux mois à un projet d’installation, d’ouvrage, travaux ou d’activités (IOTA) soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette possibilité d’opposition a été introduite à la suite d’une ordonnance de juillet 2005. Le préfet ne peut s’opposer à ce type de projet que s’il est incompatible avec le SDAGE et les SAGE ou porte préjudice aux intérêts mentionnés à l’article L. 211–1 du code de l’environnement dans des conditions telles qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. L’opposition doit être motivée et justifiée eu égard à un impact résiduel inacceptable (c’est-à-dire qu’après avoir envisagé toutes les mesures correctives possibles) du futur projet sur la ressource ou le milieu. Cette politique d’opposition aux déclarations doit être approuvée par le préfet, elle est présentée pour information au conseil départemental des risques sanitaires et technologiques (CODERST). 2. HISTORIQUE Le Comité permanent de la MISE a engagé les premières réflexions sur la politique d’opposition lors de la réunion du 20 octobre 2006 à l’occasion de la présentation de la révision des décrets «procédure» et «nomenclature». Les réflexions se sont poursuivies dans le cadre des groupes de travail thématiques. Parallèlement, la DIREN a lancé au niveau régional avec le concours des MISE l’élaboration d’une plaquette destinée à informer les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre sur les motifs généraux d’opposition. -

Reitkonzept Biosphäre Bliesgau
TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG Berlin ▪ Hannover ▪ Eisenach REITTOURISTISCHE ENTWICKLUNG IN DER LEADER-REGION BIOSPHÄRENRESERVAT BLIESGAU Endbericht BTE Tourismus- und Regionalberatung Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Dieses Projekt wird im Rahmen des LEADER- www.bte-tourismus.de Programms der Region „Biosphärenreservat Bliesgau“ gefördert. Eisenach, September 2013 REITTOURISTISCHE ENTWICKLUNG IN DER LEADER-REGION BIOSPHÄRENRESERVAT BLIESGAU Endbericht Auftraggeber: Saarpfalz-Kreis Postfach 1550 66406 Homburg BTE Tourismus- und Regionalberatung Friedrichswerther Str. 12 D-99820 Behringen bei Eisenach Tel. +49 (0)36254–17494 Fax +49 (0)36254-856283 [email protected] www.bte-tourismus.de Eisenach, September 2013 Endbericht ENTWICKLUNG DES REITTOURISMUS IN DER LEADER REGION BSR BLIESGAU Inhalt 1 Einleitung ......................................................................................... 1 1.1 Aufgabenstellung und Projektziele ......................................................... 1 1.2 Projektgebiet ...................................................................................... 2 1.3 Vorgehensweise und Methodik .............................................................. 3 2 Rahmenbedingungen für das Reiten im Bliesgau .............................. 6 2.1 Bedeutung von Pferdesport und Reittourismus ........................................ 6 2.1.1 Bedeutung des Geländereitens ............................................................. -

Aktualisierung Der LAWA-Fließgewässertypen Im Saarland
Aktualisierung der LAWA-Fließgewässertypen im Saarland Inhaltsverzeichnis 1 Veranlassung ...................................................................................................................... 3 2 Begriffsbestimmungen ........................................................................................................ 4 3 Grundsätze der Umtypisierungen im Saarland .................................................................. 5 4 Typologie der saarländischen Oberflächenwasserkörper .................................................. 7 5 Referenzen ........................................................................................................................ 12 Anlage 1 Aktualisierung der LAWA-Fließgewässertypen im Saarland 2 Aktualisierung der LAWA-Fließgewässertypen im Saarland 1 Veranlassung Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (RL/2000/60/EG) wird in der Bundesrepublik Deutschland aktuell durch die Oberflächengewässerverordnung (OGewV) aus dem Jahre 2016 umgesetzt. Nach Anlage 1 der OGewV sind „die Oberflächenwasserkörper innerhalb einer Flussgebietseinheit [sind] nach Maßgabe der Nummer 1 in Kategorien einzuteilen und ihre Lage und Grenzen sind festzulegen. Sie sind in jeder Kategorie nach Maßgabe der Nummer 2 nach Typen zu unterscheiden.“ Die Ausweisung der Gewässertypen - in Deutschland etwa 25 plus Subtypen - geschieht durch die Länder1, die typspezifischen Referenzbedingungen werden in entsprechenden Steckbriefen der Gewässertypen beschrieben (aktuell: POTTGIESSER & SOMMERHÄUSER, 2008) und sind in den entsprechenden -

156 Field Artillery Battalion, Unit History United States Army
Bangor Public Library Bangor Community: Digital Commons@bpl World War Regimental Histories World War Collections 1946 156 Field Artillery Battalion, unit history United States Army Follow this and additional works at: http://digicom.bpl.lib.me.us/ww_reg_his Recommended Citation United States Army, "156 Field Artillery Battalion, unit history" (1946). World War Regimental Histories. 17. http://digicom.bpl.lib.me.us/ww_reg_his/17 This Book is brought to you for free and open access by the World War Collections at Bangor Community: Digital Commons@bpl. It has been accepted for inclusion in World War Regimental Histories by an authorized administrator of Bangor Community: Digital Commons@bpl. For more information, please contact [email protected]. TO THE MEN OF THE 71ST INFANTRY REGIMENT 1945 COPYRIGHT, 1946, BY !56TH FIELD ARTILLERY BATTALI ON Typography, engraYings and printing by Army & NaYy Publishing Company 234 Main Street Baton Rouge, Louisiana 2 156 3 Page 4 [blank] The generous efforts of these men have made this book possible. Authors . CPL. CLINTON w. MEHRING CPL. EARL K. GuLLEN CAPT. MALCOLM P. McNAIR, JR. CAPT. JoHN B. BRICKHOUSE T / SGT. EDWARD w. STEELE, JR. S / SGT. RussELL P. HALL CPL. EARL TRIBOU CAPT. MENTER G. BAKER, JR. M / S GT . RoBERT E. WALKER Art . .. SGT. ARNOLD c. BLACK Photos . .. M / SGT. RoBERT E. WALKER T I 4 RoBERT L. HoLT T I 4 HAROLD G. FRIDDELL cw I 0 EDWARD c. ALLEN CAPT. EDwARD H. DEws PFc. FRED w. ELLIS CPL. RoBERT E. HowARD U.S. ARMY SIGNAL CoRPS U.S. CoAsT GuARD Edited by . -
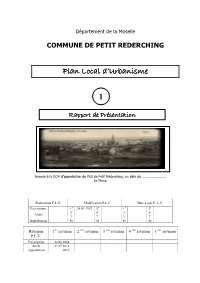
PR-PLU- Rapport Presentation 1
Département de la Moselle COMMUNE DE PETIT REDERCHING Plan Local d’Urbanisme 1 Rapport de Présentation Annexé à la DCM d’approbation du PLU de Petit Réderching, en date du ......................., Le Maire, Elaboration P.L.U. Modification P.L.U. Mise à jour P .L.U. Prescription 1e 24.01.1992 5e 1e 5e 2e 6e 2e 6e Arrêté 3e 7e 3e 7e Approbation 4e 8e 4e 8e Révision 1ère révision 2 ème révision 3 ème révision 4 ème révision 5 ème révision P.L.U. Prescription 24.06.2008 Arrêté 21.07.2011 Approbation .2012 SOMMAIRE Analyse de l’ancien P.O.S p.1 Le Plan Local d’Urbanisme p.2 ère 1 PARTIE : diagnostic territorial I. ANALYSE DE LA COMMUNE A. PRESENTATION DE LA COMMUNE p. 7 B. LES DONNEES SOCIO – ECONOMIQUES p. 9 1. LA POPULATION p. 9 1.1. Evolution générale de la population p.9 1.2. Evolution de la pyramide des âges p.9 1.3. Structure des ménages p.11 2. ACTIVITE p.13 2.1. Taux d’activité p.13 2.2. Caractéristique de la population active p.13 2.3. Population active et migratoire p.13 3. ANALYSE URBAINE p.14 3.1 La structure urbaine p.14 3.2 Le cadre bâti p.15 3.3 Les voies de communication p.16 4. LE LOGEMENT p.17 4.1. Evolution des logement par type de résidences p.17 4.2. L’âge du parc de logements p.18 4.3. Le confort du parc p.18 4.4. Le statut d’occupation p.18 4.5. -

La Situation Des Écrevisses En France
La situation des écrevisses en France Résultats de l’enquête nationale 2014 Rédacteurs : Marc COLLAS, Vincent BURGUN, Nicolas POULET, Caroline PENIL : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques Frédéric GRANDJEAN : Laboratoire Ecologie et Biologie des Interactions – UMR CNRS 7267 Equipe Ecologie Evolution Symbiose 2015 Avec la participation technique des Services départementaux de l’Onema et des référents régionaux en Délégation régionale Photo de couverture : L'Écrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) Crédit photo : Marc Collas 1 2 Table des matières RESUME 4 INTRODUCTION 5 1-1) L'enquête nationale en 2014 6 1-2) Contributions extérieures 6 1-3) Evolution de l'enquête 6 2) RESULTATS 7 2-1) Situation des espèces autochtones : 7 2-1-1) L’Écrevisse à pattes blanches - Austropotamobius pallipes (Lereboulllet, 1858) 7 2-1-2) L’Écrevisse à pattes rouges - Astacus astacus (Linnaeus, 1758) 9 2-1-3) L’Écrevisse des torrents - Austropotamobius torrentium (Schranck, 1803) 11 2-2) Situation des espèces exotiques introduites 12 2-2-1) L’Écrevisse américaine - Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) 12 2-2-2) L’Écrevisse à pattes grêles - Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) 14 2-2-3) L’Écrevisse du Pacifique - Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) 15 2-2-4) L’Écrevisse rouge de Louisiane - Procambarus clarkii (Girard, 1852) 16 2-2-5) L'Écrevisse juvénile - Orconectes Juvenilis (Hagen, 1870) 19 2-2-6) L'Écrevisse calicot - Orconectes immunis (Hagen, 1870) 20 3) DISCUSSION - CONCLUSION 22 Bibliographie 27 3 RESUME Dans la continuité des enquêtes réalisées depuis 1977 sur la répartition des écrevisses en France, l’Onema a réalisé en 2014 une nouvelle enquête, la dernière ayant eu lieu en 2006. -
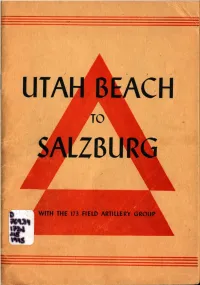
Scanned Using Book Scancenter 5033
V / t) RettwA Center Wltewisin Velerant Meneni 80 W-MHIIte Street MeAten,Witeonsin 53703 Pli:(i0l) 257.1790 .UJb «■ UTAH BEACH TO SALZBURG WITH THE 173 FIELD ARTILLERY GROUP . 4 €Ct ’ fik'f-*’'** .f^5:''tj|| ‘ '-• ' 1"^ )S i'. '•■!) .f 1 / / FOREWORD The wreckage of German armies left behind the sweeping battles along the route: AVRANCHES — LEVAL — EE MANS ALENCON — ARGENT AN; thence to DREUX — MANTES — GASSICOURT — and the Seine; then later JOINVILLE — NEUE- CHATEAU — CHARMES — LUNEVILLE; again, later, SARRE- BOURG — BITCHE — GROS-REDERCHING (with STRAS BOURG as a lateral operation); again, later, HOMBURG — ZWEIBRUCKEN — RAISERLAUTEN; and finally, WORMS — the Rhine - MANNHEIM - ASCHAEFENBURG - BAM- ' BURG — NURNBERG — the Danube — MUNICH — SALZ BURG. BERCHTESGADEN is a wreckage attesting to the superiority of the American in producing effective weapons and equipment, in planning effective coordination of means in battle, and in handling and operating these weapons and this equipment with intelligence. The 173rd Field Artillery Group contributed its full share in that great sweep from Normandy through France and Germany into Austria. By its active participation in four campaigns of World War II this unit helped to create one of the greatest victories in military history. It helped crush and destroy the once proud Wehrmacht as no modern army had ever been crushed and destroyed. Under the leader ship of its able Commander. Colonel Wilbur S. Nye, the 173rd Field Artillery Group contributed in large measure to the continued amazing victories of the American XV^ Corps. Toward the end the German superman looked third rate; the master race had been mastered! This accomplishment will go down in history in bold print a tribute to American bravery, ingenuity, skill, and fortitude. -

Die FFH-Libellenarten Im Saarland (Insecta: Odonata)
Abh. DELATTINIA 40: 77 - 136 –— Saarbrücken 2014 ISSN 0948-6526 Die FFH-Libellenarten im Saarland (Insecta: Odonata) Bernd Trockur & Uwe Lingenfelder Kurzfassung: Im Saarland kommen vier Libellenarten mit einem Schutzstatus gemäß Anhang II und/ oder IV der FFH-Richtlinie vor. Basierend auf neuen Daten der Jahre 2012 bis 2014 wird jeweils ein Überblick zur Verbreitung und zur Bestandssituation erstellt und es werden Veränderungen und Beein- trächtigungen bei den Arten bzw. deren Vorkommen diskutiert. Die Situation der Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) ist kritisch. Aktuell sind nur drei Vor- kommen mit geringen Individuenzahlen bekannt. Die beiden Populationen an Gräben in der Bliesaue sind durch intensive Nutzung und unsachgemäß durchgeführte Plege anhaltend bedroht. Die dritte -Po pulation der Art bei Heinitz erscheint stabil, ist aber in ihrem Herzstück ebenfalls von richtiger Plege abhängig und damit indirekt und latent bedroht. Die Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) kommt vor allem im südöstlichen Saarland vor und zeigt eine deutlich positive Bestandsentwicklung. Das wichtigste Fundgewässer ist die Blies, an der mittlerweile eine stabile Population vorkommt. Die Situation bzw. der Status an anderen aktuellen bzw. früheren Fundstellen ist nicht völlig geklärt oder unklar. Bei der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) ist in den letzten Jahren ein mehr oder weni- ger stetiger Anstieg der Fundstellen zu beobachten und damit insgesamt eine positive Bestandsentwick- lung zu vermerken. Die Art besitzt bei Heinitz ein stabiles Vorkommen mit zunehmender Abundanz. Alle anderen Vorkommen im Saarland zeigen dagegen unsichere Bestandsverhältnisse. An einzelnen Fundorten sind sogar negative Entwicklungen festzustellen. Die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) wurde im Saarland erst zweimal nachgewiesen. Ihr Status ist hier unklar. Maßnahmen zum Erhalt, Schutz und/oder zur Förderung der Arten sind bei Coenagrion mercuriale derzeit absolut notwendig, bei Leucorrhinia caudalis zumindest an einigen Fundorten sinnvoll. -

Pelouses À Obergailbach
Date d'édition : 24/09/2021 Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100168 NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC) FR4100168 - Pelouses à Obergailbach 1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1 2. LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. 2 3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3 4. DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................... 5 5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ........................................................................................... 7 6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 8 1. IDENTIFICATION DU SITE 1.1 Type 1.2 Code du site 1.3 Appellation du site B (pSIC/SIC/ZSC) FR4100168 Pelouses à Obergailbach 1.4 Date de compilation 1.5 Date d’actualisation 30/11/1995 30/09/2005 1.6 Responsables Responsable technique Responsable national et européen Responsable du site et scientifique national Ministère en charge -

Plan D'actions Operationnel Territorialise (Paot) 2016
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse au titre de la Directive Cadre sur l’Eau Déclinaison du programme de mesures du district hydrographique Rhin PLAN D’ ACTIONS OPERATIONNEL TERRITORIALISE (PAOT) 2016-2018 de la Moselle SOMMAIRE 1) CONTEXTE ET ENJEUX : LA POLITIQUE DE L’EAU………………………...….page 3 2) ETAT DES LIEUX DES MASSES D’EAU EN MOSELLE………..………...……..page 8 3) ACTIONS DU PAOT 2016-2018 31) Volet hydromorphologie…………………………………………...…..page 10 32) Volet assainissement……………………………………………...…...page 18 33) Volet captages……………………………………………………….…..page 33 34) Volet industriel et artisanal : rejets connus et supposés……......page 38 PAOT 2016-2018 PAR BASSIN ELEMENTAIRE……………………………..….page 48 - Bassin Ferrifère-Rhin…………………………………………………………….…..page 49 -Bassin Houiller………………………………………………………………………...page 51 -Bassin Métropole Lorraine……………………………………………………….….page 53 -Bassin MODER………………………………………………………………………....page 56 -Bassin Nieds………………………………………………………………………..….page 57 -Bassin Pays de Bitche …………………………………………………………...….page 60 -Bassin Sarre ……………………………………………………………………...…...page 62 - Bassin Seille…………………………………………………………………………...page 66 -Bassin Vezouze Sanon………………………………………………………...…….page 68 -Bassin Zorn Landgraben………………………………………………………..…...page 69 PAOT MOSELLE 2016-2018 2 Ainsi, avec les SDAGE et les objectifs environnementaux qu’ils contiennent, le Comité de bassin affiche ses ambitions et les PDM associés listent quant à eux les mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés collégialement avec les acteurs de la gestion de l’eau (collectivités territoriales, acteurs économiques, monde associatif, services de l’État) pour répondre aux enjeux de non dégradation des ressources en eau et de reconquête du bon état des eaux. Pour le bassin Rhin-Meuse, l’ambition du SDAGE 2016-2021 est d’atteindre, à l’horizon 2021 : - 44% des rivières du bassin en bon état écologique - 80% des nappes souterraines en bon état chimique. -

Espaces Naturels De Lorraine, De Naturels D’Espaces Conservatoire Du Amis Chers Et Amies Chères Sites Dépt
www.cen-lorraine.fr > Lorraine CEN du RAPPORT MORAL – 2017 – MORAL RAPPORT RAPPORT D'ACTIVITÉS – 2017 – D'ACTIVITÉS RAPPORT d’eau (printemps 2019). (printemps d’eau le Rapport d'activités complet est consultable sur le site internet internet site le sur consultable est complet d'activités Rapport le : l’entretien de la ripisylve du ruisseau (automne 2018) et l’effacement d’un plan plan d’un l’effacement et 2018) (automne ruisseau du ripisylve la de l’entretien : connexes deux opérations opérations en deux consister vont restauration de travaux Les l’année. de long au tout mené Afin de mener au mieux la restauration du ruisseau Gailbach, un état initial écologique a été été a écologique initial état un Gailbach, ruisseau du restauration la mieux au mener de Afin » à Obergailbach (57) Obergailbach à » Gailbach Ruisseau « du Étude d’actions mares - PRAM (cf. Bulletin n°73). Bulletin (cf. PRAM - mares d’actions du bassin n°3 afin de favoriser le développement d’une roselière d’environ 4 hectares. 4 d’environ roselière d’une développement le favoriser de afin n°3 bassin du letin n°72), et depuis 2016 le Plan régional régional Plan le 2016 depuis et n°72), letin Les travaux ont été engagés en décembre 2017. Ils vont permettre la baisse du niveau global global niveau du baisse la permettre vont Ils 2017. décembre en engagés été ont travaux Les - Bul (cf. étoilé Butor Odonates, et Maculinea Conservatoire anime les PRA : Amphibiens, Amphibiens, : PRA les anime Conservatoire Travaux de réfection des ouvrages de l’étang du Moulin à Insviller (57) Insviller à Moulin du l’étang de ouvrages des réfection de Travaux placer dans une configuration Grand Est. -

Pelouses À Obergailbach Superficie :153 Ha Département : Moselle Maître D’Ouvrage : Commune D’Obergailbach Opérateur : CSL
1 La pelouse dominant le vallon d’Obergailbach © FRANÇOIS SCHWAAB 2 L’Orchis grenouille, orchidée présente sur les pelouses marneuses © FRANÇOIS SCHWAAB 1 2 294 Les milieux ouverts FR4100168 Pelouses à Obergailbach Superficie :153 ha Département : Moselle Maître d’ouvrage : Commune d’Obergailbach Opérateur : CSL Les menaces pesant sur les prairies et les pelouses d’intérêt communautaire sont la déprise avec la colonisation arbustive et la fermeture* du milieu, ou à l’inverse, l’intensification agricole avec les amendements, les fauches précoces et le surpâturage. La biodiversité dans le ruisseau est très fortement impactée par Où les orchidées ne connaissent pas les frontières les piétinements bovins, la dégradation de la qualité physico-chimique des eaux et Installé sur la Côte de Lorraine, le site « Pelouses à Obergailbach» appartient au domaine collinéen* de ses conditions d’écoulement, ou encore avec une altitude comprise entre 275 et 380 m. Ce coteau calcaire et prairial* se déploie sur la côte l’introduction d’espèces exogènes*. formée des calcaires du Muschelkalk et est bordé au Sud par le ruisseau du Gailbach. Nommé « le Pour la conservation de ce superbe site, il est Grundwiese », ce coteau est orienté plein sud et couvre 153 ha ; le village d’Obergailbach est situé en indispensable de favoriser l’extensification contrebas dans le vallon. des pratiques agricoles. Dans ce cadre, Le site présente un gradient thermique et hydrique marqué : le sommet du coteau propose un faciès* des Mesures Agro-environnementales* de pelouse calcicole* (Habitat prioritaire 6210) plus thermophile*, prolongé par une pelouse marneuse Territorialisées ont été proposés en 2008 à Molinie bleue, et sa partie basse se décline en prairie mésotrophe* à Colchiques (Habitat 6510).