Kapitel 1 Glanz Und Elend Eines Weltkonzerns
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Porsche in Le Mans
Press Information Meet the Heroes of Le Mans Mission 2014. Our Return. Porsche at Le Mans Meet the Heroes of Le Mans • Porsche and the 24 Hours of Le Mans 1 Porsche and the 24 Hours of Le Mans Porsche in the starting line-up for 63 years The 24 Hours of Le Mans is the most famous endurance race in the world. The post-war story of the 24 Heures du Mans begins in the year 1949. And already in 1951 – the pro - duction of the first sports cars in Stuttgart-Zuffenhausen commenced in March the previous year – a small delegation from Porsche KG tackles the high-speed circuit 200 kilometres west of Paris in the Sarthe department. Class victory right at the outset for the 356 SL Aluminium Coupé marks the beginning of one of the most illustrious legends in motor racing: Porsche and Le Mans. Race cars from Porsche have contested Le Mans every year since 1951. The reward for this incredible stamina (Porsche is the only marque to have competed for 63 years without a break) is a raft of records, including 16 overall wins and 102 class victories to 2013. The sporting competition and success at the top echelon of racing in one of the world’s most famous arenas is as much a part of Porsche as the number combination 911. After a number of class wins in the early fifties with the 550, the first time on the podium in the overall classification came in 1958 with the 718 RSK clinching third place. -

Sustainability Report 2015 About This Report
Sustainability Report 2015 About this Report Content and Period Covered by the Report (G4-23) Porsche has prepared this Sustainability Report to provide information about its key activities in the areas of “Business and Customers,” “Product Responsibility,” “Environment and Energy,” and “Employees and Community.” The report also explains how sustainability is strategically embedded in, and managed by, the company. Objectives and actions have been set out in a Sustainability Program. Relevant facts and figures have been summarized at the end of the hard copy of the report and are available in detail on the Sustainability microsite (newsroom.porsche.com/en/sustainability). Various reporting and processing systems within the company were used to collect and capture the data, which was then consolidated and reviewed to enhance its reliability. The Porsche Sustainability Report 2015 refers to the period from January 1, 2014 through December 31, 2015. In the interests of providing a complete picture, the report also contains information about material activities performed prior to this period. All data is valid as of December 31, 2015. Editing of the report was finalized in April 2016. Unless otherwise indicated, all information relates to Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG and Porsche Leipzig GmbH. Reporting Standard The Porsche Sustainability Report 2015 was prepared in accordance with the guidelines issued by the Global Reporting Initiative (GRI G4) using the “Core” option. The GRI Content Index details the level of completion of the Global Reporting Initiative indicators and their location in this Sustainability Report and on the Sustainability microsite. External Audit The materiality analysis, selected management approaches, and some of the key figures addressed in the Sustainability Report and included on the Sustainability microsite have been subjected to an audit review by PricewaterhouseCoopers. -

The Porsche Type List
The Porsche Type List When Professor Ferdinand Porsche started his business, the company established a numeric record of projects known as the Type List. As has been reported many times in the past, the list began with Type 7 so that Wanderer-Werke AG did not realize they were the company’s first customer. Of course, as a result, Porsche’s famous car, the 356 as defined on the Type List, was actually Porsche’s 350th design project. In reviewing the Porsche Type List enclosed on this website, you might notice several interesting aspects. First, although there is a strong chronological alignment of Type numbers, it is certainly not perfect. No official explanation exists as to why this occurs. It is possible that Type numbers were originally treated only as an informal configuration and data management tool and today’s rigorous examination of Porsche history is but an aberration of 20/20 hindsight. Secondly, you might also notice that there were variations on Type List numbers that were probably made rather spontaneously. For example, consider the Type 60 with its many “K” variations to designate different body styles. Also consider how the Type 356 was initially a tube frame chassis then changed to a sheet metal chassis with the annotation 356/2 but the /2 later reused to describe different body/engine offerings. Then there were the variants on the 356 annotated as 356 SL, 356A, 356B, and 356C designations and in parallel there were the 356 T1 through 356 T7 designations. Not to mention, of course, the trademark infringement threat that caused the Type 901 to be externally re-designated as the 911. -

ADAC Qualifikationsrennen 24H-Rennen ADAC Nordrhein E.V., Sportabteilung, 50963 Köln
ADAC Qualifikationsrennen 24h-Rennen ADAC Nordrhein e.V., Sportabteilung, 50963 Köln ADAC Qualifikationsrennen 24h-Rennen Reg-No.: R-12213/21 8th to 9th May 2021 Nürburgring, 25378 m Provisional Result Race Started: 83 Classified: 58 Not Classified: 25 Not Started: 0 Pos. No. Cl. Entrant, Licence | Sponsor, Licence Car Laps Total time Fastest Lap in Driver, City, Nation, Licence Intervall GAP Average total Lap 131SP 9 E: Frikadelli Racing Team, BIF1140533 Porsche 911 GT3 R 41 6:04:28.579 8:18.759 7 Pilet Patrick, Noisy le Roi, FRA, 54892 171.287 kph Makowiecki Frederic, Montpellier, FRA, 53130 Martin Maxime, Tervuren, BEL, 901749 Olsen Dennis, Valer I Ostfold, NOR, IRAC33349 230SP 9 E: Frikadelli Racing Team, BIF1140533 Porsche GT3 R, MJK 41 6:05:35.694 8:20.952 24 Jaminet Mathieu, Schifflange, LUX, 219550 1:07.115 +1:07.115 170.762 kph Tandy Nick, Bedford, GBR, UK160875 Bamber Earl, Jalan Kiara 3 Mont Kiara, MYS, 051713X Campell Matt, Stuttgart, DEU, 1090587 311SP 9 E: Phoenix Racing, BIF1066469 Audi R8 LMS GT3 41 6:05:37.193 8:21.088 8 Beretta Michele, Ello, ITA, IC 347027 1:08.614 +01.499 170.751 kph Stippler Frank, Bad Münstereifel, DEU, IB1039089 Thiim Nicki, Anif, AUT, 2368 Kolb Vincent, Frankfurt, DEU, IC1138981 47SP 9 E: Mercedes-AMG Team GetSpeed, BIF1157349 Mercedes-AMG GT3 41 6:05:44.819 8:18.884 37 Götz Maximilian, Uffenheim, DEU, IB1045239 1:16.240 +07.626 170.691 kph Juncadella Daniel, Dublin, IRL, IA-0023-ESP Schiller Fabian, Troisdorf, DEU, IC1127224 544SP 9 E: Falken Motorsports, BIF1088091 Porsche AG 911 GT3 R (991 II) -

Separate Financial Statements Fiscal Year 2019
201Separate financial9 statements PPorscheorsche TaycanTaycan TurboTurbo S 3 Content Group management report and management report of Porsche Automobil Holding SE 6 Fundamental information about the group 10 Report on economic position 12 Significant events and developments at the Porsche SE Group 12 Significant events and developments at the Volkswagen Group 20 Business development 24 Results of operations, financial position and net assets 31 Porsche Automobil Holding SE (financial statements pursuant to the German Commercial Code) 37 Sustainable value enhancement in the Porsche SE Group 41 Overall statement on the economic situation of Porsche SE and the Porsche SE Group 43 Remuneration report 44 Opportunities and risks of future development 52 Publication of the declaration of compliance and corporate governance report 78 Subsequent events 79 Forecast report and outlook 80 Glossary 85 4 Financials 86 Balance sheet of Porsche Automobil Holding SE 90 Income statement of Porsche Automobil Holding SE 91 Notes to the consolidated fi nancial statements 92 Independent auditor’s report 212 Responsibility statement 220 5 VVolkswagenolkswagen IID.3D.3 6 1 Group management report and management report of Porsche Automobil Holding SE 7 8 Group management report and management report of Porsche Automobil Holding SE 6 Fundamental information about the group 10 Report on economic position 12 Significant events and developments at the Porsche SE Group 12 Significant events and developments at the Volkswagen Group 20 Business development 24 Results -

Download PDF, 19 Pages, 505.25 KB
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT Shareholdings of Volkswagen AG and the Volkswagen Group in accordance with sections 285 and 313 of the HGB and presentation of the companies included in Volkswagen's consolidated financial statements in accordance with IFRS 12 as of 31.12.2019 Exchange rate VW AG 's interest Equity Profit/loss (1€ =) in capital in % in thousands, in thousands, Name and domicile of company Currency Dec. 31, 2019 Direct Indirect Total local currency local currency Footnote Year I. PARENT COMPANY VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg II. SUBSIDIARIES A. Consolidated companies 1. Germany ASB Autohaus Berlin GmbH, Berlin EUR - 100.00 100.00 16,272 1,415 2018 AUDI AG, Ingolstadt EUR 99.64 - 99.64 13,701,699 - 1) 2019 Audi Berlin GmbH, Berlin EUR - 100.00 100.00 9,971 - 1) 2018 Audi Electronics Venture GmbH, Gaimersheim EUR - 100.00 100.00 60,968 - 1) 2019 Audi Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main EUR - 100.00 100.00 8,477 - 1) 2018 Audi Hamburg GmbH, Hamburg EUR - 100.00 100.00 13,425 - 1) 2018 Audi Hannover GmbH, Hanover EUR - 100.00 100.00 16,621 - 1) 2018 AUDI Immobilien GmbH & Co. KG, Ingolstadt EUR - 100.00 100.00 82,470 3,399 2019 AUDI Immobilien Verwaltung GmbH, Ingolstadt EUR - 100.00 100.00 114,355 1,553 2019 Audi Leipzig GmbH, Leipzig EUR - 100.00 100.00 9,525 - 1) 2018 Audi München GmbH, Munich EUR - 100.00 100.00 270 - 1) 2018 Audi Real Estate GmbH, Ingolstadt EUR - 100.00 100.00 9,859 4,073 2019 Audi Sport GmbH, Neckarsulm EUR - 100.00 100.00 100 - 1) 2019 Audi Stuttgart GmbH, Stuttgart EUR - 100.00 100.00 6,677 - 1) 2018 Auto & Service PIA GmbH, Munich EUR - 100.00 100.00 19,895 - 1) 2018 Autonomous Intelligent Driving GmbH, Munich EUR - 100.00 100.00 250 - 1) 2018 Autostadt GmbH, Wolfsburg EUR 100.00 - 100.00 50 - 1) 2018 B. -
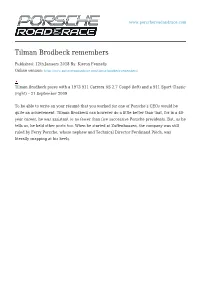
Tilman Brodbeck Remembers
www.porscheroadandrace.com Tilman Brodbeck remembers Published: 12th January 2018 By: Kieron Fennelly Online version: https://www.porscheroadandrace.com/tilman-brodbeck-remembers/ Tilman Brodbeck poses with a 1973 911 Carrera RS 2.7 Coupé (left) and a 911 Sport Classic (right) – 21 September 2009 To be able to write on your résumé that you worked for one of Porsche’s CEOs would be quite an achievement. Tilman Brodbeck can however do a little better than that, for in a 40- year career, he was assistant to no fewer than five successive Porsche presidents. But, as he tells us, he held other posts too. When he started at Zuffenhausen, the company was still ruled by Ferry Porsche, whose nephew and Technical Director Ferdinand Piëch, was literally snapping at his heels. www.porscheroadandrace.com Ferry Porsche www.porscheroadandrace.com Unlike many of his contemporaries who went to Stuttgart University to complete their education, Tilman Brodbeck went further afield, to Darmstadt 100 miles to the north, for his engineering studies: “I wanted to get away from home,” he smiles revealing the slightly nonconformist streak that runs through much of his thinking. His speciality at Darmstadt was in airflow techniques, a subject then very little developed. Tilman’s background meant that after he joined Porsche he was promoted to body project engineer. “One of my tasks was on the 924 (Porsche’s first front engined model) where getting sufficient cooling air to the engine was quite a challenge within the overall shape we wanted for the car.” Prior to this though and before even being assigned a title, Brodbeck had had to prove himself: he was handed the daunting responsibility of resolving the 911’s tendency to lift its front end at high speed. -

The Weissach-Dossier Michael Mauer’S Style Is Making Its Mark on the Contours of Twenty-First-Century Porsches
newsroom Scene and Passion Mar 28, 2016 The Weissach-Dossier Michael Mauer’s style is making its mark on the contours of twenty-first-century Porsches. Switzerland is the wellspring of his creativity. A conversation with the Head of the Style Porsche, surrounded by mountain peaks. This is a wondrous place. The sky is a deep blue, the sun skips across the reflection of the lake. Surrounded by the fjord-like craggy cliffs rising more than 1,000 meters skyward, this Swiss mountain lake imparts the essence of serenity. The area is familiar to winter-sports enthusiasts as a bottleneck en route from Zurich to Davos, Arosa, or the Engadine. Only a few travelers have discovered the treasures to be found in the shadow of the autobahn that winds its way along the azure lake on narrow avalanche protectors and through the tunnel: tranquil spots with small coves and even sandy beaches. More sensitive souls might consider the steep mountain massif to be rather oppressive. But this is where Michael Mauer, a passionate sportsman, has found his oasis of tranquility. “One designer may get his inspiration from art, another may go on city breaks and fly to London every Friday after work,” he explains over coffee on the top floor of his home in a former factory, complete with a view of the lake and the mountains. “I see how we’re constantly being bombarded with information, which is why we have to give our minds more and more time to process all of this information. Whenever I’m here on the weekend and go skiing, ride my bike, hike, or simply sit on the deck for a couple of hours without thinking about anything particularly lofty, my subconscious uses this time to sort out information from the week just gone by, to process it, and to find solutions.” Mauer views his profession as a dream come true As Porsche’s chief designer, Michael Mauer is in no danger of running out of complex design issues demanding solutions. -

Press Release May 2, 2012 No
Press release May 2, 2012 No. 57/12 Former Porsche chief designer dies aged 81 Anatole Lapine is dead Stuttgart. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, is mourning it’s chief designer of many years, Anatole Carl Lapine, who died on 29 April 2012 in Baden-Baden. Lapine headed up the Style Porsche design studio from 1969 to 1988. Michael Mauer, Porsche’s chief designer since 2004, paid homage to the deceased: “Anatole Lapine shaped Porsche sports car design over more than two decades. As a designer he didn’t follow fashion but was forever setting new trends with his concepts.” Anatole Lapine was born on 23 May 1930 in Riga, Latvia. After the war, Lapine served an apprenticeship as a motor mechanic with Daimler-Benz in Hamburg before attending the Hamburg Wagenbauschule. In 1951 he went to the USA where a year later he began work at General Motors in the advanced body engineering department. In 1965 Lapine returned to Germany and was put in charge of the Opel Research Center. On 15 April 1969 Lapine moved to Porsche as head of the styling department. In addition to the design of the Porsche 911 so-called “G Series” numerous new Porsche models such as the 924, 928 and 944 saw the light of day under Lapine’s direction. But Anatole Lapine and his style team also delivered a number of Porsche Engineering third-party client development design projects. GO Note: Images of Anatole Carl Lapine are available to accredited journalists from the Porsche press database at the following address: https://presse.porsche.de. -

Istoria Porsche Holding
Istoria Porsche Holding Pagina 1 din 13 Istoria familiei Porsche a fost influenat de turbulenele politice de la nceputul secolului, marcat de dezvoltarea uria a tehnicii i a fascinantului automobil. Este istoria unei familii care a contribuit decisiv la dezvoltarea automobilului. Istoria Porsche ncepe cu Ferdinand Porsche, genialul creator de maini Istoria Porsche ncepe la 3 septembrie 1875 n Maffersdorf, Boemia. n aceast! zi se na#te Ferdinand Porsche, al treilea copil al lui Anton Porsche #i al so'iei sale, Anna. La momentul inven'iei automobilului, Ferdinand Porsche are 11 ani. Ferdinand este interesat n special de electricitate. La 13 ani instaleaz! o sonerie electric! #i la 16 ani asigur! iluminatul electric n casa p!rinteasc!. n 1893 #i ncepe cariera profesional! la concernul de uzine electrice Bella ,gger - .o. din /iena. Patru ani mai t0rziu, talentatul Porsche ocup! de1a pozi'ia de #ef al atelierului de testare a electromotoarelor, iar la pu'in timp dup! aceea l reg!sim n pozi'ia de asistent al directorului de ntreprindere. .u pu'in timp nainte de sf0r#itul secolului, Ferdinand Porsche intr! n serviciul furnizorului oficial al cur'ii regale, 2acob Lohner. Aici, Porsche proiecteaz! primul s!u autovehicul cu motor nglobat n butucul ro'ilor, care, sub numele de L3hner4Porsche, atrage aten'ia publicului la e5pozi'ia mondial! de la Paris. Pe acest autovehicul se puteau monta motoare pe toate cele patru ro'i6 prin urmare, poate fi considerat primul autovehicul cu trac'iune integral! din lume. 7n principiu, de altfel, pe care 8ASA l va utiliza 70 de ani mai t0rziu la construc'ia vehiculului selenar. -

VLN Produktionswagen – Einstufungsliste
Einstufungsliste VLN Produktionswagen Klasse V1 bis 1.620 cm³ max. Leistung 90 kW Mindesgewicht 920 kg Max. Weitere Lfd. Verkaufs- ABE / Hubr. kW Soll- LG Hersteller Typ TSN Kraftstoff- Bestimmungen / Nr. bezeichnung EG–Nr. cm³ Serie Gewicht kg/kW Volumen Bulletin 1 BMW R50 Mini Cooper 719 e1*0168* 1598 85 950 11,1 45 2 Citroen S Saxo 293 e2*0036* 1587 87 925 10,63 45 3 Renault N Twingo ARO e2*0359* 1598 98 1030 10,5 45 4 VW 6-ES Lupo 587 e1*0147* 1598 92 950 10,32 45 Stand: 15.07.2020 Her Seite 1 von 1 Nürburgring Langstrecken-Serie " Einstufungsliste VLN-Produktionswagen Klasse V1 Einstufungsliste VLN Produktionswagen Klasse V2 über 1.620 cm³ bis 1.800cm³ max. Leistung 104 kW Mindesgewicht 1.000 kg Max. Weitere Lfd. Verkaufs- ABE / Hubr. kW Soll- Hersteller Typ TSN LG Kraftstoff- Bestimmungen / Nr. bezeichnung EG–Nr. cm³ Serie Gewicht Volumen Bulletin 1 BMW E 36 318ti Com. 549 e1*0017* 1796 103 1135 11,01 65 2 BMW E36 318 is Lim. 535 F 547 1796 103 1180 11,45 65 3 BMW E36 318 is Coup. 518 F 920 1796 103 1180 11,45 65 4 Opel C CorsA 420 e1*0148* 1796 92 1000 10,86 65 E13*95/54*0024*0 5 Ford ECT PumA 310 1679 92 1000 10,86 65 1 Chevrolet E4*2001/116*0314 6 Daewoo KL1J ABU 1796 104 1180 11,34 65 Cruz *03 Stand: 15.07.2020 Her Seite 1 von 1 Nürburgring Langstrecken-Serie " Einstufungsliste VLN-Produktionswagen Klasse V2 Einstufungsliste VLN Produktionswagen Klasse VT1 bis 1.620 cm³ mit Aufladung max. -

ADAC Qualifikationsrennen 24H-Rennen ADAC Nordrhein E.V., Sportabteilung, 50963 Köln
ADAC Qualifikationsrennen 24h-Rennen ADAC Nordrhein e.V., Sportabteilung, 50963 Köln ADAC Qualifikationsrennen 24h-Rennen Reg-No.: R-12213/21 8th to 9th May 2021 Nürburgring, 25378 m Started: 74 Not Started: 1 Result Free Practice Pos. No. Cl. Entrant, Licence | Sponsor, Licence Car Laps Best time Average fasted lap Driver, City, Nation, Licence Interval GAP time 11SP 9 E: ROWE RACING, BIF1121707 BMW M6 GT3 88:16.942 183.846 kph Catsburg Nick, Meer, BEL, NL26501 13:12:05 Edwards John, Davidson, USA, D2481-I-21 A Eng Philipp, Mondsee, AUT, JA 1353 Yelloly Nick, Solihull, GBR, 195156 298SP 9 E: ROWE RACING, BIF1121707 BMW M6 GT3 78:17.069 183.799 kph De Phillippi Connor, Cornelius,North Carolina, USA, D3143-I-21 00.127 +00.127 13:45:26 Tomczyk Martin, Kolbenmoor, DEU, IA1041976 van der Linde Sheldon, Kempten, ZAF Wittmann Marco, Fürth, DEU 38SP 9 E: Mercedes-AMG Team GetSpeed, BIF1157349 Mercedes-AMG GT3 88:18.342 183.330 kph Müller Dirk, Tägerwilen, CHE, IB1053398 01.400 +01.273 13:28:51 Schiller Fabian, Troisdorf, DEU, IC1127224 Vaxiviere Matthieu, Begles, FRA, FR219552 47SP 9 E: Mercedes-AMG Team GetSpeed, BIF1157349 Mercedes-AMG GT3 88:18.541 183.256 kph Götz Maximilian, Uffenheim, DEU, IB1045239 01.599 +00.199 13:38:00 Juncadella Daniel, Dublin, IRL, IA-0023-ESP Schiller Fabian, Troisdorf, DEU, IC1127224 511SP 9 E: Phoenix Racing, BIF1066469 Audi R8 LMS GT3 88:18.737 183.184 kph Beretta Michele, Ello, ITA, IC 347027 01.795 +00.196 13:01:39 Stippler Frank, Bad Münstereifel, DEU, IB1039089 Thiim Nicki, Anif, AUT, 2368 Vincent Kolb, Frankfurt,