Kulturlandschaft Erfassen, Heimat Entdecken!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Niederstetten 2016
Niederstetten - Bevölkerung Bevölkerungsstand in Niederstetten (2005 bis 2014) 5.476 5.423 5.323 5.262 5.222 5.218 4.888 4.868 4.868 4.858 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bevölkerungsentwicklung in Niederstetten (seit 2005) 3,0 % 2,0 % Niederstetten 1,0 % 0,0 % Main-Tauber-Kreis -1,0 % -2,0 % Ländlicher Raum im -3,0 % engeren Sinne -4,0 % Region Heilbronn- -5,0 % Franken -6,0 % Baden-Württemberg 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Geburten und Sterbefälle in Niederstetten 5-Jahres-Wertung (2010- 2014): natürliche Bevölkerungsentwicklung 70 pro 1.000 Einwohner 60 50 Niederstetten -11,7 40 36 Main-Tauber-Kreis -18,0 30 Ländlicher Raum im engeren -11,1 20 37 Sinne 10 Region Heilbronn-Franken -6,4 0 Baden-Württemberg -4,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wanderungssaldi26 Niederstetten 5-Jahres-Wertung (2010 - 2014): Wanderungsgewinne bzw. -verluste 9 8 pro 1.000 Einwohner 1 Niederstetten -1,6 -2 -10 Main-Tauber-Kreis 7,3 Ländlicher Raum im engeren 11,7 Sinne -31 2014 Region Heilbronn-Franken 21,0 2010 2011 2012 2013 2014 Baden-Württemberg 26,5 weibl. Saldo weibl. männl. Saldo männl. Datengrundlage: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (ab 2011: Zensus 2011) Abbildungen und Berechnungen: Regionalverband Heilbronn-Franken Niederstetten - Bevölkerungsvorausrechnung 2015 Bevölkerungsvorausrechnung für Niederstetten (StaLa 2015 u. 2014) StaLa 2015 StaLa 2014 4.900 4.800 2023 4.868 2024 2025 2026 2027 2028 2029 4.700 4540 4.815 4530 4527 4525 4522 4519 4516 4.761 4821 4818 4.713 4814 4811 4808 -

Layout 1 (Page 1)
ASB AKTUELL AKTUELL Ausgabe 02_2010 ASB Mitgliederinfo des ASB Heilbronn-Franken Landesverband Baden-Württemberg e.V. Regionalverband Heilbronn-Franken INHALT _ Grußwort _ Samariterbesuch aus Polen LIEBE SAMARITERINNEN, machen. Unter anderem wird sie sicht- bar durch die Landesförderung des _ MDK bestätigt Pflegequalität LIEBE SAMARITER, FSJ, mit der Baden-Württemberg bun- _ Der ASB - eine atemberaubende Entwicklung LIEBE MITGLIEDER DES ASB, desweit an der Spitze liegt. Dabei _ Arbeiten beim ASB - ein Autist berichtet konnten die bisherigen Fördermittel _ Gut vorbereitet mit dem FSJ für eine funktionierende soziale Ge - von 2,5 Mio. Euro jährlich auf 2,8 Mio. _ ASB Ausflug nach Rothenburg ob der Tauber sellschaft ist das bürgerschaftliche Euro in diesem Jahr und auf 2,9 Mio. _ Das Portrait: Britta Nowatzke Engagement unverzichtbar. Als einer Euro im kommenden Jahr noch einmal _ Der ASB sagt Danke der großen Träger der freien Wohlfahrt erheblich aufgestockt werden. ermöglicht auch der ASB ein Engage- ment für das Gemeinwohl in verschie- Das Freiwillige Soziale Jahr hat sich denen Ausprägungen. Eine besondere zum größten Bereich freiwilligen Form bürgerschaftlichen Engage- jugendlichen Engagements in Baden- ments bildet der Jugendfreiwilligen- Württemberg entwickelt und die Teil- dienst, das Freiwillige Soziale Jahr nehmerzahl wächst stetig. Mit weit (FSJ). Das FSJ - in erster Linie ein Bil- über 6.000 Engagagierten im FSJ in dungsjahr - bietet jungen Menschen diesem Jahr hat Baden-Württemberg die Möglichkeit, sich zwischen Schule seinen Spitzenplatz im Bundesver- und beruflicher Ausbildung in ver- gleich weiter ausgebaut. schiedensten sozialen, sportlichen und kulturellen Bereichen einzubringen, Das Gemeinwohl profitiert in vielfälti- Erfahrungen zu sammeln, soziale ger Weise vom bürgerschaftlichen V.L.: Alexander Mauz, Franz Czubatinski, Izabela Ulas, Kompetenzen zu verbessern, in über- Engagement, doch der freiwillige Barbara Zychowska, Rainer Holthuis, Simone Stroppel. -

Begründung Mit Umweltbericht
Große Kreisstadt Rothenburg ob der Tauber Landkreis Ansbach Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. XXXVI a "Wolffstraße - Bauabschnitt 1 - Altersgerechtes Wohnen" mit integriertem Grünordnungsplan Begründung mit Umweltbericht Vorentwurf vom 25.03.2021 Auftraggeber: Große Kreisstadt Rothenburg ob der Tauber vertreten durch den Oberbürgermeister Dr. Markus Naser Marktplatz 1 91541 Rothenburg ob der Tauber Planverfasser: TB MARKERT Stadtplaner * Landschaftsarchitekt PartG mbB Alleinvertretungsberechtigte Partner: Peter Markert, Stadtplaner und Landschaftsarchitekt Matthias Fleischhauer, Stadtplaner Adrian Merdes, Stadtplaner Rainer Brahm, Landschaftsarchitekt Amtsgericht Nürnberg PR 286 USt-IdNr. DE315889497 Pillenreuther Str. 34 90459 Nürnberg [email protected] www.tb-markert.de Bearbeitung: Matthias Fleischhauer Stadtplaner SRL, AKH, ByAK Jörn Wagner M.Sc. Dipl.-Ing. Stadt- und Regionalplanung Nicolas Schmelter B. Sc. Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur Planstand Vorentwurf vom 25.03.2021 Nürnberg, __________ Rothenburg ob der Tauber, __________ TB|MARKERT Große Kreisstadt Rothenburg o.d.T. _______________________________ _______________________________ Matthias Fleischhauer Oberbürgermeister Dr. Markus Naser Inhaltsverzeichnis A Begründung 6 A.1 Anlass und Erfordernis 6 A.2 Vorbemerkungen zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 6 A.3 Ziele und Zwecke 6 A.4 Kurzbeschreibung des Vorhabens 6 A.5 Verfahren 6 A.6 Ausgangssituation 7 A.6.1 Lage im Stadtgebiet und Eigentumsanteile 7 A.6.2 Städtebauliche Bestandsanalyse 7 A.7 Rechtliche und -

24 Hours in Rothenburg Ob Der Tauber | Real Food Traveler
24 Hours in Rothenburg ob der Tauber | Real Food Traveler 24 Hours in Rothenbu How do you take in an historic and stunning destination in just 24 hours? With a helpful agenda that hit the heights, writer Sandy Bornstein and her husband, Ira, experienced as much as they could in Rothenburg ob der Tauber. https://www.realfoodtraveler.com/24-hours-in-rothenburg-ob-der-tauber/[11/16/19, 12:31:30 PM] 24 Hours in Rothenburg ob der Tauber | Real Food Traveler One of many arches and clocktowers. Rothenburg ob der Tauber: A Medieval German Adventure Just a couple of hours drive from both Munich and Frankfurt, Rothenburg ob der Tauber stands out as a prime example of a surviving medieval European town. The city, frequently referred to as the “Red Fort on the River Tauber,” is surrounded by stonewalls with 42 towers and a plethora of structures that date back to the Middle Ages. When my husband Ira and I drove through the arched entryway, we immediately felt as if we were going back in time. The narrow cobblestone streets were lined with half- timbered houses covered with red-tiled roofs and with sturdier limestone buildings. Each tower we passed ignited our imaginations. We could easily have wandered for https://www.realfoodtraveler.com/24-hours-in-rothenburg-ob-der-tauber/[11/16/19, 12:31:30 PM] 24 Hours in Rothenburg ob der Tauber | Real Food Traveler hours simply enjoying our personal journey back to the Middle Ages. With a limit of 24- hours, we didn’t have the luxury to be carefree. -

Outdoor-Tag Frankenalb-Dorf Movelo Pfingstmontag, 28. Mai, Im Pegnitztal
Outdoor-Tag Natursportfest im Pegnitztal Seite 3 Frankenalb-Dorf in Lungsdorf Seite 4 Movelo Mit dem E-Bike durch die Frankenalb Pfingstmontag, 28. Mai, im Pegnitztal Seite 15 Impressum Herausgeber Tourist-Information Frankenalb 91207 Lauf, Waldluststraße 1 www.frankenalb.de in Zusammenarbeit mit dem Medienverbund Nürnberger Land GmbH & Co. KG Nürnberger Straße 7, 91217 Hersbruck Redaktion Ursula Pfeiffer (Redaktionsleitung) Katja Bub, Tourist-Information Frankenalb Layout/Gestaltung Da geht jeder Pfeiffer Medienhaus, Hersbruck die Wand hoch 3 Fotos Frank Boxler (Titel), Christian Lüke (S. 2) Frankenalb, Armin Tauber Marmot / Klaus Fengler (S. 3), Thomas Geiger (S. 6) Buntes Programm www.kletterfestival.com / Holger Heuber, Outdoorspaß im für Groß und Klein 12 Andreas Hub (S.12) Frankenalb-Dorf 4 Pegnitz bei Düsselbach / Manfred Eder (S. 13) Berg & Ton 12 Movelo (S. 2/15) Bike Park Osternohe/Zweirad Teuchert/ Dive Sector 12 besser biken 4 Fränkischer Albverein 12 Druck Ballonfahren macht Spaß 5 Heuhotel Fischbeck 13 hofmann druck, Nürnberg Bow Vision 5 Kanuschule Noris 13 Claudia’s Pferderanch 6 Mühlenkraft 13 Auflage, Erscheinungsweise Fackelmann Therme 6 MTP 14 200 000, jährlich Fliegenfischen 7 Radsport Müller 14 FP Sportreisen 7 Verkehrsverein Velden 14 Ausgabe FSSC Schlittenhunde 8 2012 (Nummer 10) Golf Gerhelm 8 Golf Hunger 9 Movelo 15 Verteilung Kutschfahrten 9 in den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Nordic Walking 10 Zeitung, im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen-Schwa- Reckenberg Lamas 10 VGN-Fahrplan und bach sowie im Raum Pegnitz, Neumarkt, Forchheim und TV Altdorf Beachvolleyball-Abteilung 11 im Verbreitungsgebiet der drei Heimatzeitungen: Der Wildnisschule Frankenalb 11 Lageplan 16 Bote, Hersbrucker Zeitung und Pegnitz Zeitung. -

Germany-Nature & Culture
Germany – Nature und Culture: 14 days / 13 nights Day 1 Cologne Individual trip to Cologne. Welcome in Germany! Check-in at your hotel in Cologne. 1 night in Cologne Day 2, Cologne – Boppard After breakfast we recommend you to explore the city including the cathedral , an impressive gothic church monument, the city`s landmark. Our recommendation : Visit of the Museum Ludwig . https://www.museum-ludwig.de/en.html Cologne on the Rhine River - Copyright Köln Tourismus - In the afternoon continue to Boppard , a village in one of the major wine growing areas of Germany. 1 night in Boppard . Day 3, Boppard – Boat tour Rhine River – Würzburg Our recommendation s: Morning visit to Ehrenburg Castle. https://www.ehrenburg.de/en/ (Interesting medieval castle to explore on an individual tour with great panoramic views and a good restaurant!) Afternoon: Go on a 1, 5 -hour -river cruise on the Rhine from Boppard to St. Goar (train back to Boppard ). Rheinfels Castle can be visited but only at certain hours. https://www.st-goar.de/en/rheinfels-castle/visting-the- castle/ Ehrenburg Castle near Boppard - Copyright Ehrenburg Castle - Continue to Würzburg arriving there in the evening. 3 nights in Würzburg. Day 4, Würzburg Würzburg – view of Fortress Marienberg Würzburg and its many churches Copyright Würzburg Tourismus The city is located in Northern Bavaria on the River Main, known for its lavish baroque and Rococo architecture with the 18th-century Residenz Palace being a highlight of this period. The city is within the heartlands of the Franconian wine country with vineyards on both sides of the River Main. -

Hohenlohe-Ostalb-Weg Von Der Donau an Die Tauber
HOHENLOHE-OSTALB-WEG VON DER DONAU AN DIE TAUBER Vom romantischen Taubertal Streckenbeschaffenheit: über „Schwäbisch Sibirien“ Wegequalität: überwiegend asphaltiert, bis zum höchsten Kirchturm teilw. wassergebundene Schotterwege. der Welt durchquert der rund Steigungen: von Rothenburg bis Wasseral- 170 km lange Hohenlohe-Ost- fingen viele mittlere Steigungen alb-Weg nicht nur ganz unter- Verkehr: kein bis wenig Verkehr schiedliche Landschaften, Eignung für Kinder oder Ungeübte: sondern bringt den Radler Die Gesamtstrecke aufgrund der Steigun- mit einigen starken Steigungen gen eher weniger geeignet, nur einzelne auch ganz schön ins Schwitzen. Etappen sind gut geeignet. Die Route, die am östlichen Rand Baden-Württembergs verläuft, Übernachten: startet im romantischen Roten- burg ob der Tauber und führt über In Baden-Württemberg finden Sie über das idyllische Jagsttal nach Ell- 600 vom ADFC als radfahrerfreundlich wangen. Dort kann noch heute ausgezeichnete Hotels, Gasthöfe, der typische Grundriss einer Pensionen und Ferienwohnungen. Klosterstadt besichtigt werden. Wer sich mehr für Römer interes- Zur Online-Bett & Bike-Datenbank Die Limes-Therme in Aalen lädt ein siert, sollte in Rainau einen Stopp zu einem Sprung ins erfrischende Nass. am Freilichtmuseum am rätischen Limes einplanen, bevor die Fahrt Veranstaltungshighlights an der Strecke: weiter nach Aalen-Wasseralfingen geht. Dort teilt sich die Route in eine etwas anspruchsvollere Ost- und eine Westroute. Während die Ostroute · Ulm: Schwörmontag mit Wasserfestzug durch das „Schwäbische Sibirien“ mit den typischen Wacholderheiden Nabada und Schafherden über Neresheim bis Giengen an der Brenz führt, · Aalen: Jazzfest verläuft die Westroute direkt durch das Brenztal an zahlreichen Burgen, · Ellwangen: Kalter Markt (Pferdemarkt Schlössern, Parks und Museen vorbei. In Hürben treffen Ost- und West- nach Hl. -

Wir Bedanken Uns Ganz Herzlich Bei Den Herausgeberinnen Frau Lochbihler Und Frau Schalm Für Die Unterstützung Und Die Genehm
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Herausgeberinnen Frau Lochbihler und Frau Schalm für die Unterstützung und die Genehmigung, die Geschichte der Familie Guggenheimer aus ihrem Buch "Allgäuerinnen" an dieser Stelle zu veröffentlichen. ALLGÄUERINNEN - herausgegeben von Barbara Lochbihler und Sabine Schalm edition ebersbach, ISBN 978-3-86915-076-5 Annemarie Guggenheimer mit ihrer Tochter Ursula, ca. 1925 Manche Spuren menschlicher Existenz verblassen schneller als andere Die Geschichte einer „privilegierten Mischehe“ in Memmingen Von Maximilian Strnad Es sind jene Schicksale einfacher Menschen – häufig die von Frauen –, die im Schatten berühmterer – meist männlicher – Biografien nicht selten unbeachtet bleiben. Dieser Beitrag er- zählt von einer solchen Geschichte aus Memmingen. Sie be- ginnt mit dem Nachlass1 zweier Frauen: dem von Annemarie Guggenheimer, geborene Meitinger, und ihrer Tochter Ursu- la. Die Erinnerung an ihr Leben liegt, verpackt in zwei grauen Kartons, im Memminger Stadtarchiv.2 Lange Zeit lagen sie unbeobachtet in einem Regal der Bibliothek und verstaub- ten. Erst kürzlich wurden sie von Christoph Engelhard, dem Leiter des Archivs, wieder entdeckt. In den Kartons befinden sich einige dicke Mappen mit unsortierten Briefen, Postkar- ten, Kontoauszügen und Rechnungen sowie eine Menge nicht beschrifteter Fotos. Das ist nahezu alles, was noch an die Exis- tenz der beiden Frauen erinnert. Lebende Verwandte gibt es keine mehr. Wer waren diese beiden Frauen? Anna Maria Meitinger wurde am 7. April 1896 in München geboren. Sie stammt e aus einem bürgerlich katholischen Haushalt. Ihr Vater war Oberingenieur in Regensburg. Im Juni 1922 heiratete sie in Oberstdorf den 20 Jahre älteren jüdischen Pferdegroßhändler Alfred Guggenheimer. Guggenheimers waren eine in Mem- mingen seit 1866 ansässige, gutsituierte Familie. -

Diplomová Práce
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Katedra pomocných věd historických a archivního studia DIPLOMOVÁ PRÁCE Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku ============================================================= Czech-Bavarian Kultural Relations in Early Middle Ages autor: Bc. Jan Hasil vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. konzultanti: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. PD Dr. Hans Losert Praha 2010 1 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu. V Horoušanech dne 8. srpna 2010 2 Poděkování Je mou milou povinností poděkovat na tomto místě celé řadě mých učitelů, přátel a blízkých, bez jejichž pomoci radou a skutkem by tato práce nemohla vzniknout v předkládané podobě. Na prvním místě děkuji vedoucímu práce profesoru Janu Klápštěmu, především za to, že mi toto náročné téma svěřil, stejně jako za nekonečnou trpělivost, s níž střežil mé odborné kroky a vycházel vstříc mým prosbám a dotazům v uplynulých letech. Dlouhý výčet těch, kteří mi pomáhali mnoha hodinami konzultací a diskusí nad jednotlivými segmenty zpracovávaného tématu, zdobí jména profesorek Marie Bláhové a Lenky Bobkové, profesorů Ivana Hlaváčka, Jiřího Slámy, Josefa Žemličky a Erika Szameita, docentů Marka Sankeho a zejména Hanse Loserta. Jemu patří zcela zvláštní poděkování za to, že mě k problematice slovanského osídlení severovýchodního Bavorska přivedl, za nevýslovnou obětavost, s níž mě v uplynulých letech seznamoval s archeologickým materiálem, literaturou i badatelskými osobnostmi severovýchodního Bavorska, a v neposlední řadě mu děkuji za to, že mě přijal do okruhu svých bamberských žáků a přátel. V této souvislosti nemohu nepoděkovat za zanícené diskuse všem členům Losertovské stolní společnosti pravidelně se scházející v magické Schlenkerla. -

Das Proletarische Milieu in Röthenbach an Der Pegnitz Von 1928 Bis 1933
11 Bamberger Historische Studien Das proLetarisChe MILieu in RÖthenbACH an der PegnitZ von 1928 bis 1933 JULIA OBERST UNIVERSITY OF BAMBERG PRESS Bamberger Historische Studien Band 11 Bamberger Historische Studien hrsg. vom Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Band 11 University of Bamberg Press 2013 Das proletarische Milieu in Röthenbach an der Pegnitz von 1928 bis 1933 Julia Oberst University of Bamberg Press 2013 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbi- bliographie; detaillierte bibliographische Informationen sind im Internet über http://dnb-nb. de abrufbar. Dieser Band ist als freie Onlineversion über den Hochschulschriften-Server (OPUS; http:// www.opus-bayern.de/uni-bamberg/) der Universitätsbibliothek Bamberg erreichbar. Weiter- verbreitung in digitaler Form, die Vervielfältigung von Auszügen und Zitate sind unter Angabe der Quelle gestattet. Übersetzung oder Nachdruck des gesamten Werkes oder vollständiger Beiträge daraus wird mit der Auflage genehmigt, der Universitätsbibliothek der Otto-Fried- rich-Universität Bamberg, D-96045 Bamberg, ein Exemplar der Publikation kostenlos zu über- lassen. Bitte schonen Sie Bibliotheksexemplare und verzichten Sie auf die Anfertigung von Kopien. Laden Sie stattdessen die PDF-Datei auf Ihren Computer und drucken Sie die Seiten aus, von denen Sie Kopien benötigen. Die vollständigen bibliographischen Angaben sind am Ende -

Organic Farming and Market in the European Union Edition
2019 Organic Farming and Market in the European Union Edition ORGANIC FARMING AND MARKET IN THE EUROPEAN UNION International publications by Agence BIO 2019 Edition 1 Organic Farming and Market in the European Union Table of contents THE DEVELOPMENT AND CHARACTERISTICS OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION ......................................4 GROWTH CONTINUED IN 2017 AND 2018 ...................................................................................................................................... 4 7.5% OF THE AGRICULTURAL AREA OF THE EU WAS GROWN ORGANICALLY IN 2018.............................................................................. 7 MAIN DEVELOPMENTS BETWEEN 2000 AND 2018 .......................................................................................................................... 8 A SHARE OF IN-CONVERSION AREAS HIGH IN A LARGE NUMBER OF COUNTRIES ...................................................................................10 SIGNIFICANT REGIONAL SPECIFICITIES WITHIN EACH COUNTRY ......................................................................................................... 11 OTHER OPERATORS IN THE ORGANIC SECTOR ................................................................................................... 13 A HETEROGENEOUS DEVELOPMENT OF THE PROCESSING OF ORGANIC FOOD ACCORDING TO THE COUNTRIES ......................................... 13 IMPORTERS AND EXPORTERS OF ORGANIC PRODUCTS.................................................................................................................... -
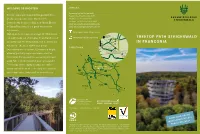
Treetop Path Steigerwald in Franconia
WELCOME TO RADSTEIN IMPRINT Baumwipfelpfad Steigerwald You can experience beautiful Steigerwald from Bayerische Staatsforsten AöR another perspective since March 2016. Radstein 2, 96157 Ebrach Telefon: +49(0)9553 989-80102 Conveniently located on B22 near Markt Ebrach Mail: [email protected] in Upper Franconia, it is a great excursion in www.baumwipfelpfadsteigerwald.de any season. @Baumwipfelpfad.Steigerwald High up in the treetops, on a length of 1150 meters Direction to Steigerwald- our path made out of Douglas fir and larch wood @baumwipfelpfadsteigerwald zentrum TREETOP PATH STEIGERWALD exit deer winds through the Steigerwald, rich in deciduous park way IN FRANCONIA back hardwood - the trees within your grasp! OBSERVATION TOWER DIRECTIONS pathway Out centrepiece is a tower, 42 meters in height, entry cash-desk dining area allowing you truly impressive views over the administration Franconian Plateau and the surrounding Steiger- wald. Take a moment and let your eyes wander. The design of this sturdy construction with a Handthal maximum incline of 6% is also fully accessible to Neuses wheelchair users, baby strollers and rollators. Schlüsselfeld Neustadt an der Aisch This institution is funded by the State of Bavaria. OPEN YEAR-ROUND Nr. PEFC/0421031/024200000001 WHEELCHAIR ACCESS The Bayerische Staatsforsten are PEFC-certified. This flyer has been printed on PEFC-certified paper. FAMILY-FRIENDLY (PEFC/04-31-2017) Content and structure of this publication are protected by copyright. The repro- duction of information or data, especially the use of texts, partial text or graphic material, is subject to prior consent by the Bayerische Staatsforsten. EXPERIENCE NATURE & ANIMALS UP CLOSE RESTAURANT AT BAUMWIPFELPFAD OPENING HOURS AND FURTHER INFORMATION Our restaurant caters to all appetites, big or small: we serve you a range of freshly prepared regional and international meals.